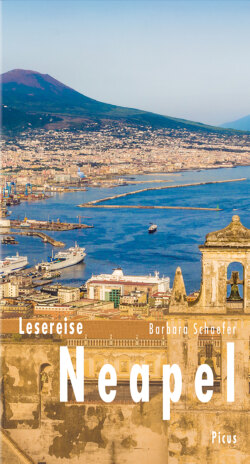Читать книгу Lesereise Neapel - Barbara Schaefer - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prendiamo un caffè Wie Neapel den caffè sospeso erfand
ОглавлениеDer Satz, so schlicht er sein mag, ist praktisch unübersetzbar: Prendiamo un caffè. »Lass uns einen Kaffee trinken« bedeutet er jedenfalls nicht. Das Problem fängt schon damit an, dass Kaffee und caffè zwei völlig verschiedene Dinge sind. Ein Kaffee ist Filterkaffee in einer ordentlich großen Tasse, ein italienischer caffè hingegen, also das, was man auf Deutsch Espresso nennt, auch wenn es in Italien so nicht heißt, ist ein Nichts. Ein guter Fingerhut voll in einer kleinen, dickwandigen Espressotasse. Und sei die Tasse noch so klein, so bedeckt der caffè doch fast nur den Boden. Beinahe könnte man schon die Zukunft aus dem Kaffeesatz lesen, bevor man überhaupt getrunken hat. Getrunken ist er natürlich schnell. Ein Tütchen Zucker aufreißen, reinrieseln lassen, kurz umrühren, zack weg.
Aber auch die Aufforderung, Kaffee zu trinken oder eben einen caffè »zu nehmen«, bedeutet etwas völlig anderes. Unsere Vorstellung davon, sich auf eine Tasse Kaffee zu treffen, meint, in ein Café zu gehen, sich hinzusetzen, Kaffee zu bestellen und vermutlich auch ein Stück Kuchen dazu, während man darauf wartet, plaudert man. Oder gar auf der Straße einen Pappbecher mit sehr viel Milch und nur einem Schuss Kaffee herumzutragen.
Der caffè hingegen steht für die Ouvertüre, damit beginnt alles. Etwa so: Ich habe eine Verabredung mit jemandem, den ich nicht kenne. Sein Büro befindet sich in dem Hochhaus direkt an der Piazza Garibaldi, der Eingang versteckt sich im Bahnhofsinneren. Endlich hat man sich durchgefragt, die Tür gefunden, den Aufzug. In der entsprechenden Etage muss ich mich beim Portier anmelden, der telefoniert, sagt: Einen Moment bitte, man nimmt auf seltsamen Polstermöbeln Platz und endlich kommt er, nennen wir ihn Luca. Händeschütteln, Begrüßung, wir gehen in sein Büro, ich soll wieder Platz nehmen, er räumt Stapel von Zeitungen beiseite, schreibt kurz noch eine Mail und sagt: »Dai, prendiamo un caffè.« Das bedeutet nun natürlich nicht, dass er in eine – nicht vorhandene – Teeküche geht und dort eine Kanne holt, in der seit Stunden Kaffee vor sich hin simmert. Sondern: Wir gehen raus, vor zum Portier, runter mit dem Aufzug, durch den Bahnhof, ciao Enzo, wie geht es dir, wir telefonieren, ciao Maria, ah wir sehen uns nachher gleich. Luca scheint hier viele zu kennen.
Wir gehen in eine Bar. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Eine Bar ist keine Bar, sondern, ja, wie soll man es erklären? Etwas, das sich im deutschsprachigen Raum leider nicht durchgesetzt hat. Ein langer Tresen, dahinter wuselige bariste, die mit Getöse Siebträger ausklopfen, neu befüllen, einspannen, Milch aufschäumen und dabei viele schwungvolle Bewegungen ausführen.
Auf Stühle könnte man sich hier auch setzen. Theoretisch. Was möchtest du? Einen caffè? Eigentlich ist das keine Frage, tatsächlich möchte ich aber keinen caffè. Ich habe schon vier davon getrunken, nach den zwei cappuccini zum Frühstück. Die schwarze Lava brodelt in meinen Venen, das Herz pumpt wie eine Magmakammer, ich möchte wirklich und ganz bestimmt keinen caffè mehr. Nichts gibt es nicht, also möchte ich ein Mineralwasser. Das geht aber auch nicht, das ist irgendwie zu wenig. Eine Lemonsoda. Ja, endlich ist Luca mit meiner Bestellung einverstanden. Natürlich habe ich keine Chance zu bezahlen. Aber auch die drei Männer, die Luca beim Eintreten begrüßt hat, kommen nicht zum Zug. Luca zahlt fast eine Lokalrunde, die Freunde protestieren angemessen. Wir gehen raus, in den Bahnhof, Luca erklärt, das nächste Mal würden eben die Freunde bezahlen, »so machen wir das in Neapel«.
Wieder spazieren wir durch den Bahnhof, wieder treffen wir auf Leute, und Luca sagt zu ihnen: »Darf ich vorstellen, eine Freundin aus Deutschland.« Das macht den Unterschied: Wir haben schließlich schon einen caffè zusammen getrunken. Wir sind alte Freunde. Als wären wir schon gemeinsam ums Lagerfeuer gesessen.
Prendiamo un caffè ist also ein essenzieller Bestandteil des Lebens in Italien, in Süditalien vor allem. Ein Espresso im Stehen – die Stühle sind wirklich nur Dekomaterial – kostet neunzig Cent, die Vorstellung, sich das nicht leisten zu können, erschütterte die Neapolitaner. Und deshalb erfanden sie den caffè sospeso, einen aufgeschobenen caffè. Das geht so: Man trinkt seinen Espresso, bezahlt aber zwei davon; den zweiten für einen nächsten, unbekannten Gast. Es sei so, als würde ein glücklicher Neapolitaner »dem Rest der Welt einen caffè bezahlen«, beschreibt es der Schriftsteller Luciano de Crescenzo.
Das Gran Caffè Gambrinus, das edelste Kaffeehaus Neapels am Ende der Via Toledo, an der Piazza Trieste e Trento, reklamiert für sich, an seinem Tresen sei der »aufgeschobene caffè« das erste Mal serviert worden, und zwar schon Mitte des 19. Jahrhunderts. So steht es auf einer großen Tafel an der Fassade. Andere Quellen schreiben die Anfänge des Solikaffees der Zeit des Zweiten Weltkriegs zu, als es vielen Menschen in der Stadt sehr schlecht ging. Auf jeden Fall Fahrt aufgenommen hat das Caffè-Trinken, und damit auch der sospeso, mit der Einführung der 1905 – ausgerechnet in Mailand – erfundenen Pavoni. Dank der ersten halb automatischen Kaffeemaschine mit dem klassischen Dampfdruckhebel ging das Caffè-Zubereiten so schnell wie ein D-Zug, espresso eben.
Im Gran Caffè Gambrinus steht heute ein großer Metallbehälter, eine historische Kaffeemaschine, sie trägt eine Aufschrift in zahlreichen Sprachen, hier könne man einen scontrino, also den Kassenzettel, für einen caffè sospeso hinterlassen.
Andere Bars in der Altstadt weisen mit einem Foto auf den Gebrauch des sospeso hin. Es zeigt eine Filmszene mit Totò, dem berühmtesten neapolitanischen Schauspieler. Wie verwoben die Stadt und der caffè sind, belegt auch eine andere Filmszene, darin erklärt die junge Sophia Loren, aufgewachsen in der Nähe von Neapel, das perfekte Rezept für das Getränk. Natürlich röstet sie die Bohnen dafür selbst, wie sie heiter und im Dialekt erklärt. Die Balkonszene aus dem Film »Questi fantasmi« ist die Abwandlung einer Komödie eines weiteren berühmten Neapolitaners, Eduardo de Filippo.
Und wer irgendwo Straßenmusiker mit traditionellem Repertoire stehen sieht, muss nur ein, zwei Lieder abwarten, dann wird der neapolitanische Gassenhauer »A tazz’ e cafè« erklingen, und die Umstehenden werden einstimmen: »Vurría sapé pecché si mme vedite, facite sempe ’a faccia amariggiata …« »Ich würde gerne wissen, warum du immer so ein saures Gesicht machst, wenn du mich siehst«, heißt das in etwa aus dem Neapolitanischen übersetzt. In der canzone von 1918 jammert ein Besucher, warum die barista Brigida ihn so schlecht behandelt. Sie sei wie eine tazza di caffè: Tief drinnen süß, aber auf der Oberfläche bitter. Er aber brauche »das Süße der Tasse« jeden Tag.
Luca, der bei unserem Barbesuch seine Freunde eingeladen hat, sagt, für ihn sei der caffè sospeso Teil der neapolitanischen Identität. So könne auch irgendein armer Mensch einen caffè trinken. »Wir sehen das als ein Zeichen von Normalität und von Würde. Es bedeutet: Du bist noch Teil der Gesellschaft«, sagt der Neapolitaner.