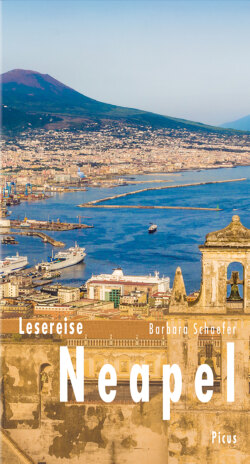Читать книгу Lesereise Neapel - Barbara Schaefer - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Spaccanapoli Eine Straße, die teilt und verbindet zugleich
ОглавлениеEs tropft und riecht nach Waschmittel. Wie ein messerscharfer Schnitt durch eine Buttertorte zerteilt die Via Pasquale Scura die Altstadt Neapels. Mit dieser engen Straße beginnt Spaccanapoli, eine Abfolge von sieben Straßen, deren Name tatsächlich dies bedeutet: Neapelzerteilerin. Vor allem von oben, vom Stadthügel Vomero aus, ist diese Schneise gut zu erkennen. Dabei ist die Straße genau genommen älter als die Häuser an ihren Seiten, denn sie folgt bis heute dem Decumanus, der wichtigsten Ost-West-Achse der antiken römischen Stadt – die auch schon ihrem griechischen Vorläufer in Neapolis, der Neuen Stadt, entsprach.
Steigt man vom Vomero steile Treppen hinab, kann man sich direkt in Spaccanapoli einfädeln und gelangt mitten hinein in den Bauch Neapels. Es tropft und riecht nach Waschmittel, weil hier traditionell die Wäsche über die Gasse gespannt wird, heute war Feinwäsche dran, Dessous baumeln an den Wäscheleinen. Darunter verkauft Electrolux Haushaltsleitern und Bügeleisen. Die Bäckerei Pane, Amore e Fantasia wird umlagert von Nachbarinnen, cornetti und pane – das Gebäck des Hauses – müssen wohl gut sein. Einer auf einem E-Bike mit dicken Reifen kommt vorbei, grüßt den Bäcker. Es folgen ein Wettbüro, eine polleria, also eine Hähnchenbraterei, ein Obststand, ein Putzmittelladen; hier wohnen die, die schon immer hier wohnten, auch wenn das nun als Fußgängerzone ausgewiesen ist. Das heißt, hier fahren also fast nur Motorroller; umkurven erschreckend nah die Passanten. Abstand halten? Solange dich der Rückspiegel nicht streift, ist doch alles in Ordnung.
Aber gegenüber der Bäckerei ist das Birrificio Geco eingezogen, das »Craft Beer« ausschenkt, und das sagt schon alles. Wo Craftbier angeboten wird, breitet sich die Gentrifizierung aus, hier verkehrt nicht mehr nur die Nachbarschaft.
Spaccanapoli geht weiter als Via Maddaloni und kreuzt die Via Toledo, die Einkaufsmeile der Stadt – von Einheimischen immer noch Via Roma genannt. Denn unter den Faschisten war alles verboten, was nicht italienisch war. Also wurde die Via Toledo in Via Roma umgetauft, eine Via Roma sollte durch jede Stadt führen, und natürlich musste das eine repräsentative Straße sein. Hierher kamen die Menschen zum Bummeln, fare lo struscio hieß das, struscio bedeutet Streifen und bezeichnete das Geräusch der Kleidersäume auf dem Boden.
Weiter geht es in die Altstadt, kurz danach heißt Spaccanapoli Via Domenico Capitelli, hier beginnt jener Teil des centro storico, der 1995 von der UNESCO als »Patrimonio dell’umanità« ausgezeichnet wurde, als Weltkulturerbe. Sofort steigt die Dichte an Souvenirläden mit Keramik aus Vietri, bunten Nudeln, Lederwaren. Ich kaufe mir eine Umhängetasche, die ich auch quer tragen kann. Denn vor dem Handtaschenraub von Motorrollern aus, dem sogenannten scippo, sollte man sich immer noch in Acht nehmen.
Aber Spaccanapoli hat sich verändert. Vor Jahren war es hier düster, unheimlich, man schaute, dass man weiterkam, wenn man sich hierher verirrte. Heute muss man eher schauen, dass man noch vorwärtskommt. Hat ein Kreuzfahrtschiff angelegt, und davon kommen nun viele, schieben sich Gruppen durch die enge Gasse. Mordi e fuggi wird dieser Tourismus genannt, beißen und flüchten lautet die wörtliche Übersetzung, »auf die Schnelle« die übertragene Bedeutung. Alle wollen dieses spezielle Neapelgefühl genießen, und einige auch die Sehenswürdigkeiten. Tatsächlich bietet die berühmte Straße nicht nur Atmosphäre in geballter Version – sondern auch viel zu sehen.
So an der ersten breiteren Stelle, der Piazza del Gesù Nuovo. Gerade wird eine ganze Welle junger Menschen aufs Pflaster gespült. Es ist Mitte September, der erste Schultag nach den endlosen Sommerferien zu Ende. Alle chillen, checken ihre Handys, haben einander viel zu erzählen. Nebenan steht die Jesuitenkirche Gesù Nuovo, ein Umbau, entstanden aus einem Renaissancepalast, dessen Besitzerfamilie in Ungnade gefallen war und Neapel verlassen musste. Die Jesuiten schnappten sich den palazzo mit der auffälligen Fassade: Die Diamantenquader aus Tuffstein zeigen eigenartige Querstriche. Eine Erklärung lautet, sie stammten von den Handwerkern, die so festhielten, was sie gebaut hatten, und abrechneten. Eine andere These besagt: Die Jesuiten hätten darin eine alte Notenschrift versteckt. 1767 wurden dann auch die Jesuiten aus dem Königreich Neapel verbannt, durften aber ein halbes Jahrhundert später zurückkehren.
Auch ein Blick auf das Straßenpflaster lohnt sich: blank gewetzte und schwarz glänzende Quader, Basalt vom Vesuv. Doch vor allem fällt auf: Überall ist es eng und voll. Der Eindruck täuscht nicht: Im Durchschnitt liegt die Bevölkerungsdichte in Neapel bei über achttausend Menschen pro Quadratkilometer, das allein ist schon fast das Doppelte von München. In der Innenstadt aber, etwa im neunten Stadtteil San Lorenzo, sind es rund dreiunddreißigtausend Einwohner pro Quadratkilometer.
Aus einem Hof nebenan fahren vier schwere Motorräder heraus, vier Männer nehmen auf dem Soziussitz Platz, keiner der acht Fahrer trägt einen Helm, das fällt sogar in Neapel auf. »Zivilpolizei«, raunt mir eine Neapolitanerin zu. Woher sie das wisse, frage ich. »Das sieht man doch sofort«, sagt sie mit einem müden Lächeln.
Eine gewisse Mattigkeit bemächtigt sich meiner nun. Zu viele Menschen, zu viele Eindrücke, aber genau hier naht Abhilfe. Wenige Schritte entfernt wartet Santa Chiara, ein gewaltiger gotischer Kirchenbau, mit seinem zauberhaften zierlichen Kreuzgang, dem Chiostro delle Maioliche. Maria Amalia von Sachsen, die Gattin des neapolitanischen Bourbonenkönigs Karl III., ließ den Kreuzgang einst in einen Garten verwandeln. Hier kann man durchatmen, Vögel zwitschern, Orangenblütenduft zieht vorbei und die Farbenpracht ist doppelt: Begrenzungsmauern, Säulen und Bänke sind geschmückt mit bunten Majolika-Fliesen.
Erholt wie nach einem kurzen Mittagsschlaf werfe ich mich wieder in Spaccanapoli. Meine Wasserflasche ist leer, ich sehe einen Brunnen, »kann man das trinken?«, frage ich die Umstehenden. »L’acqua é buona«, rufen sie aus, zur Bestätigung beugt sich einer hinunter, drückt auf den Knopf des messingfarbenen Hahnes, trinkt sogleich. Ich fülle meine Flasche auf. Wo kommt Neapels Wasser her? Kurz geht mir ein Thriller von Robert Harris durch den Kopf. In »Pompeji« erzählt er spannend und anschaulich ganz nebenbei die Geschichte der Trinkwasserversorgung Neapels während des Römischen Reiches. Es wurde und wird aus der Gegend des Vesuv in die Stadt geleitet.
Ausnahmslos alle Souvenirläden bieten kleine rote Hörnchen an, meist als Schlüssel- oder Kettenanhänger. Das curniciello erinnert an eine Pepperonischote, wurzelt aber tief im Aberglauben. Es soll gegen den bösen Blick helfen, wirkt aber nur, wenn man es geschenkt bekommt. Ein perfektes Mitbringsel also. Es ist traditionell aus Koralle, meist aus bemalter Terrakotta oder eben aus Plastik und aus China.
An der nächsten, blau-weiß dekorierten Bar hängen Bilder des inoffiziellen Stadtheiligen: Maradona, seit fast schon vierzig Jahren verehrtes Idol der Stadt. Diego Armando Maradona Franco, geboren 1960 in Argentinien, kam 1984 als bereits weltberühmter Fußballer zum SSC Napoli. Ein nie gelüftetes Geheimnis blieb, wie der Verein die gewaltige Ablösesumme von damals vierundzwanzig Millionen D-Mark auftreiben konnte. Der Ankauf lohnte sich jedenfalls: Mit und für den SSC Napoli gewann Maradona bis 1991 zweimal die italienische Meisterschaft sowie den italienischen Pokal und den UEFA-Pokal. Für Neapel war der Argentinier Balsam auf die wunde Seele, man konnte den großen norditalienischen Teams etwas entgegensetzen, Neapel galt etwas, und nicht nur in der Fußballwelt. Maradonas Titelflut machte ihn zum Helden der Stadt. Aber der Sturz war tief: Bei einer Dopingprobe wurde ihm 1991 Kokain nachgewiesen, Maradona setzte sich nach Argentinien ab. Dort wurde er wegen seines Drogenkonsums verhaftet, zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, als Spieler gesperrt und zu einer Entziehungskur verpflichtet. Eine Vaterschaftsklage kam noch hinzu. Das scheint in Neapel alles vergessen, nicht aber die Erfolge, Siege, Triumphe, auch wenn diese nun fast vierzig Jahre zurückliegen. Das Gesicht hochemotional verzerrt ist sein Porträt in der Stadt allgegenwärtig, und das blau-weiße Trikot mit der Nummer 10 kann man als Souvenir kaufen. Der SSC Napoli aber war nach Maradonas Weggang im freien Fall, stieg ab, verschuldete sich, musste 2004 Konkurs anmelden. Später hat er sich berappelt und spielt heute wieder verlässlich oben mit. Doch Maradonas Trikotnummer 10 wird nicht mehr vergeben.
Da sich auf den knapp zwei Kilometern von Spaccanapoli alles ereignet, was zu Neapel gehört, wird hier auch viel geheiratet. Immer wieder flaniert ein Brautpaar mit Gefolge vorbei. Alle haben sich fein gemacht, so gehört sich das, so wird es auch erwartet. Doch mit den pompösen Feiern verschulden sich junge Leute oft auf Jahre hinaus. In Spaccanapoli werden sie von ihren angeheuerten professionellen Hochzeitsfotografen bedrängt. Und über allen schwirrt eine Drohne.
Weiter Richtung Via Benedetto Croce, gewidmet dem neapolitanischen Philosophen und liberalen Kämpfer gegen den Totalitarismus. Es wird voller, und die Straße mehr und mehr zur Streetfood-Meile. Hunger habe ich nach dem Spaziergang ohnehin, ich kann wählen zwischen pizza fritta, also fettig frittierter Pizza, Frittiertem in Tüten oder den unglaublich leckeren taralli, in einem Schaufenster wie Goldpreziosen präsentiert. Ein Handtellergroßer, salziger Gebäckring, dicht bestückt mit Mandeln.
Unter der Pestsäule am Largo San Domenico hocken Studierende, und an den Straßenständen staubt ein fliegender Händler die grün verspiegelten Sonnenbrillen mit einem Federbusch ab. Wie viel Staub und Dreck in der Luft Neapels hängt, merkt man abends im Hotel, wenn man sich das Gesicht wäscht und eine schwarze Brühe ins Waschbecken gluckert.
Eine Ecke weiter breiten Straßenhändler, meist Schwarzafrikaner, auf Kartons oder Laken ihre Ware aus. Bis die carabinieri sie verjagen. Zwei Zivilpolizisten kommen: »Hopp, zusammenpacken!« Die Afrikaner schnappen sich die vier Zipfel ihrer Betttücher, auf denen sie ihre Fake-Handtaschen ausbreiten, und sind weg. Scusi, entschuldigen sie sich noch bei der Polizei. Für den Fehler, nicht gemerkt zu haben, dass Polizei kommt. Und gehen eine Ecke weiter und packen wieder aus. Natürlich sind gefälschte Waren auch in Italien verboten. Die Straßenhändler sind nur die sichtbaren, kleinen Leute, das Geschäft dahinter macht die Camorra. In einem Bild zusammengefasst hat das Banksy. Auf der kleinen Piazza Gerolomini prangt ein kleines Bild des britischen Streetart-Künstlers. Es zeigt eine Madonna, in deren Heiligenschein eine Pistole steckt; Katholizismus und Camorra in einem Bild vereint.
Noch einmal Kunst, aber diesmal hauswandgroß, taucht bald auf. Sie leitet den Übergang zum Stadtviertel Forcella ein, ein harter Kiez, auf einmal sind kaum noch Touristen zu sehen. Um das zu ändern, schuf der Straßenkünstler Jorit Agoch das riesige Mural. Es zeigt San Gennaro, den echten Stadtheiligen Neapels.
Wer weitergeht, lernt mehr über die Stadt als beim Spaziergang im oberen Teil von Spaccanapoli. Denn was Neapel tatsächlich spaltet, und eben vieles zerstört, sind die brutalen kriminellen Hintergründe. In der Via Vicaria Vecchia listet ein Schriftband mit dem Titel #noninvano endlos viele Namen auf, »le vittime innocenti della criminalità in Campania«, die unschuldigen Opfer der Kriminalität in Kampanien, die eben nicht umsonst – invano – gestorben sein sollen. Bald folgt die Associazione Annalisa Durante, eine Art Stadtbibliothek und Sozialzentrum, gewidmet der Vierzehnjährigen, die bei einer Schießerei ums Leben kam. An der Wand hängt ein Zeitungsartikel, in dem der Vater des Mädchens bewegend erzählt.
Hier, wo im Erdgeschoss nicht die Souvenir-Curnicielli verkauft werden, wirkt Spaccanapoli noch wie vor dem Tourismusboom. Hier wohnen in den ebenerdigen Wohnungen, den bassi, noch die einfachen und oft armen Leute. Jene bassi, auch bekannt unter der neapolitanischen Bezeichnung o Vascio, sind kleine Häuser mit ein oder zwei Räumen im Erdgeschoss und direktem Zugang zur Straße. Durchs Fenster sieht man direkt ins Wohnzimmer, da steht oft das motorino, der Motorroller, zwischen Fernseher und Schlafcouch.
Die neapolitanische Schriftstellerin Matilde Serao, die einige Jahre in einem basso lebte, beschreibt diese so: »Häuser, in denen man im Kabuff kocht, im Schlafzimmer isst und im selben Raum stirbt, in dem andere schlafen und essen; Häuser, deren Keller, die ebenfalls von Menschen bewohnt sind, den alten Strafgefängnissen ähneln.« Die bassi galten als Synonym für Wohnungen armer Leute, aus ihnen heraus gab es wegen der schlechten hygienischen Bedingungen Pestepidemien und Cholera-Ausbrüche. 1881 existierten nach einer Volkszählung rund dreiundzwanzigtausend bassi, in denen hundertfünftausend Neapolitaner lebten, das war aber noch nicht der Höchststand. 1931 waren es über dreiundvierzigtausend mit fast zweihundertzwanzigtausend Bewohnern. Das war ein Viertel der Einwohner Neapels.
Manche bassi sind heute umgemodelt zu Ferienwohnungen, B & B, wie das auch in Italien heißt. Wobei das zweite »B«, das Breakfast, auch gerne mal aus einer Schublade mit Zwieback, Keksen und Kaffeepulver besteht. Sucht man auf den einschlägigen Plattformen nach einer zentralen Unterkunft, muss man sich die Fotos schon genau ansehen. Manchmal sehen die Apartments toll aus, sind schön möbliert, aber alles wirkt lichtlos. Moment, wo ist denn da das Fenster? Es gibt keines. Wenn man eintritt, steht man bereits zwischen Bett und Tisch.
Am Ende des Spaziergangs durch den Bauch von Neapel (so heißt ein berühmtes Buch der schon zitierten Matilde Serao) erkennt man: Spaccanapoli ist gar nicht so sehr eine Zerteilerin, sondern hat etwas Verbindendes. Vom edlen Wohnviertel Vomero über eine gewöhnliche Nachbarschaftsgegend, durch die touristische Zone, weiter in ein schwieriges Viertel, gezeichnet von den Narben der Kriminalität.
Aber auch ganz normaler Alltag, wie am Anfang der Straße, wo wie hier auch wieder die Wäsche zum Trocknen von Haus zu Haus aufgespannt hängt. Statt Souvenirläden bieten hier die lokalen Minisupermärkte alles, was man so braucht. Jetzt etwa dringend Papiertaschentücher, um die vom Staub verklebte Nase zu reinigen. In der Auslage, zwischen Obststeigen und billigen Keksen, sind keine zu sehen, also drinnen nachgefragt. Die Verkäuferin zieht eine Packung hervor, also einen Zehnerpack. So viel wollte man nun eigentlich nicht. »Drei Euro«, sagt sie. »Woanders verkauft man Ihnen ein einzelnes Päckchen für einen Euro, jetzt nehmen Sie schon!« Wer wollte da widersprechen.
Das Ende von Spaccanapoli führt auf den Hauptbahnhof zu. Der ist, wie in vielen anderen Städten auch, das Viertel mit der am stärksten internationalen und multikulturellen Bevölkerung. Dazu später mehr.