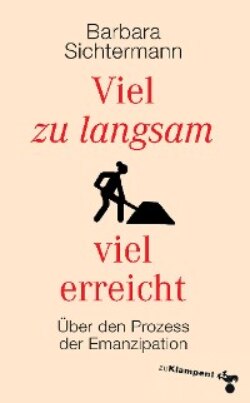Читать книгу Viel zu langsam viel erreicht - Ingo Rose, Barbara Sichtermann - Страница 5
Vorweg: Die Fragestellung
ОглавлениеMan möchte gerne drauflosleben. Man möchte einen Lebensweg finden und einschlagen, ohne lange über die Bedingungen der eigenen Möglichkeiten nachzudenken. Das Reflektieren stört eine Spontaneität, die mit der Vorstellung von Lebensfreude verbunden bleibt, auch wenn spontanes Handeln in Sackgassen und Kümmernisse führt. Ungute Erfahrungen sind es ja dann auch, die zum Reflektieren nötigen. Man möchte gerne einfach so da sein und sich behaupten und gar das Leben genießen, aber dieser Wunsch muss beständig kuschen, denn es gibt zu viele Bedingungen, die unsere Möglichkeiten definieren und beschränken und die wir deshalb verstehen müssen. Also beginnen wir, nolens volens, mit dem Nachdenken. Was ist unsere Stellung als Menschen im Kosmos? Was können wir in unserer unmittelbaren Wirklichkeit tun und gar ändern? Wo liegt unsere Freiheit, spontan zu handeln? Gibt es sie überhaupt? Wovon reden Frauen, wenn sie sagen, ihre Freiheit sei nicht verwirklicht, Gleichheit sei nicht garantiert? Und: Warum müssen sie das heute überhaupt noch sagen? Die letzten beiden Fragestellungen sind es, die uns im Folgenden beschäftigen.
Eins kann man inzwischen gut beobachten: Junge Frauen, die sich gegen Vorhalte und Forderungen älterer Frauen, doch entschiedener für die Gleichberechtigung einzutreten, wehren und sagen: Wir sind frei, wir können alles machen, lasst uns mit eurer Männerfeindschaft und eurem erledigten Feminismus in Ruhe, junge Frauen, die nicht kämpfen, sondern leben wollen, setzen auf die Möglichkeit, spontan in die Welt hinauszufahren, ohne ihre Möglichkeiten allzu genau auf verschlossene Zugänge hin abzuklopfen. Und das ist richtig so! Wäre es anders, hätten die Älteren, also die Generation, die in den 1970er Jahren die Emanzipation ausrief, gar nichts bewirkt. Es waren die Erfolge der Neuen Frauenbewegung, die den Töchtern und Enkelinnen der jetzt gealterten Emanzen das unablässige besorgte Reflektieren über die Bedingungen ihrer Möglichkeiten erspart haben – und genau das wollten sie ja auch erreichen: dass ihre Töchter unter verbesserten Bedingungen ins Leben starten, unter der Fahne der Gleichberechtigung, ohne täglich dafür streiten zu müssen. Die jungen Frauen akzeptieren es denn auch nicht, dass ihr Wunsch, ein Leben als freie Frauen spontan zu leben, kuschen soll, nur weil die älteren von ihnen verlangen, ihre Möglichkeiten zu bezweifeln, da angeblich die Bedingungen immer noch nicht stimmen. Gefühlt haben die jungen Frauen unendliche Möglichkeiten, und die wollen sie nutzen, ohne sich mit Grübeleien über die Bedingungen den Schneid abkaufen zu lassen. Manche erkennen dann in der Mitte ihres Lebens, dass bei den Bedingungen doch noch so manches fehlt, andere wieder resignieren und finden sich ab, Hauptsache, es bleibt ihnen ein Rest spontaner Lebensfreude – allzu genaues Nachdenken trägt für sie nicht dazu bei. Aber auch die Emanzengeneration, die um die Mitte des vorigen Jahrhunderts geboren wurde, wollte ursprünglich nur ihren Lebensweg gehen und dabei möglichst viel Freude haben. Sie fand jedoch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als viele Bedingungen vieler Möglichkeiten neu verhandelt wurden, dass ihre Wege zu kurz und zu starr vorgezeichnet waren. Sie rebellierte. Sie stürzte vieles um und entwarf manches neu, was im sozialen Zusammenlebens für unverrückbar gegolten hatte. Das war eine große Leistung und eine tolle Zeit.
Auf dem umgegrabenen sozialen Gelände laufen die alten und die jungen Frauengenerationen nun heute mit sehr viel höheren Freiheitsgraden umher. Dass die Bewegung aber weitergehen muss, dass die Möglichkeiten noch immer nicht den denkbar besten Bedingungen entsprechen – das wissen die älteren Frauen, das ahnen die jüngeren, und das bestreiten die ganz jungen, weil diese zwischen gefühlten Freiheitsgraden und objektiv gegebenen noch nicht unterscheiden können. Weil die erkämpften und jetzt gegebenen Grade eben schon vieles ermöglichen und noch mehr versprechen. Wenn die jetzige Alt-Emanzen-Generation sich ganz zurückgezogen hat oder ausgestorben ist, wird die nachfolgende Generation vor demselben Dilemma stehen. Sie wird sich darüber freuen, wie rücksichtslos und spontan die jüngste Frauengeneration ins Leben hinausfährt, wird stolz darauf sein, die Bedingungen dieser neuen Möglichkeiten mitgestaltet zu haben, und sich zugleich darum sorgen, dass die noch unerledigten Aspekte der Befreiung übersehen werden könnten, dass ein Rollback nicht ausgeschlossen und dass die Jugend blind sei gegenüber der Notwendigkeit, die Errungenschaften zu verteidigen, um sie zu sichern. Und so wird es womöglich weitergehen.
Wie kommt das? Warum ist nicht mal irgendwann wirklich alles gut? Warum erscheint der Zeitpunkt, an dem frau sich zurücklehnen kann und sagen: Die Arbeit ist getan, so fern? Warum können wir – in absehbarer Zeit – als Frauen nicht wirklich spontan drauflosleben, wissend, dass die Gleichberechtigung nun kein Thema mehr sein muss? Bleibt am Ende die vollendete Emanzipation ein Wunschtraum, weil sie, so wie sie jetzt gedacht wird, gar nicht umsetzbar, weil sie eine Illusion ist? Oder reicht es, wenn frau sich eingesteht, dass sie mit quasi unendlichen Zeiteinheiten zu rechnen hat? Vielleicht aber setzen wir auch nur die falschen Prioritäten … Eine solche Einsicht: Es kann ewig dauern, bis die Freiheit der Frauen verwirklicht ist, und eine solche Furcht: Es geht vielleicht einfach nicht mehr weiter oder sogar zurück, die Einsicht und die Furcht müssen Gründe haben, welche sich benennen lassen. Das versucht der folgende Essay.