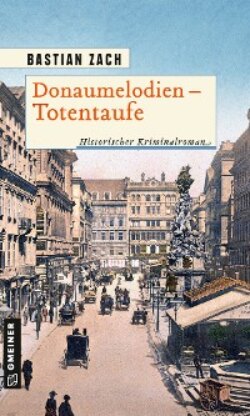Читать книгу Donaumelodien - Totentaufe - Bastian Zach - Страница 17
IX
ОглавлениеHieronymus lehnte an der Ecke eines Hauses und beobachtete ruhig das Getümmel, das ihn umgab. Der Schlickplatz war voll geschäftiger Menschen, die von hier zum Franz-Josefs-Bahnhof eilten oder in die andere Richtung, zum Schottenring, und sich den Platz mit Fuhrwerken und Karren teilten. Alles überragend war die Fassade der Roßauer Kaserne, ein festungsähnlicher Bau aus roten Ziegeln, der erst sechs Jahre zuvor fertiggestellt worden war. Die beiden Türme, die acht Stockwerke in den Himmel ragten und mit Zinnen bekrönt waren, ließen keinen Zweifel aufkommen, dass dies ein Bollwerk gegen jegliche Art von Feinden der Monarchie darstellte.
Doch wie an so vielen Tagen zuvor konnte Hieronymus auch heute nicht erspähen, was er dereinst zu erspähen geglaubt hatte – das liebliche Antlitz seiner Karolína. Jener großen Liebe, die er seit neun Jahren tot geglaubt hatte, und bei der er sich doch seit ihrem, wenn auch nur kurz erhaschten, Anblick sicher war, dass sie lebte.
Auch hatte er in den letzten Wochen versucht, ihren Bruder František Skorkovský aufzuspüren, dessen zufällige Bekanntschaft er auf der Soirée Ludwig Oppenheims gemacht hatte. Doch auch dieses Unterfangen hatte sich als erfolglos erwiesen. So konnte er nur hier stehen und hoffen.
»Ganz allein, mein Hübscher?«, umgarnte ihn eine weibliche Stimme.
Hieronymus spürte, wie eine Hand die seine sanft berührte. Gleich darauf sah er sich einer Frau gegenüber, die sein Alter haben musste, wenngleich er hoffte, nicht ein derart verlebtes Bild abzugeben. Ihre Schminke hatte sie viel zu stark aufgetragen, eine leicht verzweifelte Nuance umspielte ihr gekünsteltes Lächeln.
»Nein danke«, winkte Hieronymus ab.
Der Gemütszustand der Hübschlerin änderte sich schlagartig. »Du hast doch keinen Schimmer, was dir entgeht, du grober Lackel19.«
»Und ich will es auch nicht wissen.«
»Na, ich sag dir jetzt was: Du gibst mir zwei Gulden oder ich schrei hier vor allen Leuten, dass du mich begrapscht hast.«
Hieronymus spürte, wie der Zorn in ihm aufstieg, gepaart mit dem Verlangen, die dreiste Nymphe mit mehr als nur Worten zurechtzuweisen. Doch er beherrschte sich. Zu unvorhersehbar wären die Folgen einer solchen Auseinandersetzung.
»Hör gut zu«, sprach er so leise, dass sich die Frau zu ihm beugen musste. »Da drüben ist die k.k. Polizei-Direction, und ihr Präsident, Wilhelm Marx, ist ein Bekannter von mir. Wennst also meinst, du musst hier ein Bahöl machen, dann tu das. Gerne werde ich der Sicherheitswache erklären, wer hier wen abgetatschkerlt20 hat. Und jetzt schleich dich.«
Die Hübschlerin schien einen Augenblick abzuwägen, ob der andere es ernst meinte. Dann spuckte sie zu Boden und verschwand in der Menge der Passanten.
Während Hieronymus ihr noch nachblickte, wälzte er die Überlegung, warum er nicht tatsächlich beim Präsidenten der Polizei vorstellig werden sollte, um diesen zu bitten, ihm bei der Suche nach Karolínas Bruder behilflich zu sein. Immerhin könnte er ihm Einsicht in die Register der melderechtlichen Erfassung gewähren. Nicht, dass ihm dieser nach dem Vorfall im Prater noch etwas schuldig wäre, aber ein Versuch konnte wohl nicht schaden …
Franz fluchte leise. Die eiserne Tür am Kiosk, einem achteckigen mannshohen Turm mit schrägem Dach, war abgesperrt. Auch wenn ihn kaum einer der Passanten, die am Karlsplatz unterwegs waren, beachtete, so wusste er, dass er die Tür nicht einfach mit roher Gewalt aufreißen konnte. Mit der rechten Hand kramte er in der Tasche seines Mantels, bis er gefunden hatte, wonach er suchte – einen Dietrich.
Er setzte den Sperrhaken ins Schloss, drückte, zog und drehte nach Gefühl, bis das Schloss mit einem Klacken aufsprang.
»He, du da!«, ertönte plötzlich die Stimme eines Mannes. Franz fuhr herum, erblickte aber anstelle eines Wachmannes ein junges, teuer gekleidetes Pärchen. »Der Präuscher hat telegrafiert. Er will seinen Buckel zurück!«
Die Frau lachte spitz auf, der Mann grinste feist.
Franz winkte den beiden mit einem Lächeln zu, während er ihm Syphilis und ihr Torheit wünschte. Er blickte noch einmal schnell prüfend um sich, ob er nicht doch beobachtet wurde, und verschwand dann in dem Kiosk.
Die Finsternis, die Franz umgab, war beinahe stofflich. Nur langsam gewöhnten sich seine Augen an das spärliche Licht, das durch die Eisengitter fiel, die den Kiosk mit seinem Dach verbanden. Er erkannte, dass sich zu seinen Füßen eine Wendeltreppe in die rabenschwarze Tiefe schraubte, die noch undurchdringlicher zu sein schien. Franz rümpfte die Nase. Doch er wusste, dass die Luft von nun an nur noch muffiger werden würde, also sollte er sich besser daran gewöhnen.
Vorsichtig machte er den ersten Schritt in die Tiefe, dem ein metallisches Knarren folgte, das sich hallend im Abgrund verlor. Nach einem lang gezogenen Seufzen begann er seinen Abstieg.
Fünfzig Stufen hatte er bereits zurückgelegt, fünfzig weitere, so schätzte er, würden noch folgen. Der enge Schacht glich einem Rauchfang, an dessen Wänden Schmutz und Staub in Fetzen herabhingen, die sich bei der leisesten Bewegung zersetzten und Schneeflocken gleich in die Tiefe rieselten.
Ein letzter Schritt und Franz hatte die Sohle erreicht. Ein eigentümliches Säuseln empfing ihn, als wollte der Wind ihn warnen, aber darauf gab er nichts. Franz marschierte einen kurzen Stollen entlang, an dessen Ende ihm ein sturmgleicher Luftzug entgegenblies, dann betrat er ein monumentales, unterirdisches Bauwerk. So hoch in seiner Wölbung und so breit in seinem Ausmaß, dass man gut und gerne ein Haus hineinbauen konnte, weitete sich der Kanal, in dessen Mitte das schmale Rinnsal der Wien floss. Ein Narr, der den Fluss unterschätzte, dachte Franz, denn die teils meterhohen Mauern zu beiden Seiten waren nur dafür errichtet worden, dem Rinnsal Einhalt zu gebieten, wenn es anschwoll.
Überall an den Wänden sickerte Wasser nach unten, die Luft roch modrig feucht und gleichzeitig süßlich nach Dung.
Das fahle Licht gab nur gelegentliche Anhaltspunkte preis – Seitenstollen, die wegführten und wesentlich enger waren als der Hauptfluss, manche maßen gar nur einen Meter im Querschnitt. Da auch das Rauschen und Tropfen des Wassers keine Orientierung zuließ, beschloss Franz, einfach eine Richtung einzuschlagen und dieser dann zu folgen.
»Ich werd Ihr Anliegen selbstverfreilich an unseren Präsidenten weiterleiten lassen«, meinte der aufgedunsene Mann im dunkelgrünen Waffenrock der Sicherheitswache am Eingang zur Polizei-Direction, nicht ohne durchklingen zu lassen, für wie lästig er das Gesuch erachtete. »Kommen S’ morgen wieder, dann kann ich Ihnen sagen, ob er Sie ebenso dringlich sehen will wie Sie ihn.«
Hieronymus seufzte frustriert. Aber mehr konnte er im Augenblick nicht ausrichten. »Holstein«, wiederholte er seinen Namen. »Hieronymus Holstein.«
Die Wache tippte sich auf den Kopf. »Ist notiert. Wiederschaun.«
Der Bittsteller ließ das imposante vierstöckige Gebäude hinter sich. Die Hübschlerin hatte ihn nämlich nicht nur auf die Idee gebracht, hierherzukommen, sondern auch noch jemand anders aufzusuchen. So machte er sich auf den Weg in die Singer-Straße, wo er bei seiner Suche an einen anderen Punkt anzuknüpfen hoffte.
Nach einer Weile, in der sich seine Augen weiter an das wenige Licht, das einfiel, gewöhnt hatten, erspähte Franz endlich eine andere menschliche Seele. Der Strotter hatte neben sich einen Korb aus Weidengeflecht stehen und in der Hand einen hölzernen Stab, an dem er ein kleines metallenes Sieb befestigt hatte. Damit fischte er im Rinnsal der Wien nach allem, was diese mit sich führte.
»Grüß Gott«, sprach Franz schon von Weitem, um nicht den Anschein zu erwecken, er wollte sich anschleichen.
Der Mann war von hagerer Statur, eine Nase dominierte sein Gesicht, die im Verhältnis zum Rest viel zu groß erschien. Es kleidete ihn ein vielfach geflickter Gehrock, dessen Schöße speckig und abgegriffen wirkten, und eine fettige Krawatte, die lose um den dürren Hals hing. Seine großen braunen Augen, die ihm aus dem Gesicht hervortraten, waren mit einem leichten Schleier überzogen.
»D’Ehre«, grüßte er zurück.
»Bin der bucklige Franz.«
»Camillo Cavalieri. Aber hier unten nennen mich alle Don Cavallo, wohl wegen meines edel lang gezogenen Gesichts.«
»Schmeichelhaft«, entgegnete Franz. »Dann werde ich wohl Gobba heißen.«
»Ah, parli italiano?«
»Solo un pocco«, untertrieb Franz und blickte auf den Kescher. »Wonach fischst du?«
»Was glaubst du denn? Als Banerstrotter natürlich nach Gebeinen und was mir sonst so ins Netz geht.«
Franz wischte sich die Schweißperlen vom kahlen Haupt, die sich jedoch ob der Luftfeuchtigkeit beinahe augenblicklich wieder erneuerten. »Knochen für die Seifensiedereien?«
»Sternkreuzdiwidomini!«, brüllte Camillo mit einem Male und ohne ersichtlichen Grund. Dann fuhr er in gemäßigtem Tonfall fort: »Nicht ganz zwei Kreuzer bezahlen sie für das Kilo. Allerdings musst du die Gebeine vorher noch trocknen.«
Franz machte erst gar nicht den Versuch zu errechnen, wie viele Kilo er am Tag zusammensammeln und nach Atzgersdorf schleppen müsste, um davon leben zu können.
»Der Kreislauf des Lebens, eben«, fuhr Camillo in beinahe dozierendem Tonfall fort und holte tief Luft. »Der Bürger frisst das Tier, wirft dessen Knochen unachtsam fort, damit einer wie ich sie aufsammeln darf und ein Fabrikant sich damit eine goldene Nase verdient, indem er Seife herstellt, mit der sich besagter Bürger die vom Essen fettigen Hände waschen kann. Der Herrgott hat eben für alles gesorgt! Leben und sterben lassen.«
Franz verkniff sich eine Entgegnung, denn er verstand die Verbitterung des Mannes.
»Aber verstehe mich nicht falsch«, wiegelte Camillo sogleich ab. »Ich bin keineswegs unzufrieden, im Gegenteil. Schau dich doch um. Niemand, der mich anherrscht, niemand, der mir Schmähungen entgegenschleudert. Ich bin mein eigener Herr und Meister und –« Ein Hustenanfall unterbrach seine Ausführungen.
»Sei versichert, ich bin nicht hier, um dir deinen Platz streitig zu machen. Ich bin auf der Suche nach jemandem.«
»Auf der Suche?«, wiederholte Camillo, nachdem er sich gefangen hatte. »Ich fürchte, da bist du bei uns Strottern falsch. Hier unten will keiner gesucht, geschweige denn gefunden werden.«
»Kein Haar will ich demjenigen krümmen, nach dem ich suche. Oder besser gesagt: nach dem sein Weib mich suchen lässt.«
Camillo lachte auf, dass es nur so hallte. »Ich kann mir wahrlich angenehmere Verstecke vor einem Weib vorstellen als hier unten. Im Schoß einer anderen, als Beispiel. Aber jeder, wie er will.«
»Leoš Svoboda heißt der, den ich suche.«
Der andere schüttelte den Kopf. Er überlegte, dann schien er einen Entschluss gefasst zu haben. »Also gut, wie heißt es so trefflich? In der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot.«
»Ich glaube zu wissen, dass es heißt: In der Not schmeckt jedes Brot.«
»Papperlapapp«, insistierte Camillo. »Was ich damit sagen will, ist, ich werde dir helfen. Du kannst mit mir mitkommen, womöglich kennt ja der eine oder andere den, den du suchst.«
Der Strotter hob die Bütte, die er handhoch mit Tierknochen, an denen aufgeweichtes Papier und Fettklumpen hingen, gefüllt hatte, und wies mit dem Kescher den Weg in Richtung eines engen Rohres.
»Hier entlang, buckliger Franz. Und lass Vorsicht walten. Selbst einer wie du muss hier unten zuweilen den Kopf einziehen.«
Franz nickte dankend und folgte dem Strotter in die Dunkelheit der Unterwelt.
Zwei Uhr Nachmittag.
Hieronymus steckte die Taschenuhr zurück in seine Weste. Eigentlich sollte dies die geeignete Zeit sein, dass die Frau sich bereits von den Strapazen der vorangegangenen Nacht erholt hatte, aber noch nicht zu neuem Schaffen aufgebrochen war. Er griff den ehernen Ring, der im Maul eines Löwen hing, und pochte damit dreimal gegen die Tür.
Nichts.
Er wiederholte das Signal. Nun hörte er, wie ein kleines Kind auf der anderen Seite der Tür zu weinen begann.
Schritte eilten herbei.
Die Tür wurde entriegelt … und geöffnet.
Die Frau, die durch den Türspalt lugte, runzelte ungläubig die Stirn. »Hieronymus Holstein?«
»Elsbeth Fränkel«, entgegnete dieser mit einem Lächeln ob der gegenseitigen Bekanntgabe ihrer Namen.
Die blond gelockten Haare völlig zerzaust und nur in ein einfaches helles Leinenkleid gehüllt, öffnete die Frau die große Flügeltür gerade weit genug, damit er eintreten konnte. Dennoch stellte sie sich mitten in den Weg.
»Was in aller Welt wollen S’ von mir?«
»Ich freue mich auch, Sie zu sehen. Darf ich?«
Elsbeth prüfte mit schnellem Blick, ob sich außer Hieronymus noch andere Personen im Flur befanden. Dann winkte sie ihn unwillig herein.
»Das Peterchen haben S’ auch aufgeweckt«, zischte sie und eilte zu dem Kleinkind, das in eine wollene Decke gewickelt auf einem Sessel lag. Liebevoll nahm sie es in den Arm und wiegte es.
Hieronymus schloss die Tür. »Ich wollte Ihnen kein Ungemach verursachen, Frau Fränkel«, sagte er und meinte es auch so.
»Das wollten S’ das letzte Mal auch nicht, und schauen S’ mich an. Der Wilhelm hat sich seither nicht mehr blicken lassen. Oppenheim hat sich in seiner Zelle erhängt, der wird also in naher Zukunft auch keine Gesellschaften mehr veranstalten. Frau Barbara musste ich auf zwei Tage die Woche beschränken, an denen ich schauen muss, wie ich das Geld für die restliche Woche aufstelle. Erzählen S’ mir also bitte nichts von dem, was Sie wollen, wenn sich doch alles zum Argen wandelt.«
Kraftlos setzte sie sich auf den Sessel, wischte sich trotzig die Tränen aus den Augen. Sie wirkte übermüdet, die üppigen Lippen rau, die unzähligen Sommersprossen auf Gesicht und Hals stumpf.
Hieronymus seufzte. Natürlich tat ihm die Frau leid, war er es doch gewesen, der sie erpresst hatte. Der sie erpressen musste, um seine eigene Haut zu retten. Dass sie dabei Schaden nehmen würde, hatte er zwar vermutet, aber hintangestellt.
»Umso anmaßender klingt dann wohl der Grund meines Besuchs«, sagte er und setzte sich ihr gegenüber.
»Ich vermute, Sie brauchen etwas von mir?«
»So ist es, Frau Fränkel.«
»Werde ich danach noch tiefer fallen? Mich gar am Graben oder am Spittelberg feilbieten müssen?«
Hieronymus konnte ein Schmunzeln ob der Offenheit der Frau nicht zurückhalten. »Das müssen Sie mit Sicherheit nicht, mein Wort darauf.«
Elsbeth schnaubte verächtlich.
»Gerne werde ich Ihnen berichten, wie es dazu kam, dass es mich nach Wien verschlagen hat. Das Ausmaß meines Schmerzes, meiner Pein, die mich seit neun Jahren malträtiert.« Er hielt seine rechte Hand in die Höhe, an der der kleine Finger fehlte. »Und ich spreche nicht hiervon. Aber ich vermute, dass Sie das im Augenblick nicht wirklich interessiert.«
»Da haben S’ recht, tut es nicht«, sagte sie knapp und hart. Dann wurde ihre Stimme sanft. »Und doch freue ich mich, dass Sie es geschafft haben, Ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Auch wenn dies gewissermaßen mein Verdienst war.«
»Da haben Sie recht, das war es.«
Elsbeth seufzte schwer. »Dann rücken S’ schon heraus damit. Was brauchen S’ diesmal?«
»An jenem Abend bei Oppenheims Soirée«, begann Hieronymus, »da tummelte sich eine illustre Schar an Gästen im Palais Rasumofsky.«
»Alles Herren der besseren Gesellschaft, die meinen –«, Elsbeth legte beide Hände auf die Ohren des nun schlafenden Kindes, »dass ihre Libido so groß und ihre Schwänze so hart sind wie ihre Bankkonten prall gefüllt. Was natürlich reines Wunschdenken ist.«
Hieronymus und Elsbeth teilten ein Lächeln.
»Sie verstehen es wahrlich, einem Mann den Kopf zu verdrehen«, meinte er und wurde wieder ernst. »Einer der Gäste war ein Böhme namens František Skorkovský. Er hat etwa mein Alter, rötliche Haare, groß gewachsen. Ein zackiger Mann, spricht mit kaum hörbarem Akzent.«
Elsbeths Blick wanderte im Raum umher, immer wieder verengten sich ihre Augen zu Schlitzen. »František … František Skorkovský.« Schließlich schüttelte sie den Kopf. »Der Name ist mir nicht geläufig. Ich kann mich nicht einmal an einen Herrn mit rötlichen Haaren erinnern.« Als sie Hieronymus’ Enttäuschung sah, fügte sie hinzu: »Aber seien Sie versichert, dass es mir aufrichtig leidtut.«
»Schon gut, es war einen Versuch wert«, meinte dieser mit gedämpfter Stimme. »Wie geht es dem kleinen Peterchen?«
Elsbeth hob die Decke vom Gesicht des Buben in ihren Armen. »Schauen S’ selbst. Er wächst so schnell, dass ich ihm dabei zuschauen könnt. Und jeden Tag schaut er seinem Vater ähnlicher, finden S’ nicht?«
Hieronymus schmunzelte ob der Anspielung auf Wilhelm Marx, Präsident der Wiener Polizei, einem glücklich verheirateten Mann mit einem außerehelichen Kind. Er selbst jedoch hatte, wie versprochen, dieses Geheimnis bewahrt, war es doch weder die Ausnahme noch eine Seltenheit. Beinahe jeder Dorfpfaffe könnte davon ein Liedchen singen, das wusste er.
»Ja, ganz der Herr Papa«, stimmte er der Mutter zu. »Apropos, ich werde wohl morgen bei besagtem Papa bezüglich meiner Suche nach diesem František vorstellig. Ich vermeine, es könnte nicht schaden, ihn darauf hinzuweisen, dass er sich ein wenig mehr um seinen Sohn bemühen sollte. Wenn schon nicht persönlich, so zumindest pekuniär?«
Elsbeth lächelte gütig, so wie Hieronymus sie zum ersten Mal getroffen hatte, damals im Café Central. »Das wäre eine schöne Geste von Ihnen.« Sie schien noch etwas hinzufügen zu wollen, besann sich dann jedoch anders und schwieg.
Hieronymus stand auf. »Dann auf bald, Frau Fränkel.«
Sie begleitete ihn zur Wohnungstür. »Ja, auf bald.« Dann gab sie ihm einen flüchtigen Kuss auf die Wange. »Und danke.«
Nachdem Franz und Camillo über drei Griasler, wie man Obdachlose hier nannte, geklettert waren, die eng aneinandergekauert auf einem groben Steinhaufen schliefen, waren sie in einen Stollen gekrochen, gerade groß genug, dass man die fünfzig Meter Länge auf allen vieren überwinden konnte.
Camillo hielt vor sich eine kleine Öllampe, die bei jeder Bewegung einen Schwall an Ruß ausstieß, wie eine Dampflokomotive, die anfuhr.
Daraufhin gelangten sie in einen Raum, aus Ziegeln gemauert, in dem zwar die Luft feuchtschwül drückte, der aber ansonsten einen reinlichen Eindruck machte.
»Ist die Küche«, erklärte Camillo, mit einem Stolz in der Stimme, als würde er durch Wiens Sehenswürdigkeiten führen. »Hier drin haben die Arbeiter, die den Kanal einst erbauten, ihre Mahlzeiten gekocht. Ist ein begehrter Schlafplatz, aber auch eine wahre Todesfalle. Denn bei Überschwemmung sammelt sich das Wasser hier drin bis zur Decke, bevor es in die Wien abfließen kann.«
Im angrenzenden Stollen, der nur marginal breiter war, mussten Franz und Camillo einen Schlafenden überklettern, der so tief schlummerte, als wäre er bereits tot.
Ein weiterer Raum, nur halb so hoch wie ein Mann, verschaffte den gebeugten Rücken der beiden Männer ein wenig Erholung, bevor es einen Schlauch zu durchklettern hieß. Einhundert Meter lang, leicht aufsteigend und nur passierbar, indem man auf dem Bauch vorwärtsrobbte.
Drei Pausen später, völlig außer Atem und in Schweiß gebadet hatte Franz Camillo schließlich eingeholt, der sich bereits den Rücken im nächsten Raum durchstreckte. »Der Schlauch geht uns allen am Arsch«, kommentierte er den Weg. »Aber was willst machen? Die Bauherren haben sicherlich nicht ins Kalkül mit einbezogen, dass hier einmal Menschen hindurch sollten.«
Franz war, als wäre er erneut von einem Fuhrwerk überrollt worden. Schulterblätter, Ellbogen und Hüfte schmerzten kolossal. Und der Schädel brummte ihm, als hätte er die Nacht durchgetschechert, was zwar stimmte, seinen Zustand schrieb er aber dennoch der schlechten Luft zu.
»Ab nun wird es einigermaßen erträglich, zumindest, was die Höhe betrifft«, sagte Camillo und deutete auf eine türähnliche Öffnung in der gegenüberliegenden Mauer. Diese war mit dem Ort, an dem sie standen, nur durch ein schmales Brett verbunden, unter dem es mehrere Meter in die Tiefe ging.
»Jetzt stehen wir genau unter dem Schwarzenbergplatz. Und dort drüben liegt die Zwingburg. Wer länger hier unten haust, erschläft sich irgendwann das Recht auf einen Platz da drin. Ist sicher hier. Denn wenn man das Brett wegzieht, dann können einem nicht einmal die Kieberer auf den Pelz rücken.«
Camillo überquerte das schwankende Brett wieselflink, Franz mit der Bedächtigkeit eines Ochsen, der über eine Stange balanciert.
Hinter einem alten Kotzen, der als Vorhang diente, öffnete sich ein weitläufiger Raum, der voller Menschen war, hauptsächlich Männer jeden Alters. Sie schliefen dicht aneinandergedrängt, damit die Wärme der Leiber nicht unnötig in die Luft entwich, saßen rauchend zusammen oder starrten stumm auf das Gewölbe über ihnen, oftmals eine Flasche in der Hand.
Wellen furchtbarer Ausdünstungen schlugen Franz ins Gesicht, vermischt mit dem Geruch von Rauch und Moder. Er musste sich beherrschen, sich nicht zu übergeben, machte nur kleine Atemzüge, wie ein Fisch, der an Land gestrandet lag.
Mehrere Röhren führten von hier wieder weg, und in kleinen Mauernischen, über die mit Kreide verschiedene Initialen geschrieben standen, horteten die Strotter ihre Beute.
Diebstahl musste man hier wohl nicht fürchten, dachte sich Franz ein wenig überrascht.
»Was für einen Krüppel zahst denn da an, Don Cavallo?« Ein alter Mann mit eingefallenem, ledrigem Gesicht und kehliger Stimme, der auf einer zerschlissenen Filzdecke hockte, blickte zu den beiden Männern auf.
»Reg dich ab, Gurginger«, entgegnete Camillo, »der bleibt eh nicht lang bei uns.«
Franz griff in eine Manteltasche und holte eine der Zigaretten hervor, von denen er wohlweislich im Vorfeld einige erstanden hatte. »Bin der bucklige Franz. Willst eine Tschick21?«
Die stumpfen Augen des Alten blitzten für einen Moment auf, mit überraschend flinkem Griff schnappte er sich die Rauchware. »Ach was, du bist schon recht. Bin ein alter Stänkerer, war nicht so gemeint.«
Franz nickte ihm zu, sah dann ernst Camillo an. »Wen soll ich hier unten fragen?«
Der tätschelte ihm mit seiner vor Schmutz starrenden Hand die Schulter.
»Sternkreuzdiwidomini! Hör zu, mein Freund, so schnell geht das hier bei uns Schrobs nicht. Gut Ding braucht Eile mit Weile. Komm, wir setzen uns zu meinem Lager und du erzählst mir ein wenig von der Oberwelt und wie sie so geworden ist, seit ich sie verstoßen habe. Und wennst noch die eine oder andere Tschick hast, dann kann’s auch nicht schaden.«
19 Großer, ungeschlachter Mann.
20 Begrapscht.
21 Wienerisch: Zigarette.