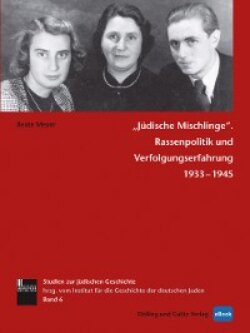Читать книгу »Jüdische Mischlinge« - Beate Meyer - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеErster Teil
Die Verfolgung der Mischehen im Nationalsozialismus
I. Das Ende des Integrationsprozesses
1. Die quantitative Entwicklung der Mischehen
Das im September 1935 erlassene Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre zog mit dem Eheverbot zwischen Juden und „Deutschblütigen“ einen Schlußstrich unter eine fast 100 Jahre anhaltende Entwicklung. Die Zahl der Mischehen war Indikator für den Assimilationsprozeß,1 den die deutschen Juden vollzogen hatten. Dieser wird auch als extremer Modernisierungsschub interpretiert, den die jüdische Gesellschaft im Zuge ihrer Verbürgerlichung erfuhr.2 Andere äußerliche Kennzeichen dieses Prozesses waren die angestiegenen Zahlen der Taufen oder die Änderungen jüdischer Familiennamen, um der „stigmatisierenden Kraft des Namens“ (Bering) bei der Integration in die Mehrheitsgesellschaft zu entkommen.3
Im Februar 1849 war den Hamburger Juden erstmals gestattet worden, interkonfessionelle Mischehen einzugehen, wenn der jüdische Mann das Bürgerrecht erworben hatte.4 Zu dieser Zeit lebten in Hamburg ca. 10.000 Juden bei einer Gesamtbevölkerung von 150.000 Personen.5 1861 bzw. 1865 wurden dann die gesetzlichen Grundlagen geschaffen, die uneingeschränkt Zivilehen zuließen.6 Preußen zog 1874 nach. Doch erst im 20. Jahrhundert wuchs die Zahl der Mischehen – gemessen an den Eheschließungen der Juden – im Deutschen Reich so rapide, daß die jüdischen Gemeinden diese Entwicklung als „immer unheilvoller“ empfanden, da sie nicht nur gegenwärtige, sondern – mit dem meist getauften Nachwuchs – auch zukünftige Mitglieder verloren.7 Die Zahl der Mischehen stieg in Deutschland zwischen 1901 und 1910 auf 8.225, bis 1924 dann auf 20.266 an. Zu dieser Zeit verzeichnete (Groß)-Berlin mit 3.215 die meisten Mischehen, gefolgt von Hamburg mit 1.407 und Frankfurt a.M. mit 922.8 Prozentual erhöhte sich in Hamburg der Anteil gar bis auf 57,6% der Eheschließungen von Juden und sank 1934 trotz restriktiver Maßnahmen der Standesämter nur auf 32%, während er im Reichsdurchschnitt 1934 15% betrug.9
Jüdische Männer heirateten eher nichtjüdische Frauen als Jüdinnen nichtjüdische Männer, alteingesessene Hamburger Juden gingen häufiger Mischehen ein als religiös stärker gebundene Ostjuden.10 Heiratete eine Jüdin einen Nichtjuden, verlor sie bei dieser Eheschließung prinzipiell ihre Gemeindeangehörigkeit, eine Regelung, die für jüdische Männer nicht galt.11 Lediglich die Kultusverbände legten hier zum Teil strenge Maßstäbe an:12 So schloß der orthodoxe Synagogenverband auch den jüdischen Mann wegen einer Mischehe aus, während der gemäßigte Tempelverband sowie die Neue Dammtor-Synagoge eine solche Heirat akzeptierten. Ein kleinerer Teil nichtjüdischer Ehefrauen trat zum Judentum über.13 In der Regel aber behielten die nichtjüdischen Partner ihre Religionszugehörigkeit. Ina Lorenz weist in diesem Zusammenhang auf die zunehmende Entkonfessionalisierung hin, die eine wichtige Voraussetzung für die großstädtische Mischehe war.14 Trat der jüdische Partner zur christlichen Glaubensgemeinschaft über, wurde er in Hamburg in der Regel Mitglied der evangelischen Kirche.15Der aufkommende Nationalsozialismus verstärkte die Tendenz bei jüdischen Dissidenten, die christliche Taufe in der Hoffnung auf Schutz vollziehen zu lassen. So stieg die Anzahl der „Proselytentaufen“ in den Hauptwohngegenden der Hamburger Juden im Jahr 1933 sprunghaft an.16 Die nach nationalsozialistischer Definition in Mischehe lebenden Juden stuften sich bezogen auf ihren Glauben also selbst höchst unterschiedlich ein.
In der jüdischen Gemeinde wurde 1940/41 – aufgrund der finanziellen Not – die Diskussion geführt, ob die in Mischehe lebenden Jüdinnen nicht als Mitglied betrachtet werden könnten, was in mehrfacher Hinsicht Probleme aufwarf. Zum einen konnten religiöse Grundsätze nicht ohne weiteres dispensiert werden, zum anderen zeitigten Versuche, diese Frauen zur Beitragszahlung heranzuziehen, kaum praktische Erfolge. Der Religionsverband beschloß deshalb, den „Frieden in den Mischehen“ nicht zu stören, zumal diese Familien ohnehin oft in bescheidensten Verhältnissen lebten. Aber auch in vermögenderen Familien konnte die Ehefrau kaum belangt werden – und der nichtjüdische Ehemann eignete sich nicht als Schuldner.17 So sah die jüdische Gemeinschaft diese Frauen weiterhin als Nichtjüdinnen an, während sie von den Nationalsozialisten als Jüdinnen behandelt wurden.
Gegenüber anderen Ehen waren Mischehen auffällig kinderarm, 30% sogar kinderlos. Waren Töchter oder Söhne vorhanden, wurden sie meist nicht jüdisch erzogen, wobei gerade die in den 1920er Jahren Geborenen oft später selbst die Religionszugehörigkeit wählen sollten.
Insgesamt wurden im Deutschen Reich etwa 120.000 Mischeheschließungen im 19. und 20. Jahrhundert registriert, davon rund 53.000 zwischen 1875 und 1932.18 Die reichsweite Zahl der Mischehen am Vorabend der nationalsozialistischen Machtübernahme wird auf 35.000 geschätzt.19 Diese Zahlen berücksichtigten nur Eheschließungen, wenn ein Partner bei der Heirat noch einer jüdischen Gemeinde angehörte. Waren sie oder er zuvor ausgetreten oder hatten sich taufen lassen, zählte die Ehe – im Unterschied zur späteren nationalsozialistischen Definition – nicht als Mischehe. Die Volkszählung von 1939 – nun erstmals nach NS-Definition – ergab, daß 56.327 „volljüdische“ Ehepaare und 20.454 Mischehen im Deutschen Reich lebten.20 In den sechs Jahren nationalsozialistischer Herrschaft hatte also bereits ein beträchtlicher Teil der Mischehepaare das Land verlassen. Im Dezember 1942 gab es 16.760 Mischehen, im April 1943 – nahezu unverändert – 16.658, im September 1944 nur noch 12.487 Mischehen.21 Diese Differenz ist zum einen auf das rigidere Vorgehen der Gestapo gegen jüdische Partner aus aufgelösten Mischehen zurückzuführen, zum anderen auf Verhaftungsaktionen gegen kleinere Gruppen und Kriminalisierungen von Einzelpersonen, die ebenfalls die Deportation der Betroffenen zur Folge hatten.
Die Ergebnisse der Volkszählung von 1939 veranlaßten die Statistiker zu der Feststellung, in Hamburg hätten sich die Juden weit stärker mit der übrigen Bevölkerung vermischt als in anderen Großstädten oder Teilen des Reiches.22 Leo Lippmann, Vorstandsmitglied des „Jüdischen Religionsverbandes Hamburg“, gab für 1940 die Zahl von 972 Mischehen23 an, bei denen in 623 Fällen der Ehemann und in 349 die Ehefrau jüdischer Herkunft waren. Für November 1941 führte er 1.036 Mischehen und 198 Juden aus aufgelösten Mischehen mit Kindern auf.24 Am Stichtag 31. Oktober 1941 waren es 1.290 Personen, 699 Männer und 591 Frauen, die in Hamburg in Mischehen lebten oder gelebt hatten.25 Zu diesem Zeitpunkt war die Emigration nicht mehr möglich, und Mischehepaare aus dem Umland waren vor den antisemitischen Anfeindungen in die Großstadt gezogen. Deshalb stieg die Zahl der Mischehen in Hamburg. Ende 1942 war bereits ein Teil der Jüdinnen und Juden aus aufgelösten „nichtprivilegierten“ Mischehen deportiert worden, die Zahl der in Hamburg verbliebenen wurde mit 1.262 angegeben, davon 1.032 in „privilegierten“ und 230 in „nichtprivilegierten“ Mischehen.26 Von nun an sank die Zahl wegen der Deportationen der jüdischen Personen aus aufgelösten und schließlich auch der aus noch bestehenden Mischehen auf 650 im Mai 1945: „Es lebten zur Zeit der Okkupation der Stadt durch die britische Armee noch etwa 650 Juden, die alle jüdische Teile von Mischehen waren.“27 So hatte von den in Hamburg in Mischehen verheirateten Juden – „natürliche“ Todesfälle nicht berücksichtigt – ungefähr die Hälfte überlebt.
2. Mischehen aus nationalsozialistischer Perspektive
Die Nationalsozialisten bezeichneten Lebensgemeinschaften als Mischehen, wenn ein Partner nach ihrer „rassischen“ Definition Jude war. Damit gaben sie dem Begriff der Mischehe, der vor 1933 zur Bezeichnung interkonfessioneller Ehen gebräuchlich war, eine neue Definition. Als Folge entstanden immer wieder Unklarheiten, weil die Kirchen am alten Gebrauch festhielten, im Behördenverkehr aber „die Ehe zwischen Personen, die verschiedenen Rassen angehören“ als „gemischte Ehen“ oder „Mischehen“ im Unterschied zu „konfessionsverschiedenen“ oder „religionsverschiedenen“ bezeichnet werden sollte.28 Die katholische Kirche wies angesichts dieser Begriffsverwendungen frühzeitig darauf hin, daß sie bei glaubensgleichen Ehen die „Rassenverschiedenheit“ niemals als indispensables Ehehindernis anerkennen würde.29
Aus nationalsozialistischer Perspektive waren sowohl die getauften Juden als auch die in Mischehen lebenden Ehepartner jüdischer Herkunft in den deutschen „Volkskörper“ eingesickert und ihre Kinder zum personifizierten Ausdruck der gefürchteten „Blutsmischung“ geworden, die – wenn irgend möglich – aufgespürt, rückgängig gemacht und für die Zukunft unterbunden werden sollte. Bereits in den 1920er Jahren unterbreiteten (nicht nur) spätere nationalsozialistische Amtsinhaber wie beispielsweise der Bevölkerungsexperte und Rassenhygieniker Arthur Gütt Vorschläge in diesem Sinne. Als die NSDAP im Reichstag vertreten war, brachte ihre Fraktion unter Federführung des späteren Reichsinnenministers Frick einen Gesetzesentwurf ein, der für die „Vermischung“ mit Farbigen und Juden den Straftatbestand des „Rassenverrats“ vorsah.30 Das katholische Votum gegen die Auflösung der Ehen, an denen getaufte Juden beteiligt waren, stellte jedoch die Weichen, in der künftigen Gesetzgebung Ehen nicht rückwirkend für ungültig zu erklären, aber für die Zukunft zu verbieten.
Die Nürnberger Gesetze von 1935, deren Entstehungsprozeß der Rassereferent im Reichsinnenministerium, Bernhard Lösener, als überstürzt und mit offenem Ausgang beschreibt,31 hatten von diesem Traditionsstrang her gesehen eine lange Vorgeschichte. Auch war in der Zeitspanne zwischen der nationalsozialistischen Machtübernahme und dem Parteitag eine Verwaltung und Justiz irritierende Rechtsunsicherheit herbeigeführt worden.32 Das Innenministerium bereitete seit Juli 1935 einen entsprechenden Gesetzentwurf vor. Da aber die verschiedenen beteiligten Stellen keine Einigung über die Einbeziehung der Ehen von „Mischlingen“ erzielten, zogen sich die Beratungen in die Länge: Der Stellvertreter des Führers (StdF) und der Reichsärzteführer als Sprachrohre der NSDAP forderten, einen weitestmöglichen Personenkreis zu erfassen, bestehende Mischehen aufzulösen oder deren „arische“ Teile den Juden gleichzustellen, während die Ministerialbürokratie des Innenministeriums bestrebt war, die neuen Regelungen auf „Volljuden“ zu begrenzen.33 Der hier (nicht erstmalig) aufgebrochene und mit den Ausführungsverordnungen zu den „Nürnberger Gesetzen“ nur zu einem vorläufigen Abschluß gekommene Konflikt erfuhr bis zum Ende nationalsozialistischer Herrschaft immer wieder Neuauflagen in wechselnden Konstellationen. Repräsentanten der NSDAP, insbesondere der StdF, die Rassenhygieniker sowie SS und Gestapo forderten die Einbeziehung der „Halb-“, „Viertel-“ oder gar „Achteljuden“ in antijüdische Maßnahmen, die Todesstrafe für „Rassenschänder“ sowie Zwangsscheidungen aller „Rassenmischehen“, während vor allem das Innenministerium mit wechselnder Unterstützung auf klarer Begrenzung und definierbarem und überschaubarem Personenkreis beharrte.
Der nationalsozialistische Gesetzgeber ging davon aus, daß die Judenemanzipation mit der napoleonischen Besetzung Deutschlands um 1800 begonnen hatte und damit dieser Zeitpunkt auch als Anfangsdatum der „Rassenmischung“ gelten konnte.34 Deshalb mußten NSDAP-Mitglieder die Ahnenforschung bis zum Jahr 1800 zurück betreiben. Für die radikalen Verfechter der „Rassenhygiene“ bedeutete jeder Jude in der Ahnenreihe ein bleibendes Verderbnis des „deutschen Blutes“. So formulierte beispielsweise der „Sachverständige für Rasseforschung im Reichsinnenministerium“, Achim Gercke, im Jahre 1933:
„Allen Erbgesetzen würde es widersprechen, wollte man unbedenklich jüdische Beimischung in zweiter, dritter oder vierter zurückliegender Geschlechterfolge als nicht vorhanden oder ohne Bedeutung ansehen. Die Erfahrung sagt vielmehr, daß keine Zahl von Geschlechterfolgen angegeben werden kann, die notwendig ist, um den Einfluß der stattgehabten Mischung ausgeschaltet zu wissen.“35
Aus dieser Sicht mußten aus dem „deutschen Volkskörper“ alle ausscheiden, die irgendwann einen jüdischen Vorfahren gehabt hatten. Da die meisten Mischehefamilien der Mittelschicht, etliche auch der Oberschicht angehörten und teilweise über weitverzweigte Verwandtschaften bis in wirtschaftliche oder militärische Eliten hinein verfügten, sahen sich die Nationalsozialisten allerdings zu innenpolitischen Rücksichtnahmen gezwungen.
Besonders Rassenhygieniker beschäftigten sich mit der Frage, welche Motivation eigentlich diesen Eheschließungen zugrunde lag und welche erbbiologischen Auswirkungen die „Blutsmischung“ hätte. Otmar Freiherr von Verschuer:
„Was für Menschen waren es auf deutscher wie auf jüdischer Seite, die Mischehen geschlossen haben? Kann das Erbgut dieser Menschen etwa aus ihrem eigenen Leben und aus dem ihrer Eltern und anderen Familienangehörigen erschlossen werden? Welche Eigenschaften zeigen sich bei den Kindern und Enkeln dieser Mischlinge? Worin unterscheiden sich diese Eigenschaften von denjenigen der deutschen Familien auf der einen Seite und der jüdischen Familien auf der anderen Seite, die sich miteinander gekreuzt haben?“36
Von Verschuer plädierte dafür, diesen 1937 noch immer unbeantworteten Fragen gründlich nachzugehen und aus den Ergebnissen allgemeine Regeln für die Judenpolitik abzuleiten. Drei Jahre später legte der „Sozialbiologe“ Alexander Paul die geforderte Studie vor. Er hatte Material ausgewertet, das ihm das Innenministerium zur Verfügung gestellt hatte. Dabei handelte es sich vermutlich um Anlagen zu den Anträgen auf Ehegenehmigung von „jüdischen Mischlingen“.37 Bezogen auf die Mischehen ging er folgenden Leitfragen nach: „Welcher Art waren die Juden und die Jüdinnen, die eheliche oder außereheliche Beziehungen zum deutschen Volk suchten? Welcher Art waren diejenigen Deutschen, die sich ehelich oder außerehelich mit jüdischen Menschen verbanden?“38
Paul untersuchte zum einen die Schichtzugehörigkeit der jüdischen und nichtjüdischen Elternteile sowie – mit den fragwürdigen Kriterien der Erbgesundheitsforscher – die angeblichen erblichen „Belastungen“ dieser Generation. Er verfügte über Daten von 1.115 Juden und 670 Jüdinnen. Von diesen waren 593 Männer und 594 Frauen Mischehen eingegangen, 522 Juden sowie 76 Jüdinnen hatten uneheliche Kinder gezeugt.39 Paul kam zu dem Ergebnis, daß von den 593 jüdischen Vätern ehelich geborener „Mischlinge“ 40,8% Kaufleute und Händler waren, die Mehrheit davon aus „Kaufmannssippen“.40 „Das Gesamtbild (…) bleibt im Rahmen eines guten Durchschnitts des jüdischen Volkes. Die Männer entstammen überwiegend den wirtschaftlich günstig gestellten Schichten; die erbbiologische Belastung bleibt durchaus im Rahmen des guten Durchschnitts“, so daß sich für Paul der Eindruck ergab, „daß sich an der jüdisch-deutschen Blutsmischung ein recht günstiger Ausschnitt aus der gesamten jüdischen Männerschaft beteiligt hat.“41
Die zahlenmäßig sehr viel weniger Jüdinnen, ebenfalls aus sozial mittleren wie oberen Schichten kommend,42 hätten hingegen Ehepartner geheiratet, die zu knapp 50% aus „körperlich arbeitenden Schichten“ stammten. Paul resümierte: Juden wählten „überwiegend deutsche Frauen aus Berufsschichten, die sozial unter ihrer eigenen Schicht lagen, während für die deutschen Frauen die artfremde Ehe meist mit einem sozialen Aufstieg oder doch mit einem vermeintlichen Aufstieg verbunden war.“43 Nichtjüdische Männer heirateten in gleiche oder höhere Schichten ein, jüdische Frauen verblieben in der Herkunftsschicht oder sanken sozial ab.44 Jüdische Männer hätten häufig sehr viel jüngere Partnerinnen gewählt, während nichtjüdische Männer meist mit einer gleichaltrigen oder älteren jüdischen Partnerin „vorliebnahmen“. Paul klassifizierte diese Gattenwahl in der jüdisch-männlichen Variante als „sinnengeleitet“ und in der „deutsch“-männlichen als von materiellen Interessen bestimmt.45 Von der jüdischen Seite her wäre zwar das „dieser Rasse bestmögliche Erbgut“ in die „Blutsmischung“ eingeflossen, von der weiblichen „deutschen“ Seite hingegen hätten „erblich minderwertige deutsche Frauen“ ihr im höchsten Maße unerwünschtes Erbgut vermehrt, insbesondere mit den unehelich geborenen „Mischlingen“.46 Paul plädierte vor diesem Hintergrund für weitere Verschärfungen der Eheverbote.
Daß der oft wohlhabende jüdische Mann eine Nichtjüdin „häufig unter seinem Stande“ heiratete, ging seit längerem aus den Statistiken hervor.47 Doch Pauls Untersuchung deutete – trotz ihrer problematischen Implikationen – erstmals auf breiter Datenbasis mögliche Motivationen zur Mischeheschließung an: Für jüdische Männer bedeutete eine solche Heirat die Chance zur Integration in die Mehrheitsgesellschaft, für ihre oft sehr viel jüngeren Partnerinnen die Möglichkeit zum sozialen Aufstieg. Die Ehen zwischen Jüdinnen und meist gleichaltrigen oder sogar jüngeren nichtjüdischen Männern scheinen hingegen in der Regel nicht aus materiellen, sondern aus emotionalen Gründen geschlossen worden zu sein.
In der praktischen Politik gegenüber den in Mischehen lebenden Juden standen die Nationalsozialisten nach 1933 vor einem Dilemma: Einerseits wollten sie diese und ihre Nachkommen wie alle anderen Juden aus Deutschland vertreiben und diejenigen strikt isolieren, die dennoch blieben. Wegen der erwähnten engen verwandtschaftlichen Bindungen zu „Deutschblütigen“ schien es aber taktisch klüger, die Verfolgungsmaßnahmen gegen die Mischehen zeitverschoben zu den antijüdischen Maßnahmen anzuordnen oder Ausnahmeregelungen für einzelne Betroffene und deren Familien zuzulassen.48
Ursula Büttner veröffentlichte 1988 die erste grundlegende Abhandlung über die Verfolgung der Mischehen als Einleitung zur Verfolgungsgeschichte des Schriftstellers Robert Brendel und seiner Familie.49 Sie unterscheidet drei antisemitische Verfolgungswellen, von denen die Mischehen und „Mischlinge“ unterschiedlich betroffen waren:
– In der Zeit von 1933 bis 1935, als in erster Linie Berufs- und Bildungschancen beschränkt wurden, waren alle „Nichtarier“ (bis zum „Vierteljuden“) – bis auf wenige Ausnahmen50 – denselben Repressionen ausgesetzt.
– Zwischen 1935 und 1938, als es neben der Verschärfung dieser Regelungen vor allem um die Separierung von Juden und „Deutschblütigen“ ging, wurden die „Mischlinge“ dann bessergestellt.
– Im Winter 1938 unterschieden die Machthaber zwischen „nichtprivilegierten“ und „privilegierten“ Mischehen. Bei jedem weiteren Verfolgungsschritt gegen die jüdische Bevölkerung in Deutschland wurde fortan vermerkt, ob die neuen Bestimmungen auch für diesen Personenkreis gelten sollten. Die zeitliche Verzögerung etlicher Verfolgungsschritte rettete die Masse der jüdischen Ehepartner letztlich vor der Einbeziehung in den Vernichtungsprozeß, wenngleich unter die politische Diskussion dieses Zieles der Rassenideologen nie ein Schlußstrich gezogen wurde.51
3. Die Einbeziehung der Mischehen in die Judenverfolgung im Zeitraum 1933–1942
Unmittelbar nach der nationalsozialistischen Machtübernahme wurde hinsichtlich der „Nichtarier“ noch nicht differenziert: Ohne an dieser Stelle alle einschneidenden Maßnahmen zur Existenzvernichtung und Ausgrenzung der Juden abhandeln zu können, sei nur darauf verwiesen, daß sich der Boykott vom 1. April 1933 unterschiedslos gegen alle „jüdischen“ Geschäftsleute richtete. Zwangspensionierungen bzw. Entlassungen aus dem Staatsdienst nach dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 trafen alle „Nichtarier“, soweit sie als solche bekannt waren. Der in der Folgezeit geforderte „Ariernachweis“ filterte die bis dahin unbekannten heraus. Immer neue Ausführungsverordnungen bestimmten, daß eine „nichtarische“ oder mit einer solchen verheiratete Person nicht Reichsbeamter, Beamter, Arbeiter oder Angestellter im Staatsdienst oder in gemischtwirtschaftlichen Betrieben werden konnte.52 Da auch die Mitgliedschaft in den Kammern für die Ausübung vieler Berufe unabdingbare Voraussetzung war, bedeuteten Nichtaufnahme oder Ausschluß gleichzeitig ein Berufsverbot. Die staatlichen und kirchlichen Archive, in denen die für den Abstammungsnachweis notwendigen Urkunden lagerten, meldeten Hochkonjunktur.53
Das „Blutschutzgesetz“ legte 1935 im §1 ein Eheverbot für künftige Mischehen fest, enthielt aber keine Sonderregelungen für die bestehenden. Dennoch förderte es nach Auffassung seiner Protagonisten die „Erziehung zu einem gesunden rassemäßigen Empfinden“ und destabilisierte die bestehenden Mischehen eindrucksvoller, „als eine Strafbestimmung es vermocht hätte“.54
Bis Ende 1938 waren Juden in Mischehen ebenso wie andere Juden von den einschneidenden Verfolgungsmaßnahmen betroffen: Sie mußten ihr Vermögen von mehr als RM 5.000 anmelden55 und wurden nach der Pogromnacht zur „Sühneabgabe“ von RM 1,1 Milliarden mit herangezogen. Die in Mischehe lebenden jüdischen Männer wurden in die Verhaftungen nach dem 9./10. November 1938 einbezogen. Von der durchgehenden „Arisierung“ jüdischer Vermögen waren noch sämtliche „Volljuden“ ungeachtet ihrer persönlichen Lebensumstände betroffen. Für die Mischehen allerdings begann nach der Pogromnacht die Phase der Ausnahmen und der zeitlich versetzten Repressionen, als Hitler im Dezember 1938 die Kategorien der „privilegierten“ und der „nichtprivilegierten“ Mischehen schuf,56 die allerdings nie rechtlich fixiert wurden. In welche Kategorie eine Ehe fiel, hing vom Geschlecht des jüdischen Ehepartners und der Existenz sowie der konfessionellen Erziehung der Kinder ab.
Als „privilegiert“ galten nun Paare
– in der die Frau jüdisch, der Mann nichtjüdisch war, wenn sie keine oder nichtjüdisch erzogene Kinder hatten;
– in der der Mann jüdisch, die Frau nichtjüdisch war, wenn nichtjüdisch erzogene Kinder existierten. Familien in diesen Konstellationen durften in der bisherigen Wohnung verbleiben, das Vermögen konnte auf den nichtjüdischen Partner bzw. die Kinder übertragen werden.
Als „nichtprivilegiert“ wurden alle anderen Paare eingestuft, in denen
– der Mann Jude und die Ehe kinderlos war;
– ein Ehepartner Jude war und die Kinder jüdisch erzogen wurden oder der nichtjüdische Partner (meist die Frauen) bei Eheschließung zur jüdischen Religion konvertiert war.
In diesen Familien durfte weder das Vermögen auf Ehepartner oder Kinder übertragen werden noch bestand ein Anspruch auf Verbleib in der angestammten Wohnung. Beide Gatten sollten bei Auswanderung wie Juden behandelt werden. Bei einer Scheidung allerdings, so referierte Göring in einem Schnellbrief die Position Hitlers, konnte die nichtjüdische Ehefrau in den „deutschen Blutsverband“ zurückkehren.
In der Folgezeit wurden die in „privilegierten“ Mischehen lebenden Juden von der Kennzeichnungspflicht mit dem „Judenstern“ ausgenommen.57 Auch die Sicherungsanordnungen für Vermögen wurden im Hinblick auf die „Privilegierung“ neu geregelt: War der Ehemann Jude, sollten die Vermögenswerte seiner Frau und seiner nichtjüdischen Kinder „gesichert“ werden; war aber die Ehefrau Jüdin, betraf die Sicherungsanordnung nur sie.58 Die Devisenstelle der Hamburger Oberfinanzdirektion war vor dieser reichsweiten Regelung viel weiter gegangen: Sie hatte grundsätzlich, unabhängig vom Geschlecht des jüdischen Ehepartners, alle Familienmitglieder „mitversichert“. Damit handelte sie nach eigener Einsicht restriktiver als andere „Gaue“ und schuf Ungleichheit unter den Betroffenen: „Die Erfahrung hat gezeigt, daß andere Devisenstellen bei Mischehen nur den jüdischen Teil sichern, so daß teilweise die Hamburger Regelung bei den Zuziehenden zu einer erheblichen Verschärfung der Sicherungsmaßnahmen führt.“59
Nachteile, wenn die Entfernung aus der Wehrmacht als solche gewertet werden sollen, erlitten auch die 25.000 mit Jüdinnen und „Halbjüdinnen“ verheirateten Männer, die am 8. April 1940 aus der Armee entlassen wurden.60 Verblieben sie mit einer Ausnahmeregelung doch in der Wehrmacht, konnten sich ihre jüdischen Frauen vom „geschlossenen Arbeitseinsatz“ befreien lassen, in den sie wie alle Juden ab Jahreswechsel 1938/39 einbezogen waren.61 Von den ab Oktober 1941 angeordneten Deportationen waren die in „privilegierter“ Mischehe Lebenden ausgenommen, die in „nichtprivilegierter“ zurückgestellt. Ab 1942 mußten diejenigen Mischehepartner, die einem Religionsverband angehörten, 1943 die übrigen im NS-Sinne als Juden definierten Personen der Zwangsorganisation der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland (RVJD) beitreten.62 Da dem Religionsverband nur die in Mischehe lebenden Männer angehörten, bleibt unklar, wie umfassend die mit Nichtjuden verheirateten Jüdinnen, die dem Religionsverband nie angehört hatten, nun zu Zwangsmitgliedern gemacht werden konnten.63
In Hamburg galten nach Aussagen des letzten „Vertrauensmannes“ der RVJD einige Sonderregelungen: Für die „Privilegierung“ wurde – abweichend von den Regelungen im Deutschen Reich – zusätzlich verlangt, daß mindestens ein Kind in Deutschland lebte oder sich nur zu Ausbildungszwecken im Ausland befand, andernfalls wurde eine an sich „privilegierte“ Ehe zur „nichtprivilegierten“. Entgegen Bestimmungen, wonach der Tod des nichtjüdischen Gatten einer vorher „privilegierten“ Ehe diese nicht aufhob, wurden verwitwete Hamburger Jüdinnen und Juden wie Teile aus „nichtprivilegierten“ Ehen behandelt und erlitten alle Nachteile dieser Gruppe. Selbst von der Deportation waren sie nur ausgenommen, wenn Ehemann oder Sohn im Krieg gefallen waren.64
Der Kriegsausbruch brachte für die Gesamtbevölkerung Lebensmittelrationierung, Wohnraumbewirtschaftung und einen gelenkten Arbeitsmarkt mit sich. Das bedeutete die sukzessive Neustrukturierung und Durchplanung aller Lebens- und Arbeitsbereiche. Die jüdische Bevölkerung reagierte darauf zunächst erleichtert, weil sie hoffte, daß im Krieg die antijüdische Politik in den Hintergrund treten würde.65 Die dann erlassenen Sonderregelungen zerstörten diese Hoffnung sehr schnell, denn die neuen Anordnungen stellten die Juden ungleich schlechter als die übrige Bevölkerung und beschleunigten den Separationsprozeß. Wenngleich die in Mischehen Lebenden hier bessergestellt waren als andere Juden, bedeutete doch jede einzelne Regelung vermehrte Kontrolle, Verarmung und Isolation.66 Zudem wurden ab Kriegsausbruch keine Bestimmungen mehr veröffentlicht, die verunsicherten Betroffenen konnten sich ausschließlich über die Reichsvereinigung informieren.67
II. Der Verfolgungsprozeß aus der Sicht der Betroffenen
Wie stellte sich dieser Prozeß nun aus der Sicht der Betroffenen dar? Tatsächlich hatten viele von ihnen, insbesondere die Frauen, einen jüdischen Ehepartner aus Gründen des sozialen Aufstiegs geheiratet. Etliche hatten die Verehelichung gegen den Willen ihrer Eltern angestrebt. Andere, die einen längst getauften oder sich als Dissidenten betrachtenden Mann heirateten, sahen in der Herkunft zumindest kein Problem mehr, waren selbst konfessionell nicht gebunden oder glaubten – bei getauften Partnern – in der nun gemeinsamen Religion eine Basis für die Ehe zu finden. In Hamburg – so ältere Zeitzeugen – galt es vor 1933 allemal als unschicklicher für eine evangelische Frau, einen Katholiken als einen Juden zu heiraten.
Jüdischen Frauen mag die Entscheidung zu einer Mischehe wegen des damit verbundenen Verlustes der Gemeindemitgliedschaft schwerer gefallen sein. Doch bei nur wenigen ergab sich nach der Hochzeit ein dauerhafter Bruch mit der christlichen oder jüdischen Verwandtschaft wegen der Eheschließung. Waren die Ehemänner jüdischer Herkunft, verließen sie das nicht nur durch Verwandte, sondern auch durch jüdische Geschäftspartner oder Arbeitgeber geprägte Umfeld in der Regel nicht. Sie erhielten die sozialen Bezüge also aufrecht, während Kontakte zur jüdischen Gemeinde einschliefen oder auch bewußt abgebrochen wurden.68
Die schrittweisen Maßnahmen zur ökonomischen Existenzvernichtung riefen bei den Betroffenen zunächst heftige Empörung und Proteste hervor. In einer Flut schriftlicher Einwendungen beteuerten sie Staatstreue und Vaterlandsliebe, wiesen auf ihre nationale Gesinnung hin und schöpften alle noch gangbaren Rechtswege aus. Noch zeigten sie sich als Bürger eines Staates, die stolz auf die Integrationsleistung, die erreichte berufliche Position oder die guteingeführte Firma waren, die ihre Rechte nicht nur kannten, sondern auch einforderten. Die beispielsweise in Personalakten enthaltenen Einwendungen von „Mischlingen“ oder in Mischehe lebenden Juden gegen die Aberkennung von Approbationen oder Zulassungen heben neben dem Fronteinsatz im Ersten Weltkrieg besonders Leistungen für Vereine, christliche Familienbande oder politische Betätigung im nationalistischen Sinne hervor. So protestierte ein Rechtsanwalt gegen den Verlust seiner Zulassung, indem er darauf verwies, daß er bei Geburt 1903 getauft, später konfirmiert und 1927 sogar aus der evangelischen Kirche ausgetreten sei. Er habe eine Christin geheiratet und seine Schwiegereltern materiell unterstützt. Das Berufsverbot bedeute also eine Härte gerade für die christlichen Verwandten.69 Als die Landesjustizverwaltung seine Einwände abwies,70 handelte er konsequenter und rascher als viele Mitbetroffene, die nun neue Existenzmöglichkeiten unter den eingeschränkten Verhältnissen herauszufinden suchten: Er emigrierte im Oktober 1933 nach Frankreich.71
Ein anderer Jurist betonte die Distanz zur jüdischen Herkunft und wies unaufgefordert darauf hin, daß keinerlei „jüdischer Verkehr“ mehr bestehe. Dagegen beweise die Mitgliedschaft in der Deutschen Volkspartei (DVP) und nationalistischen Vereinen, „daß ich nicht erst seit Wochen oder Monaten, sondern schon seit vielen Jahren mich in der nationalen Bewegung betätigt habe.“72 Ein Kollege bestätigte ihm gönnerhaft seinen „Ausnahmecharakter“: „Trotz unserer Empfindlichkeit in der Rassenfrage (…) waren meine Eltern und ich stets der Ansicht, daß Dr. G. in unserer Empfindungswelt so verwurzelt und mit ihr so verbunden ist, daß man ihm Unrecht täte, wollte man auf ihn das Wort „Jude“ in der Bedeutung anwenden, die eben die unüberbrückbare Scheidewand zwischen uns Ariern und den Juden kennzeichnet.“73 Doch hier wie in ähnlichen Fällen sah die Landesjustizverwaltung keinen Anlaß, die Zulassungsaberkennung zurückzunehmen,74 ein „arischer“ Kollege kritisierte vier Wochen später das nicht abmontierte Kanzleischild.75 Dies durfte erst im August 1945 wieder angebracht werden.76
Nicht einmal die NSDAP-Mitgliedschaft aus der Zeit vor 1933 wog die jüdische Abstammung einer Ehefrau auf, wie ein von der Gesundheitsbehörde als Bürokraft gekündigter Polizeiversorgungsanwärter erfahren mußte. In einer Eingabe führte er an, seit 1932 Parteimitglied in der Fachschaft Polizei gewesen zu sein. Seine Gesinnung sei gefestigt, die jüdische Religion habe bei seiner getauften Ehefrau keine Rolle gespielt, die Kinder würden „für das Deutsche Reich“ erzogen. Er distanzierte sich sogar von seiner Frau: „Leider war auch ich, wie wohl viele deutsche Volksgenossen, rassisch unaufgeklärt. Nur so ist es zu verstehen, daß ich nach verhältnismäßig kurzer Zeit den Ehebund einging [,] ohne mich über den Stamm meiner Frau genau zu informieren.“77 Seine Eingabe beschäftigte immerhin etliche Instanzen, weil er sich an den Reichsführer SS (RFSS), Göring und Innenminister Frick gewandt hatte. Dennoch mußte er auf die in der Versorgungsanwartschaft garantierte Einstellung verzichten und erhielt lediglich eine einmalige Unterstützung in Höhe von RM 300.78
In der freien Wirtschaft Tätige konnten als Angestellte noch einige Zeit länger beschäftigt bleiben bzw. als Selbständige versuchen, ihr Eigentum durch Überschreibung vor dem staatlichen Zugriff zu retten. Die Formen waren vielfältig: Einige jüdische Geschäftsleute retteten das Eigentum, indem sie „arische“ Teilhaber in die Firma aufnahmen, deren Namen von den Vermögensverhältnissen ablenkten, andere übertrugen es formal auf die nichtjüdische Ehefrau, die Schwiegereltern oder erwachsene Kinder.79 So konnte in etlichen Fällen auch der Einfluß des ehemaligen Besitzers in seinem Unternehmen getarnt und diesem die Weiterarbeit dort ermöglicht werden. Doch generell war der soziale Abstieg unausweichlich. Die Auswege aus der beruflichen Beschränkung und dem Zwang zur „Arisierung“ mußten fast immer die Betroffenen selbst suchen. Selten reagierten Arbeitgeber und Kunden so solidarisch und kulant wie im unten geschilderten ersten von drei Fallbeispielen. In diesen Familiengeschichten geht es um Mischehen, die nicht aufgrund des äußeren Drucks auseinandergebrochen sind. Sie geben einen Einblick in die Auswirkungen des Enteignungs- und Entrechtungsprozesses, in inner- und außerfamiliäre Beziehungsstrukturen und in die – individuell sehr unterschiedlichen – Strategien, die die Betroffenen dieser Entwicklung entgegensetzten.
1. „Mein Mann hat sich wieder der Jüdischen Gemeinde zugewandt“
1928 lernte die Hamburgerin Margarethe Moser ihren künftigen Ehemann Alfred kennen. Der wohlsituierte, 20 Jahre ältere Mann stammte aus einer Aachener jüdischen Familie, war nicht religiös und arbeitete als selbständiger Vertreter einer Textilfirma. Die Hochzeit stieß in beiden Familien wegen des Altersunterschiedes, nicht aber aus konfessionellen Gründen auf kurzzeitige Vorbehalte. Der gemeinsame Sohn wurde 1929 geboren und nach der nationalsozialistischen Machtübernahme in der Hamburger Jerusalem-Gemeinde getauft. Bei dieser Gelegenheit „bekehrte“ der dort amtierende Pastor den Ehemann zum Christentum, was sich nicht auf den Familienalltag auswirkte.80 Alfred Moser las viel, diskutierte gern und hielt sich mit seiner abschätzigen Meinung über den Nationalsozialismus auch öffentlich nicht zurück. 1934 verhaftete die Gestapo ihn erstmals, etliche weitere kurzzeitige Festnahmen folgten. Seinen Arbeitsplatz behielt er dennoch. Im Interview81 berichtete seine Frau, daß sie zunächst mit dem Einverständnis des Arbeitgebers und der Kunden einen Teil der Aufgaben ihres Mannes übernahm und damit den Lebensunterhalt auf dem gewohnten Niveau sicherte. Als dies nicht mehr möglich war, griff sie auf die „weiblichen Fähigkeiten“ zurück und schneiderte.82 Nun sank der Lebensstandard erheblich. Die Familie mußte sich einschränken und in eine kleinere Wohnung in eine Umgebung mit niedrigerem Mietniveau ziehen.
Die neue Nachbarschaft verfolgte argwöhnisch alle Lebensäußerungen des jüdischen Familienoberhaupts. Obgleich Mosers in ein ursprünglich geschlossenes sozialdemokratisches Milieu gezogen waren, konnten sie an dem vielleicht noch vorhandenen Rest Solidarität nicht teilhaben. Nach Denunziationen bei der Hausverwaltung und der Gestapo mußte die Familie mehrfach die Wohnung wechseln. Margarethe Moser trug in diesen Jahren nicht nur die Verantwortung für die materielle Versorgung der Familie, sondern führte Verhandlungen mit neuen Vermietern und übernahm andere traditionelle Aufgaben eines männlichen Haushaltsvorstandes. Selbst Gestapo-Vorladungen an ihren Ehemann nahm sie wahr:
„Ich habe dem [Gestapobeamten, B.M.] vorgelogen: ‚Mein Mann ist momentan krank, der leidet an Rheuma, hat er sich im Ersten Weltkrieg geholt im Schützengraben und so.‘ Ich meine, da war auch was dran wahr! Da bin ich die ganzen Jahre, wenn ich zur Gestapo mußte, und er wurde morgens um 7.00 Uhr vorgeladen, … habe ich manchmal ein Attest vom Dr. R. bekommen und das vorgelegt: ‚Er kann nicht kommen, weil er nicht gehen kann, weil die Knie wieder so angeschwollen sind.‘ Dann wurde ich natürlich von den Gestapobeamten angeschrien wie sonstwas: ‚Sie haben hier nichts zu suchen. Der Brief ist an Ihren Mann gerichtet.‘ Da sag ich: ‚Ja, so und so ist das.‘ ‚Sie immer mit Ihren Attesten.‘ Ich sagte: ‚Dr. R. würde den Attest nicht ausgeschrieben haben (…).‘ Mir hat das Herz zwar immer bis oben geklopft, sage ich Ihnen ganz offen.“83
Alfred Moser suchte ab 1938/39 Kontakt zur jüdischen Gemeinde. Das Gespräch mit Leidensgenossen, Informationen, die er nur aus Gemeindekreisen bekommen konnte und eventuell auch ein paar Stunden unverstellter Geselligkeit wurden ihm angesichts der zunehmenden Ausgrenzung immer wichtiger. Von diesen Kontakten schloß er seine Frau aus, denn parallel zur erzwungenen Trennung von jüdischer und nichtjüdischer Umgebung vollzog sich ein ebensolcher Prozeß innerhalb der jüdischen Zusammenhänge:
„M: Wie sich das immer mehr zuspitzte, da hat mein Mann sich wieder ein klein bißchen mehr der Jüdischen Gemeinde insofern zugewandt, da gab es ein jüdisches Gemeinschaftshaus in der Hartungstraße. (…) Und da ging er fast jeden Sonnabend hin. (…) Wenn er sonnabends zurückkam, dann hatte er so viel zu erzählen, was alles passiert war.
I: Sie sind nicht mitgegangen?
M: Nein, das wollte er auch nicht gern. Nein, wissen Sie, die wußten da alle, daß er eine christliche Frau hatte und so und haben ihn immer… Verstehen Sie? Die sagten immer: ‚Herr Moser, Sie können ja gar nicht mitreden.‘ Das dürfen Sie nicht vergessen. Wir haben doch ein bißchen Mißgunst auch [erfahren, B.M.] (…).
I: Weil er in dieser sogenannten privilegierten Mischehe lebte?
M: Ja, eben.“84
Dennoch überwand das Ehepaar im Gespräch die getrennten Sphären und erhielt sich so eine gemeinsame Lebenswelt, während beide in der jeweils eigenen mit einschneidenden Veränderungen konfrontiert waren: Die jüdischen Verwandten Alfred Mosers emigrierten, er verlor seinen familiären Zusammenhang, und im Gemeindehaus mußte er Vorbehalte der jüdischen Gesprächspartner gegen seine Mischehe bekämpfen. Der Vater Margarethe Mosers sympathisierte mittlerweile offen mit dem NS-Regime. Zwar hatte er seine Kritik an der Eheschließung seit langem überwunden, nun aber politisiert, äußerte er seiner Tochter gegenüber antisemitisches Gedankengut. Doch auch diese Belastungen konnte das Ehepaar gemeinsam auffangen.
Die eigene relativ sichere Situation mit der bedrohlichen anderer Juden vergleichend, war es für sie keine Frage, Hilfe zu leisten: So versteckte Frau Moser ohne Wissen ihres Vaters in dessen großer Wohnung Gepäck von jüdischen Emigranten, um es der Zollkontrolle zu entziehen, und in der Pogromnacht fanden von Verhaftung bedrohte jüdische Männer vorübergehend Unterkunft bei Mosers:
„M: Wir haben oben bei uns in der Wohnung fünf, sechs Juden beherbergt auf dem Fußboden, weil doch da so viele abgeholt wurden.
I: In der Pogromnacht?
M: Ja. Die wagten doch nicht, im Hause zu sein. Sind nachher alle weggekommen, hatte gar keinen Zweck [ins KZ, B.M.]! Nur sie hatten die Beruhigung, daß sie bei uns eine Unterkunft hatten für ein, zwei Tage. Sie sind dann wieder in ihre Wohnungen zurückgegangen.“85
Frau Moser erinnert sich rückblickend vor allem an Wut als beherrschendes Gefühl dieser Jahre:
„Ich habe so meine Ellbogen gebrauchen müssen. Und manchmal sag ich zu Klaus [dem Sohn, B.M.]: ‚Du weißt genau, mit Samthandschuhen hat man deine Mami nicht angefaßt ab 1933 oder 1934. Im Gegenteil.‘
I: Ist Ihnen das schwergefallen am Anfang?
M: Nein, ich hatte eine viel zu große Antipathie. Ich hatte eine Wut, das kann man gar nicht beschreiben. Wissen Sie, ich bin kein Gerechtigkeitsfanatiker, aber es geht mir nicht in den Kopf, weil ein Mensch einen anderen Glauben hat …, verstehen Sie?
I: Den er ja nicht einmal mehr hatte.
M: Nee, das sowieso. Ihn dann ins KZ zu stecken oder ihn zu beschimpfen, das fand ich so abnorm. Ich war böser und wütender als mein Mann.“86
Wut gab Frau Moser Kraft und Energie zu Handlungen und Grenzüberschreitungen, die sie weder erlernt hatte, noch auf die sie psychisch vorbereitet war. Vermutlich hatte sich die 20jährige bei der Eheschließung Versorgung und Sicherheit erhofft, doch die Realität jener Jahre erforderte aktives Handeln, in das sie sich ohne Zögern hineinfand. Die gemeinsame Wut über die Behandlung der deutschen Juden schuf – zusätzlich zu der Fähigkeit zur Kommunikation – auch eine weitere gefühlsmäßige Basis für das Zusammenleben. Obwohl insbesondere die Wut des Ehemannes diesen selbst und die Familie gefährdete, versuchte die Ehefrau nicht, mäßigend auf ihn einzuwirken, indem sie das Ausmaß ihrer Angst betonte. Sie akzeptierte ihn trotz des männlichen Autoritätsverlustes nach außen innerhalb ihrer ehelichen Gemeinschaft weiterhin als souveränes männliches Gegenüber. Das führte allerdings auch dazu, die Grenzen seiner Vorgaben einzuhalten und keine eigenen Vorschläge beispielsweise für eine gemeinsame Emigration zu unterbreiten: „Auswandern – überhaupt kein Gedanke. Ich wußte auch, es hatte keinen Zweck, Frau Meyer. Er wollte nicht.“87
Der Druck von außen führte weder zur Auswanderung noch zum Zerbrechen der Ehe, bis der Mann 1943 inhaftiert und nach Auschwitz deportiert wurde.88 Als Grund dieser letzten Verhaftung vermutet Margarethe Moser seine immer wieder offen geäußerte Wut über die antijüdischen Maßnahmen des Regimes und das antisemitische Verhalten der Umgebung, dennoch schwingt gut 50 Jahre später kein Vorwurf an den Ehemann im Interview mit, daß er bei angepaßterem Verhalten diese letzte Verhaftung vermeiden und eventuell sein Leben hätte retten können. Da dieses Paar den äußeren Druck nicht gegeneinander richtete, gelang es der Ehefrau, auch nach der Ermordung ihres Mannes die Verantwortung dorthin zu schieben, wohin sie gehörte: auf die nationalsozialistischen Machthaber.
2. „Diese Leute legen ihre Stammesgenossen herein“
Während Alfred Moser eine Annäherung an die jüdischen Leidensgefährten vollzog, gingen andere in Mischehen lebende Personen den entgegengesetzten Weg und hielten wie Ernst Eder doppelte Distanz zu ihnen.89
Dieser stammte aus einer wohlhabenden Hamburger Kaufmannsfamilie, die im Im- und Exportbereich tätig war. Sein Vater erwähnt in dem 1935 verfaßten Lebensbericht90 die jüdische Abstammung nicht ein einziges Mal, statt dessen präsentierte er als lebensgeschichtliche Höhepunkte geschäftliche Transaktionen wie gewinnbringende Getreideimporte, Consignationen und Assekuranzen. Ehefrau und Kinder komplettierten die Welt des Kaufmannes, hatten aber kaum Einfluß auf sie. Die Geschäftspartner waren zumeist nichtjüdische Kaufleute, sein Teilhaber hingegen war Jude. Der 1880 geborene Sohn wuchs über Lehrzeit und Auslandsaufenthalte am Vorabend des Ersten Weltkrieges in die Leitung der Firma hinein. Er heiratete eine christliche Frau, mit der er einen Sohn und zwei Töchter bekam. Nach 1933 verschlechterte sich die wirtschaftliche Situation der Firma: Nicht nur die auf Autarkie ausgerichtete Politik der nationalsozialistischen Machthaber und die Einschränkung der Kontingente machten Ernst Eder zu schaffen, sondern auch die überstürzte Emigration seines jüdischen Geschäftspartners, der ein verständliches Interesse daran hatte, möglichst viel liquides Vermögen mitzunehmen. Schließlich „arisierte“ Eder die Handelsfirma, indem er sie seinem neuen nichtjüdischen Teilhaber übertrug, damit er selbst unauffällig dort weiterarbeiten konnte. Sein großes Vermögen an Grundbesitz und Mietshäusern sicherte er ebenso vorausschauend durch rechtzeitige Übertragungen an Familienmitglieder. Bis zur Pogromnacht am 9./10. November hatte er – durch seinen Wohlstand geschützt – die zunehmende Entrechtung der Juden zwar registriert, aber selbst immer wieder Möglichkeiten gefunden, Geschäft und Privatvermögen zu retten. Vor antisemitischen Anfeindungen schirmten ihn die eigene Stadtvilla, die Bediensteten und seine Chefposition schon räumlich weitgehend ab. Psychisch gelang es ihm, die Wahrnehmung der Ausgrenzung abzuwehren, indem er sein Augenmerk stärker auf Äußerungen der Regimekritik als auf Zustimmung richtete. „Die Unlust im Volke scheint mir viel größer zu sein, als die oben wahrhaben wollen“, schrieb er seinem Sohn und schilderte ein Gespräch mit einem ihm unbekannten Mann, der am liebsten emigriert wäre. Diesem hätte er entgegnet: „Ja, warum in aller Welt denn Sie, der doch mit all den Widerwärtigkeiten gar nichts zu tun hat. Ja, ich kann den ‚deutschen Blick‘ (das ist erst rechts und links sehen, ob auch keiner etwas hört, wenn man was sagt) nicht länger ertragen, es ist zu ekelhaft, daß man es nicht mehr wagen kann, den Mund aufzumachen.“91
Am 11. November 1938 war Ernst Eder wie jeden Tag ins „Bureau“ gefahren, obwohl er von den Zerstörungen und Verhaftungen in der Nacht zuvor wußte. Als einzige Konzession an die Gefahr hatte er seinen jüdischen Großvater nicht mitgenommen. In der Firma verhaftete ihn die Gestapo:
„(…) traten zwei Zivilisten ein mit der Frage, ob die Firma rein arisch, nein, Sie Inhaber, kommen Sie mit. Entleeren Sie sämtliche Taschen, nehmen Sie allenfalls bis M 10 mit, Uhr, Bleistift, alles da lassen. Ab zum Stadthaus. Dort warten, Befragen, sie bleiben verhaftet, herunter in ein dunkles Loch mit Pritsche und Pissoir. 1/2 Stunde, dann kommt ein ziemlich mieser Portokassenjüngling dazu. Eine weitere Stunde, Herr C., der uns seinerzeit eingerichtet hatte und in meinem Alter ist. Dann allmählich Abtransport im grünen August. Im Hof des Stadthauses zwei baumlange SS. Und nun ging die Mißhandlung los. Los, los, ihr Judenschweine (…) Und immer kamen mehr Juden in den Wagen – insgesamt 31. Teilweise waren sie blutig zusammengeschlagen. Und dann ins Gefängnis Fuhlsbüttel. Dort mit derselben nie schnell genug werden könnenden Geschwindigkeit raus aus dem Wagen mit Tritten, Knuffen und Geschimpfe, dann mit dem Gesicht gegen die Wand des Ganges stramm dagestanden, einer neben dem andern. Ich kann Dir sagen, das war eine Qual (…) Und nachdem nach endlosen Warten und Registrieren (…) in einem Raum hinuntergejagt und gestoßen (…) Hatte sich (…) eine buntgemischte Gesellschaft von 36 Menschen dort zusammengefunden, von denen ich C., einen gewissen L. von der Getreidebörse, (…) H. von C., H. von L. und F. kannte, bessere Leute wie z.B. Dr. Fritz Warburg und Dr. C.A.C., die sich beide (…) in einem Raum über uns befanden, wie auch einfache Leute wie Diener, Zeitungsverkäufer, Handwerker, Menschen von 17 Jahren bis zu 68.“92
Ein Mithäftling, der zuvor wegen „Rassenschande“ bereits verhaftet gewesen war, führte die Neulinge in die Gefängnisgepflogenheiten ein. Sie wählten einen „Vormann“ und Eder als dessen Stellvertreter. Im Laufe des Abends trafen weitere verhaftete Juden ein, bis die Gruppe auf 90 Personen angewachsen war. Die folgenden Tage waren von Beschimpfungen und Schikanen der jungen SS-Leute, Hunger und Ungewißheit über die nahe Zukunft bestimmt. Die am 9. und 10. November Verhafteten waren ins KZ Sachsenhausen/Oranienburg verbracht worden. Würden die später Verhafteten diesen Weg auch gehen müssen? Die sadistischen Scherze der SS-Leute führten Ernst Eder, der bis dahin offenkundig keine Ahnung von der inzwischen entstandenen Welt der Lager gehabt hatte, erstmalig in das KZ-System ein. Zudem erhielt er zwei briefliche Mitteilungen: Daß ein Treuhänder in die Firma eingesetzt sei und daß er auszuwandern habe. In den drei Wochen „Kolafu“ nahm er sieben Kilogramm ab, und seine Welt brach zusammen: Inhaftiert wurden in seiner Vorstellung nur kriminelle Elemente. Er hatte nun realisieren müssen, daß Wohlstand, Verdienste und Status nichts mehr galten und allein der Umstand, „Jude“ zu sein, ihn mit Kriminellen auf eine Stufe stellte.
Zwei weitere Momente machten ihm zu schaffen: Der Wandel der traditionellen Normen und Werte, symbolisiert von der Ablösung der lebenserfahrenen, verdienstvollen Honoratioren durch „22/23“jährige SS-Leute, die mit absoluter Machtfülle ausgestattet waren. Zum zweiten schockierte es ihn zutiefst, in der Haft mit einem „Portokassenjüngling“ und Ex-Häftlingen gleichbehandelt zu werden, denn die jüdische Herkunft stellte für ihn kein verbindendes Moment mit diesen Personen dar.
Nach der Freilassung rissen die demütigenden Erfahrungen nicht ab, wenn etwa Freunde, bevor sie das Ehepaar Eder einluden, ihr Personal nach der Zumutbarkeit von Tischreichungen an Juden befragten. Außerdem verlor er mit seiner Firma auch den stabilisierenden Faktor Arbeit. Emigrationsgedanken verwarf er aufgrund seines Alters und der Bindung der Familie an Hamburg.93
Bei Kriegsausbruch vermietete er sein Wohnhaus möbliert an einen Offizier und zog mit beiden Töchtern in das Haus der jüdischen Stiefmutter, das diese der Enkelin überschrieben hatte.94 Die vorher in die Firma investierte Energie kam nun seinem Garten zugute, den er in ein von Passanten und Nachbarn bestauntes Schmuckstück verwandelte. Doch als diese – auf welchen Wegen auch immer – von der Abstammung Ernst Eders erfuhren, rissen die „Chikanen, Stiche und Unannehmlichkeiten, teils größerer, teils kleinerer Art, aber immer gleich verletzend und entehrend, (…) nie wirklich ab.“95 Dennoch sah Eder sich nicht als isolierte, gefährdete Einzelperson oder als Teil einer Verfolgtengruppe, sondern er fügte seine Bedrohung gedanklich in die Vorstellung eines viel größeren, ungleich bedrohlicheren Zustands der Gesamtgesellschaft ein. Er fürchtete um die soziale Hierarchie der deutschen Gesellschaft wegen der nivellierenden Tendenzen einer „Volksgemeinschaft im Kriegszustand“, in der oben und unten, reich und arm durcheinandergewürfelt wurden. Ausgebombte aus dem Arbeiterviertel Rothenburgsort, die im vornehmen Harvestehude einquartiert wurden, waren ihm gleichermaßen Zeichen eines Wertezerfalls wie „Damen“, die Arbeitsdienst leisteten.
Um so mehr ermutigte er seine Familie, im privaten Raum Gegengewichte durch die Einhaltung bürgerlicher Konventionen zu setzen: Bei der Weihnachtsfeier strahlte ein Tannenbaum, am Hochzeitstag erfreute sich die Ehefrau an mühsam aufgetriebenen Blumen, an Geburtstagen gelang es, den Herren nach dem Essen weiterhin die Havanna und ein Gläschen Wein anzubieten. Eder wußte, wie privilegiert er im Vergleich zu anderen Juden lebte. Verwandte hatten bereits in „Judenhäuser“ umziehen müssen oder waren deportiert worden. Über die Deportationen war er recht gut informiert. So notierte er am 11. Januar 1945:
„Angeblich sind sie [Verwandte, B.M.] dann nach Riga abtransportiert worden, von wo sie weiter nach Minsk. Nie wieder hat irgendjemand von diesem Transport, dem entsetzlichsten all der vielen Transporte, die stattgefunden haben, gehört. Denn nur dieser eine Transport soll nach Riga gegangen sein. Und keiner von diesen Menschen, so wird gesagt, soll noch am Leben sein. Die anderen Transporte waren (…) immer nach Litzmannstadt gegangen (…) Später sind die Transporte dann alle nach Theresienstadt (…) gegangen (…). Über den Minsker Transport und über die Art, wie die Armen umgebracht worden sein sollen, werden die furchtbarsten Schauergeschichten unter den ‚Ariern‘ erzählt.“96
Ein protestantischer Pastor hatte sich schriftlich beim Reichssicherheitshauptamt eingesetzt, um die Deportation einer 93jährigen Verwandten von Eder zu verhindern.
„6 Monate nach Abgang seines Gesuchs erhielt er Antwort in Form einer Vorladung zur Gestapo in Hamburg. Dort saß in einem Klubsessel ein junger S.S.Mann, der dem alten, mit Orden und Ehrenzeichen so reich dekorierten Herrn nicht einmal einen Stuhl anbot. Man hat ihn furchtbar zusammengeschnauzt und ihm gesagt, daß es für einen Deutschen unfasslich sei, daß er sich für Juden einsetzen könne. Auf seine Bemerkung, daß die alte ‚Dame‘ nun doch wirklich niemandem etwas getan habe, wurde ihm erwidert, daß das keine Dame, sondern ein ‚Judenweib‘ sei. Da Pastor Seyfarth Gott sei Dank sein Gesuch einen Tag vor der Rede Dr. Göbbels abgesandt habe, in welcher die Juden als Staatsfeind No.1 erklärt wurden, so wolle man es dieses Mal mit einem Verweis und dem Hinweis belassen, daß er nie wieder mit Juden in Berührung kommen dürfe, so weit solche noch vorhanden, andernfalls er unweigerlich sofort in ein Konzentrationslager verbracht werden würde.“97
Auch an dieser Episode wird wieder deutlich, daß ein Machtwechsel von erworbener, verdienstvoller Autorität zu jugendlicher, auf brutaler Macht beruhender Autorität stattgefunden hatte. Die zusätzlich schmerzliche Lektion für Eder bestand in der Erkenntnis der Wirkungslosigkeit von Solidarität, die nur den Effekt hatte, ihre Protagonisten in Gefahr zu bringen. Wer konnte noch etwas für Juden erreichen, wenn nicht ein hochbetagter Geistlicher, der zudem ein mit Orden ausgezeichneter Frontkämpfer war?
Ende 1942 forderte die Bezirksstelle Nordwestdeutschland der RVJD Eder zu einem Besuch auf, da seine jüdische Stiefmutter bis dahin dort nicht registriert war, nun aber auf der Deportationsliste stand. Sie hatte jahrelang wie selbstverständlich die allgemeinen, nicht gekennzeichneten Lebensmittelkarten bezogen. Eder über seinen ersten Kontakt zu „diesem jüdischen Verein“:
„Ich verstand es, mit den Leuten dieses ‚Vereins‘ mich gut zu stellen. Und trotzdem: Diese Leute sind es ja gerade, die ihre Stammesgenossen hereinlegen. Konnten sie nicht gerade so gut weiter nichts wissen, nachdem sie 3 Jahre lang nichts von meiner Mutter gewußt hatten. Aber nein, das war ja gerade der Eifer dieser Leute da, sich bei der Gestapo lieb Kind zu machen, indem sie diese Vergessenen aufspürten.“98
Nun waren die Verantwortlichen in der ehemaligen jüdischen Gemeinde der Gestapo weder freiwillig untergeordnet noch stellten sie Vorschlagslisten für Deportationen auf, wenngleich sie bei deren Durchführung maßgeblich einbezogen waren. Eders Bemerkungen zeigen in erster Linie, wie weit entfernt er von allen Vorgängen innerhalb der jüdischen Gemeinschaft war. Anders als der im vorangegangenen Fallbeispiel beschriebene Moser bezog er seine Informationen über Ereignisse oder bedrohliche Neuerungen von „Ariern“ und hatte nicht vor, sich aufgrund der Notwendigkeit, neueste Regelungen zu kennen, zwangsweise wieder zum Juden machen zu lassen. Seine Abgrenzungstendenzen gingen so weit, daß er das Bild, das die Verfolger von Juden konstruiert hatten, ohne Einschränkungen übernahm: Unterwürfige, auf den eigenen Vorteil bedachte Verräter der Leidensgenossen meinte er vor sich zu haben.
Seine 82jährige Stiefmutter wurde nicht mehr deportiert, sie verübte Selbstmord. Seit der Kennzeichnungspflicht für Juden hatte sie das Haus nicht mehr verlassen, um den Stern nicht tragen zu müssen und beinahe alle Kontakte zu Freunden eingebüßt, „eine Gefangene in ihrem eigenen Hause und voll Angst, sobald es klingelte.“99 Nun hielt ein evangelischer Pastor die Trauerrede an ihrem Sarg.
Im Jahr 1943 wurde die Zwangsarbeitspflicht auf Juden bis zum 65. Lebensjahr ausgedehnt. Ernst Eder, 61 Jahre alt, wurde der Chemischen Fabrik Heldmann zugewiesen, wo er aus Tierkadavern Rattengift produzierte und abpackte. Der Fabrikbesitzer war sein bester Jugendfreund gewesen. Nun mußte Eder ihm dankbar für die Arbeit in der Giftproduktion sein, denn andernfalls – so sein Bericht – wäre er als Straßenfeger eingesetzt worden. Offen muß die Frage bleiben, ob er nicht wußte, daß sein Name neben anderen auf einer Einsatzliste des RSHA für ein Arbeitskommando in Berlin stand.100 Zumindest erwähnt er diese bedrohliche Tatsache nicht.
Neben der gefährlichen Arbeit in der Chemischen Fabrik bereitete ihm wiederum das zwangsweise Zusammensein mit Juden aus anderen sozialen Schichten Probleme: „Und dann der Ton unter diesen Juden, so etwa Steinstraße und Konfection. O, es war schon ein Genuß! Aber man mußte ja gute Miene zum bösen Spiel machen und sich sagen, daß es Ewigkeiten nicht dauern würde.“101 Auch fünf Jahre nach der Pogromnacht hatte Ernst Eder seine Einstellung zu den Mitbetroffenen nicht geändert, soziale Unterschiede waren nach wie vor gewichtiger als das gleiche Verfolgungsschicksal.
Die Luftangriffe auf Hamburg im Sommer 1943 verbrachte die Familie im eigenen Keller. Am 27. Juli 1943 wurde das Wohnhaus leicht getroffen, das Nachbarhaus stürzte zusammen. Eder notierte:
„Ich sofort heraus. Ich war ja der einzige Mann im Hause. (…) Über die Brücke (…), wo das schöne, große Etagenhaus zum Hermann Göringhaus für Flieger umgebaut worden war. Dort 10 Mann anfordern, um die Leute herauszuholen. Diese wollten erst wegen der Schießerei gar nicht heraus und mit. Also schließlich kamen sie zaudernd, als ich davon sprach, morgen Meldung zu machen, da es sich um die Rettung von Menschenleben handle. (…) [In der Heilwigstraße] fand ich einen voll besetzten Feuerwehrwagen: Jungs, wollt Ihr denn nicht löschen, es brennt doch überall?! Sie: Wir haben keinen Befehl! Echt! Wer hat hier Befehlsgewalt? Sie: der Feldwebel.– Wo ist der? Sie: Da hinten (…) So. Befehl werde ich Euch sofort beschaffen (…) Herr von Hütz, Sie haben die Befehlsgewalt, lassen Sie sofort jene Leute absitzen und einen Schlauch zur Isebek verlegen. Ich nehme ein Tau und klettere durch das Nebenhaus auf das Dach des brennenden Hauses (…) Genug, wir haben das Haus gehalten und gerettet, und mit ihm die ganzen 5 Häuser dieser Reihe, vor allem auch das unsrige.“102
Ernst Eder faßte mit an, stundenlang half er bei Lösch- und Bergungsarbeiten. Dies blieb Nachbarn und Parteifunktionären nicht verborgen. Seine Frau erfuhr auf der Straße von den Heldentaten ihres Mannes, und ausgerechnet der NSDAP-Ortsgruppenleiter, der ihm als Juden zwei Jahre zuvor den Zuzug in „sein“ Gebiet nicht gestatten wollte, machte seine Aufwartung, um zu danken:
„Jedenfalls war es für mich eine ganz ungeheure Genugtuung, diese Rehabilitierung so unverhofft zu erleben. Andere haben das Kriegsverdienstkreuz mit Schwertern für weniger Leistung erhalten. Ich als Nichtarier komme, selbst wenn ich mehr leiste, dafür ja nicht in Frage. Dessen bin ich ja nicht würdig!!! Aber mir war dies mehr als so ein Orden. Und Nachbarn kamen mit Gebäck, Wein etc. um sich zu bedanken. Auf offener Straße hielt plötzlich ein von einem Offizier gesteuerter Wagen an. Heraus sprang eine bildhübsche, junge Frau. Sie sind Herr Eder? Ich wollte Ihnen nur herzlich danken für das, was Sie getan haben.“103
Die Krisensituation hatte zum sichtbaren Versagen der neuen, jugendlichen Autorität geführt und der „natürlichen“ eines erfahrenen Mannes wieder zum Durchbruch verholfen. Dieser Wiedergewinn von Männlichkeit und Autorität unter den Augen einer Umgebung, die vorher selbst den Gruß verweigert hatte, ließ Eder leistungsmäßig über sich selbst hinauswachsen. Endlich war er wieder wer, durfte dazugehören und war sogar einer, dem Dank und Anerkennung gebührte, dem Geschenke gebracht wurden und den „bildhübsche“ Frauen ansprachen. Daß die eigene Frau seine Taten von fremden Menschen erfuhr, vermehrte seinen neuen Glanz weiter. Eder nahm den Opportunismus seiner Umgebung, die kurzzeitig befürchtete, das NS-Regime habe abgewirtschaftet und man müsse sich nun mit dessen Opfern gutstellen, nicht zur Kenntnis. Für ihn offenbarte diese vorübergehende Verschmelzung mit der Umgebung eher, daß unter der pauschalisierenden antisemitischen Maske, die Bevölkerung wie Parteifunktionäre sich auferlegt hatten, nun wieder der Wille zum Differenzieren zum Vorschein kam: Die Bereitschaft, verdiente Personen als Gleichwertige wieder in die Gemeinschaft aufzunehmen, wenn sie eine Härteprobe bestanden hatten. Er konnte sich als Mitglied der Gemeinschaft fühlen, der eine militärische Niederlage als schlimme Zukunftsaussicht erschien.
Der bald zurückkehrende Alltag zerstörte diese Hoffnungen sehr schnell. Gas- und Stromsperren, Flüchtlingselend, abgerissene Postverbindungen oder nicht passierbare Straßen beschäftigten seine Nachbarn weit mehr als das Schicksal der wenigen noch in Hamburg verbliebenen Juden. Im Januar 1945 erhielt Ernst Eder eine Gestapovorladung. Bevor er sie befolgte, erfuhr er zu seiner Beruhigung von „geeigneter Stelle“, daß es (noch?) nicht um die Deportation, sondern um die Registrierung und Befragung der nicht in Arbeit stehenden, in Mischehen lebenden Juden gehe.
„Aber etwas Anderes erfuhr ich bei dieser Gelegenheit: 31 Menschen, meist Frauen, kommen morgen hier fort. Erst einmal nach Berlin. Es heißt, nach Theresienstadt? Es handelt sich um solche Juden, die teils in privilegierter Mischehe lebten, deren arischer Teil aber inzwischen verstorben, oder, wo die Ehe geschieden ist, trotzdem mit dem nicht arischen Teil noch jüngere Kinder zusammenleben. Bisher hatte man diese Personen aus letzterem Grunde noch geschont. Und dann waren noch einige Mischlinge hier, die als Juden gelten (…) Ich wundere mich nur deswegen über diesen Transport, weil ja ansonsten keine Waggons und keine Begleitmannschaften zu haben sind, und weil doch gerade in diesen schrecklichen Tagen das Flüchtlingselend derartig gewaltig und groß ist.“104
Offensichtlich hatte Ernst Eder immer noch zuverlässige Informationsquellen in Behörden, denen er mehr traute als den Repräsentanten der Reichsvereinigung. Die Hinweise auf beginnende Deportationen des Mischehen-Personenkreises hätten ihn beunruhigen müssen, hätte er sie auf sich selbst bezogen.105 Er aber sah die Transporte als Teil der allgemeinen Flüchtlingsströme, die vom derzeitigen Niedergang Deutschlands zeugten. Aus dieser Perspektive waren sowohl Flüchtlinge wie auch Deportierte obdach-, heimat- und eigentumslose Menschen, denen geholfen werden mußte, und es ist sicher kein Zufall, daß er sich hilfsbereit den „Volksgenossen“ und nicht den Leidensgenossen zuwandte. Voller Mitleid hätte er gern ein paar (zu ihnen passende) Flüchtlinge aufgenommen. Hier aber gewinnt in dem Bericht seine Ehefrau erstmals aktive Funktionen. Bis dahin war sie in dem Bericht als frag- und klaglos treue Gefährtin beschrieben worden, die ihm zur Seite stand, seine Ansichten teilte und in seinem Sinne handelte. Ihre Kontakte mit der RVJD erwähnte er nicht, vielleicht waren sie ihm nicht bekannt. Nun aber, als er Flüchtlinge aufnehmen wollte, befürchtete sie zu Recht, diese Einquartierten könnten im Konfliktfall die Sicherheit der Familie bedrohen.106
Fast schizophren mutet es angesichts der sich abzeichnenden militärischen Niederlage an, wenn er am 31. Januar 1945 notiert:
„Im übrigen sprach gestern der Führer über Rundfunk anläßlich der am 30. Januar wiederkehrenden, nunmehr 12jährigen Machtübernahme. Die Rede war kurz, dieses Mal aber wieder im Gegensatz zu einer kürzlichen markant und hat zweifelsohne auf das Volk sehr überzeugend gewirkt! Sie ging wie immer davon aus, daß der Führer aus dem Nichts heraus zur Macht gelangte durch eisernen Willen und Gottes Fügung. (…) Er verkenne keineswegs die furchtbare Not, den Kummer, das Leid und Elend, das der, so sagte er, uns aufgezwungene Krieg über Deutschland gebracht habe (…) Aber alles Leid, das schon ertragen sei, und alles Leid, das noch kommen wird, selbst wenn es das Unvorstellbare noch übertreffe, müsse ertragen werden, um diesen Krieg siegreich für uns zu beenden (…) Ja, daß das Ende, wenn wir den Krieg verlieren, für das arme Deutschland unvorstellbar furchtbar sein wird, daß noch auf lange Jahre hinaus in weit verschärftem Maße Hunger, Krankheit und Elend (…) kommen werden, davon bin auch ich überzeugt!“107
Kann aus dieser Berichtspassage eine Zustimmung zur Politik Hitlers herausgelesen werden? Vielleicht nicht, auf jeden Fall aber eine Verknüpfung des eigenen Schicksals mit dem siegreichen oder unterlegenen Deutschland, und zwar nicht vom Standpunkt eines Opfers dieser Politik aus, sondern aus der Perspektive eines „Volksgenossen“, dessen Land zerstört ist und vermutlich noch Jahre unfähig sein wird, die Bevölkerung zu ernähren. Wie Deutschland insgesamt, hatte inzwischen auch die Familie Eder die materiellen Ressourcen durch Bombenschäden weitgehend eingebüßt. Er reagierte um so dankbarer auf markante Worte.
Seltsamerweise erwähnt Eder die Deportation der 194 in Mischehen lebenden Juden am 14. Februar 1945 ebensowenig wie einen Hinweis, wie es ihm gelungen war, die Zwangsmitgliedschaft bei der Reichsvereinigung zu umgehen. Auch über Auswirkungen des äußeren Drucks auf die eheliche Gemeinschaft verlor er kein Wort, während aus den Akten der jüdischen Gemeinde immerhin deutlich wird, daß die Ehefrau zumindest hier eine aktive Mittlerrolle spielte.108
In den Notizen zur Übergabe Hamburgs am 3. Mai 1945 flossen noch einmal zwei Momente ineinander: Das Befreiungsgefühl und die hier von der Ehefrau zum Ausdruck gebrachte starke Identifizierung mit Deutschland.
„Frei, frei, wirklich frei! Kein Gestapobeamter hinter der Tür, wenn es klingelt, keine neue, ins kleinste auserdachte Gemeinheit, uns neu zu schikanieren und zu peinigen, kein Heil Hitler der Andern mehr, auf das man nicht antworten durfte und wollte, kein zaghaftes Vorfühlen bei Dritten, wie sie noch eingestellt sein mochten (…) Und dennoch: Mutti hat an jenem Tage bittere Tränen vergossen: So tief, so unendlich tief, so mit Schmach und Schande bedeckt mußte unser armes Deutschland sinken (…), damit wir, und mit uns ganz Deutschland, diese Nazipest los werden konnte, dieses Verbrechertum, über deren volles Treiben wir erst jetzt richtig hören aus den Konzentrationslägern wie Auschwitz, Dachau, Buchenwald …“109
Schlagartig erfaßte Ernst Eder nach Kriegsende das Ausmaß des Judenmords und das Schicksal von Millionen Zwangsarbeitern, als dürfte er diese Verbrechen in ihren bis dahin so bedrohlichen Dimensionen erst jetzt wahrnehmen. Gleichzeitig registrierte er die geistige Flucht der Parteifunktionäre aus der Verantwortung: „Aufgelöst in Dunst, verschwunden wie ein Phantom in ein Nichts. Wo sind die Einrichtungen, wo die Leute. Nichts, nichts mehr auffindbar. Keiner war überhaupt Parteigenosse je jetzt. Und wenn, ja dann natürlich nur ‚Muss‘ P.G. Ja, diese Helden. (…) Das ist schön einfach. Etwas Gift und es ist vorbei.“110
Aber immerhin – er hatte überlebt, wenn er auch um ermordete jüdische Verwandte trauerte und Jahre ohne Verbindung zu seinem emigrierten Sohn war. Sein Vermögen hatte er mittlerweile ebenso wie seine Gesundheit eingebüßt, aber die Ehe war intakt geblieben. Was blieb weiter aus der Sicht des Kaufmannes Ernst Eder übrig? Das, was einen Kaufmann schon vor 1933 auszeichnete: Unternehmerische Fähigkeiten und ein fester Wille. „Alles, was ich an Werten hatte, ist entweder zerstört oder wird keinen Wert mehr haben. Nur von dem, was ich werde verdienen können, wird meine Familie leben können. (…) Aber mein Wille war nie so hart wie jetzt. Und ich werde es schaffen.“111 Seine materielle Ausgangsposition in den ersten Nachkriegstagen unterschied sich nicht so sehr von der seiner „deutschblütigen“ Nachbarn. Aber im Gegensatz zu ihnen hatte er etwas zurückgewonnen: Männlichkeit und Handlungsfähigkeit, eine gute Ausgangsbasis für den Wiederaufbau der Firma und die Wiedervereinigung der zerrissenen Familie.
3. „Den einen Großvater habe ich unterschlagen“
Martha Kadisch, 1903 geboren, stammte von einem „volljüdischen“ Vater und einer „halbjüdischen“ Mutter englischer Herkunft ab. Sie und ihre Schwester waren mithin in der nationalsozialistischen Definition „Geltungsjüdinnen“. Der Vater starb 1926 und hinterließ seine Familie wohlversorgt. Die Töchter absolvierten das Lyzeum, besuchten danach eine Hauswirtschaftsschule und heirateten beide Anfang der 30er Jahre.112 Die kurze Ehe der Schwester mit einem höheren Beamten wurde 1935 geschieden.
Martha, die 1933 einen Sohn gebar, entschloß sich in Absprache mit ihrem „arischen“ Ehemann Erwin, die jüdische Herkunft ihrer Mutter fortan zu verschweigen. Dies schien wegen der englischen Herkunft und längerer Auslandsaufenthalte der Mutter möglich, warf aber familiäre Probleme auf: Die ängstliche Mutter fürchtete, ihre Abstammung auf amtliche Rückfragen hin nicht leugnen zu können. Zum anderen bestand die nach der Scheidung 1935 nach Hamburg zurückgekehrte Schwester aus moralischen Gründen auf wahrheitsgemäßen Angaben. Damit gefährdete sie die sorgfältige Tarnung Martha Kadischs, die darauf beruhte, daß der jüdische Vater bereits gestorben war, Mutter und Schwester schwiegen und ihr Mann das Vorgehen unterstützte. Erst als Mutter und Schwester 1939 nach England emigrierten, war die Gefahr gebannt. „Den einen Großvater habe ich unterschlagen, weil es nicht aus meinen Papieren hervorging. Aber wenn meine Schwester nicht weggegangen wäre, hätte ich das ja sagen müssen. Die hat gesagt: ‚Nein, ich tue das nicht. Sag‘ die Wahrheit.’ Und wie sie dann auswanderte, haben wir das umgedreht und habe ich gesagt: ‚Ich bin nur halb.‘“113 „Mischling habe ich ja zugegeben, das mußte ich ja. Etwas mußte ich ja zugeben. Aber das durfte ich ja auch. Halb durfte ich ja sein, weil ich einen ‚arischen‘ Mann hatte.“114
Günstig für die Familie waren die einträgliche selbständige Tätigkeit des Ehemannes als Textilvertreter, die er bis zum Kriegsausbruch ausüben konnte,115 und die Tatsache, daß Martha Kadisch Hausbesitzerin war, so daß kein Vermieter ihnen die Wohnung kündigen konnte. 1939 zur Wehrmacht eingezogen, sollte der Ehemann zu seiner Empörung 1941 als „jüdisch Versippter“ wieder entlassen werden. Seine Frau riet zur Besonnenheit:
„Ich sag: ‚Nun keine Panik. Geh‘ zu deinem Spieß.‘ Der hatte einen sehr netten Spieß. Ich sag: ‚Berede das mit ihm.‘ Er wollte gegenan gehen. ‚Das laß ich mir nicht gefallen. Ersten Weltkrieg mitgemacht. Jetzt bin ich wehrunwürdig.‘ Und da ist er zu dem Spieß gegangen. Hat der gesagt: ‚Hör mal zu, Erwin, du bringst dich ins Unglück. Das hat keinen Zweck, was du auch unternimmst. Laß es. Freu dich, geh nach Hause, genieß deine Freiheit, daß du wehrunwürdig bist.‘“116
Einsichtig geworden, konnte Erwin Kadisch fast zwei Jahre bei seiner Familie sein, bis er 1943 zur Hamburger Feuerwehr eingezogen wurde und 1944 schließlich doch noch an die Front kam.
Zwei schwerwiegende Probleme kamen in den Kriegsjahren zur zeitweiligen Abwesenheit des Ehemannes hinzu: Zum einen war Martha Kadisch es gewohnt, ihre Meinung überall lautstark und ohne Rücksicht auf mithörende Denunzianten zu verkünden, insbesondere wenn es aus ihrer Sicht um Ungerechtigkeiten ging. Zum anderen war durch ihre Tarnung als „Mischling ersten Grades“ der Sohn Peter zum „Mischling zweiten Grades“ geworden und somit berechtigt wie verpflichtet, ins Jungvolk einzutreten.
Martha Kadisch differenzierte in Momenten der Empörung kaum zwischen Gedanken und deren Äußerung vor Dritten, was sich auch in ihrer Sprachstruktur widerspiegelt. In den Assoziationsketten vermischt sie Begebenheiten, Gedanken, ihre damalige und nachträgliche Bewertung der Ereignisse und wechselt auch die imaginären Adressaten der Rede wie in der Erzählung über die häufigen Geld- oder Sachsammlungen während des Krieges:
„Dieser mein Mann, der hat den Ersten Weltkrieg mitgemacht (…) der darf kein Telefon haben?! Es ist richtig makaber. Sie hätten lieber sehen sollen, daß sie den Krieg gewinnen, statt rumzufummeln, wer Telefon haben soll oder nicht! Ist doch entsetzlich. Mit diesen kleinen Sachen haben die sich abgegeben. Aber die Rußlandkämpfer hatten kein Zeug anzuziehen! Da klingeln die eines Tages und fragen, ob ich Winterzeug hätte, ob ich Ski hätte. Ich sag: ‚Mit meinen Ski wollen Sie den Krieg gewinnen? Sie sind wohl ein bißchen bekloppt.‘ Mit diesem Kram hat er [Hitler, B.M.] sich das Genick gebrochen [gemeint: die unzureichende Ausrüstung, B.M.]. Nur, es haben so viele Menschen dran glauben müssen! Dann kamen kurz nach der Kristallnacht die Hitlerjungen und sagten: ‚Haben Sie…?‘ Ich sag: ‚Holt euch doch die Sachen aus dem Fleet wieder raus. Was wollt ihr mit meiner Zahnpastatube?‘ Wenn man das mal überlegt!“117
Solche Äußerungen – in diesem Fall vor HJ-Sammlern – zogen nicht immer Folgen nach sich, vielleicht weil Martha Kadisch die Zuhörer als „Frau aus dem Volke“ amüsierte, wenn sie mit „gesundem Menschenverstand“ auf Widersprüche aufmerksam machte. Doch als sie in einem Geschäft die Judendeportationen kommentierte, begab sie sich ernsthaft in Gefahr:
„Da habe ich zur Frau von dem Elektriker gesagt: ‚Haben Sie schon gehört, da sind auf der Moorweide wieder so viele Juden zusammengetrieben worden. Ist ja schrecklich, wenn man das so hört.‘ Kommen wir so ins Gespräch, gibt sie mir aber keine Antwort. Und inzwischen sind Kunden reingekommen, und wie ich nach Hause komme, … da ruft sie an: ‚Frau Kadisch, tun Sie mir bloß einen Gefallen. Führen Sie doch im Laden nicht solche Reden. Die hinter Ihnen waren, die haben das mitgehört. Wie Sie raus waren, haben die zu mir gesagt: ‚Geben Sie mir mal die Adresse von der Frau, die eben gesagt hat, daß sie so viele Juden auf der Moorweide zusammengetrieben haben.‘ Da habe ich natürlich gesagt: ‚Die Dame ist eine Laufkundschaft, ich kenne sie nicht.‘ So haben die das gemacht! In Geschäfte gegangen, rumgehorcht!“118
Einen anderen Vorfall schildert sie so:
„Hier hat mal einer bei mir gesessen auch, der wollte sammeln, da stand ich gerade vor der Tür, hatte unten aus dem Keller so’n paar Konserven geholt. Guckt der mich so an, sag ich: ‚Ja, ein bißchen vorsorgen muß man ja.‘ Und da kamen wir auch auf die Juden. Und da sagt er: ‚Ja, und mit den Juden, das muß man ja verstehen …‘ Ich sag: ‚Nee, nee, verstehe ich nicht. Wenn ich Ihnen jetzt Ihre goldene Uhr wegnehme, wie nennen Sie das denn? Den Juden haben sie doch alles weggenommen.‘ ‚Sagen Sie das bloß nicht so laut. Mir können Sie es ja sagen, aber sagen sie es bloß nicht so laut.‘ Man kam ja manchmal an die Richtigen. Ist doch so gewesen. Da schob er dann ab.“119
Aus den Episoden wird deutlich, daß Martha Kadisch, die keinen Kontakt zur RVJD hatte, die antijüdischen Maßnahmen sehr genau verfolgte. Wenn sie ihrer Empörung vor fremden Personen Ausdruck verlieh, suchte sie gleichzeitig immer auch heimliche Verbündete. Jedes Wort über die Ungerechtigkeit, die Juden zuteil wurde, war ein verborgenes Sprechen über die eigene Situation, der sie sich durch die Tarnung entzog. Angezeigt wurde sie dann aber schließlich nicht wegen ihrer projüdischen Äußerungen, sondern wegen Feindsenderhörens:
„Dann haben sie mich angezeigt, ich würde einen Auslandsender hören. Ich sag: ‚Ich weiß gar nicht, wie ich den hören soll.‘ Natürlich habe ich den immer gehört!
M: Wer hat Sie da angezeigt?
K: Das war wohl im Hause. (…) Wir mußten da ja Evakuierte aufnehmen. (…) Aber die haben natürlich alle gesagt, sie wären es nicht. (…) Die Nachbarn hätten einen vielleicht nicht umgebracht oder was weiß ich. Sie waren alle sehr nationalsozialistisch, alle im Schnitt.“120
Martha Kadisch kam mit einer Verwarnung davon. Trotz ihrer Forschheit muß sie sich der Gefahr, die von der nichtjüdischen Umwelt ausging, sehr genau bewußt gewesen sein. Wenn sie über die Nachbarn sagte, daß diese sie wohl nicht umgebracht hätten, so meinte sie damit, daß die Nachbarn sie oder andere Juden sicher nicht persönlich ermordet hätten. Doch sie hätten es weder zu verhindern versucht noch irgendwelche antisemitischen Reden oder Handlungen unterlassen, die unterhalb der Schwelle von körperlicher Gewalt lagen, diese aber initiieren konnten. An anderer Stelle betonte sie, „aber ich sag immer, solange sie niemanden totgeschlagen haben! Diese Nadelstiche hat man ja vergessen gegen dieses Morden.“121 Während des Krieges konnte die tödliche Gefährdung von überall ausgehen: Als Denunziation von Einquartierten, Kunden beim Kaufmann, Sammlern oder auch einfach als Provokation der Gestapo, alles schien möglich, nichts bot mehr Sicherheit.
Der Ehemann, selbst eher introvertiert, beschwor sie zu schweigen. Allerdings stellte er – was im Hinblick auf die familiäre Verarbeitung des äußeren Drucks wichtig war – nie die Berechtigung ihrer Empörung in Frage. Er zeigte auf seine stille Art dieselbe Entschlossenheit wie sie, wenn es darum ging, mit Hilfe von Tarnung, Verstellung, Falschangaben oder Desertion zu überleben. Das Paar war sich einig in folgender Einsicht: „In der Zeit mußte man ganz entschlossen sein: Entweder tot oder raus oder irgendetwas [tun, B.M.]. Nicht glauben, es kommt anders.“122
Das zweite oben benannte Problem Martha Kadischs war, dafür zu sorgen, daß der Sohn Peter nicht als Außenseiter aufwuchs, jedoch auch nicht rassistische Einstellungen der Mehrheitsgesellschaft übernahm. Dies erforderte immer wieder Balanceakte. Sie hatte dem Sohn ihre Abstammung lange verschwiegen und gleichzeitig versucht, ihm ein Gefühl der Solidarität mit Juden zu vermitteln. Antijüdischen Äußerungen wich sie in seiner Gegenwart demonstrativ aus, wenn sie diese schon nicht zurückweisen konnte:
„Mein Sohn und ich fuhren einmal mit dem Zug (…) Da ist ein Herr in Uniform, sitzt uns gegenüber, schlägt die Zeitung auf und sagt zu seiner Freundin: ‚Gott sei Dank, jetzt müssen die Juden endlich einen Stern tragen.‘ Da habe ich zu meinem Sohn gesagt: ‚Peter, komm!‘ ‚Nee, Mutti. Wir sitzen hier jetzt gerade so gemütlich.‘ Ich sag: ‚Trotzdem. Ich möchte in den Speisewagen gehen.‘
M: Haben Sie bei Ihrem Sohn nicht mal Angst gehabt, wenn der in der Hitlerjugend ist, daß es Probleme geben könnte?
K: Ja. Da habe ich zu ihm gesagt: ‚Hör mal zu, Peter, ich bin auch halb. So und so ist es. Überall sagst du Heil Hitler, wo du auch bist – nur nicht im Hause – aber in der Schule und wenn du in den Laden gehst. Sonst kriegst du nichts.‘ Das hat er mitgekriegt.
M: War das nicht zu schwer für so ein Kind?
K: Nein. Ich wollte ihm erst kein braunes Hemd kaufen. Ich sage: ‚Zieh man deine Hemden an.‘ ‚Och, Mutti, die haben alle ein braunes Hemd. Und wenn ich kein braunes Hemd habe, dann muß ich als Letzter hinterhermarschieren.‘ (…) Dann hatte meine Freundin noch ein braunes Stück Stoff, ich sag’: ‚Dann will ich es mal selber zusammenschustern.‘“123
Bei der Uniform gab sie nach, nächtliche Ausflüge hingegen verbot sie. Als der achtjährige Peter erfuhr, daß seine Mutter „Mischling“ war, hatte er aufgrund seines Aussehens bereits etliche Zusammenstöße auf dem Spielplatz, in der Schule und beim Sammeln für das Rote Kreuz erlebt, bei denen andere ihn als Juden ausgegrenzt oder zurückgewiesen hatten.124 Die Mutter versuchte, ihm die Doppelrolle zu erleichtern und ihm trotzdem Prinzipien für ein künftiges Leben mitzugeben, in dem er zwar das Notwendige einsehen und einhalten mußte, aber – wenn dies nicht mit seinen Werten übereinstimmte – keine Anpassungsleistung darüber hinaus erbringen sollte. Unterwürfigkeit war ihr ein Greuel und sollte es auch für den Sohn sein.125 In all diesen Überlegungen drückt sich noch heute das Bemühen aus, den Sohn in vielfacher Weise zu schützen, ihm ein Rüstzeug für eigene Immunität gegen nationalsozialistisches Gedankengut mitzugeben, andererseits aber auch zu verhindern, daß er in eine Abseitsposition geriet.
1943 beschloß sie, das Chaos der Großangriffe auf Hamburg nutzend, den Jungen in die Sicherheit eines ländlichen Internates in Thüringen zu bringen. Bei der Anmeldung verschwieg sie ihre Abstammung. Bis Kriegsende gelang es ihr, den Direktor damit zu beruhigen, den „Ariernachweis“ bald einzureichen. Der 10jährige bewahrte sein Geheimnis. Welche Probleme das Verschweigen mit sich brachte, wird aus dem Interview mit der Mutter nicht deutlich. Sie selbst zog in die Nähe des Internats, und lebte dort bis Mai 1945 nicht mehr als „Mischling“, sondern als „Arierin“.
Das Kriegsende vereinte die Familie wieder: Der Ehemann war desertiert und hatte sich nach Hamburg durchgeschlagen, Mutter und Sohn kehrten ebenfalls zurück. Inzwischen waren in die Wohnung Mieter eingewiesen worden, die über die Rückkehr der rechtmäßigen Besitzer alles andere als erfreut waren. Sie änderten ihre Meinung, als die britische Besatzungsmacht wegen der Abstammung Martha Kadischs das zur Beschlagnahmung vorgesehene Haus freigab.
Um ein zugunsten des Deutschen Reiches beschlagnahmtes Grundstück aus dem Erbe ihres Vaters zurückzuerhalten, mußte Martha Kadisch nach dem Krieg die jüdische Abstammung amtlich nachweisen, denn eine Enteignung aus anderen Gründen wäre zu diesem Zeitpunkt nicht erstattungsfähig gewesen:
„Da mußte ich wieder beweisen, daß ich nun doch drei jüdische Großeltern hatte. Da mußte ich den Paß von meiner Schwester aus England beantragen. Da brauchte ich eine eidesstattliche Erklärung von dem und dem und dem, daß das stimmt, weil es ja nicht aus meinen Papieren hervorging. Die haben mir nicht glauben wollen. Und ich sag: ‚Es hat in den Nürnberger Gesetzen gestanden…‘. Ja, die Nürnberger Gesetze…‘ Ich sag: ‚Ich habe die Nürnberger Gesetze.‘ Mußte ich dem Rechtsanwalt die Nürnberger Gesetze bringen, damit er die mal wieder durchliest! Da hatten sie alle plötzlich Gedächtnisschwund. Das war wirklich schon makaber.“126
Bis das Grundstück wieder der Familie gehörte und der Ehemann ein Geschäft aufgebaut hatte, ernährte Martha Kadisch die Familie, indem sie aus umgefärbten Militärmänteln Kinderkleidung nähte, die sie mit dem Stoff von Hakenkreuzfahnen fütterte.
Vergleich der Fallbeispiele
Alle drei Mischehepaare verstanden es, dem äußeren Druck miteinander standzuhalten – jedenfalls bis die Gestapo – wie bei der Familie Moser – einen Vorwand zur Kriminalisierung des jüdischen Ehemannes konstruierte. Die Diskriminierung und schrittweise Ausgrenzung der Familien erfolgte vor dem Hintergrund einer jeweils langjährigen, erfolgreichen Integration des jüdischen Ehepartners in die Mehrheitsgesellschaft vor 1933, die sich im materiellen Wohlstand dokumentierte. Dieser schirmte – in Form einer eigenen Firma, eines eigenen Hauses und Autos – die Familien auch nach der nationalsozialistischen Machtübernahme noch eine Zeitlang vor Diskriminierungen ab. In dem Maße, in dem dieser Schutz versagte, veränderten sich die innerfamiliären Aufgaben und die Repräsentation der Familien nach außen. Am schnellsten und gravierendsten läßt sich dies in der Familie Moser nachweisen. Hier fand ein partieller Rollentausch statt, indem die Ehefrau – neben den ihr verbliebenden hausfraulichen und mütterlichen Aufgaben – die traditionell männliche Außenvertretung der Familie übernahm und schließlich ihren Mann selbst vor Gestapovorladungen schützte. Die spätere Heimarbeit der Ehefrau ging mit einem sozialen Abstieg einher, dokumentiert durch Umzüge in immer kleinere Wohnungen.
In der Familie Eder verhinderte der frühzeitig durch kluge finanzielle Transaktionen gesicherte Wohlstand einen ähnlichen Prozeß. Lange allerdings hätte dieser Zustand nicht mehr aufrechterhalten werden können, da die Ressourcen dahingeschmolzen und große Teile des Immobilienbesitzes den Zerstörungen durch Luftangriffe zum Opfer gefallen waren. Der Rollentausch hingegen fand auf den ersten Blick nicht statt. Wahrscheinlicher ist aber, daß das Ehepaar über die von außen aufgezwungenen faktischen Veränderungen schwieg. Denn die Kontakte der Ehefrau zur RVJD, die Streichung des Ehemannes von der Zwangsarbeiter- und später der Deportationsliste deuten darauf hin, daß auch hier die Ehefrau die Interessen ihres jüdischen Mannes wahrte.
Martha Kadisch war zum einen durch die getarnte Abstammung, zum anderen durch ihren „arischen“ Ehemann geschützt. Ihr oblag die materielle Reproduktion der Familie ohnehin nicht. Zwar wurde der Grundbesitz aus der jüdischen Herkunftsfamilie enteignet, doch den Lebensunterhalt sicherte der Ehemann durch seine selbständige Tätigkeit. Martha Kadisch mußte erst nach dem Krieg die Familie mit ihren Näharbeiten ernähren. Während des Krieges bezog sie zeitweise den Familienunterhalt wie andere Soldatenfrauen. Diese Familie erlebte aufgrund der Tarnung der Abstammung ein Schicksal, das dem der „jüdischen Mischlinge“ ähnelte, gemildert durch die Eheschließung vor 1933 und den Hausfrauenstatus der Betroffenen. Wie in der Mehrheitsbevölkerung kennzeichneten jahrelange Trennungen (Wehrmacht und Evakuierung, Internatszeit des Sohnes) die Situation dieser Familie, wobei – ähnlich wie bei Juden oder Mischehen – die von den emigrierten jüdischen Familienmitgliedern hinzukam. Auch hier verhinderte der Hausbesitz – ähnlich wie bei Eder – Wohnraum- und Mietprobleme, wenngleich er vor Denunziationen der Nachbarn oder der Einquartierten nicht schützte.
Innerfamiliär waren in den Familien Moser und Kadisch Wut und gemeinsame Empörung über die antisemitischen Maßnahmen und die gesellschaftliche Ausgrenzung ein verbindendes Element, das die Beziehungen stabilisierte und zudem Widerstandskraft gab. In der Familie Eder hingegen war es das beharrliche Festhalten an den Konventionen der bürgerlichen Gesellschaft in der Zeit vor der nationalsozialistischen Machtübernahme, das es der Familie ermöglichte, die eigene Position abweichend von der Klassifikation durch die Machthaber zu bestimmen. Während sich die ersten beiden Paare explizit über den Verfolgungsprozeß verständigten, übernahm im dritten die Ehefrau die unauffällige psychische Stabilisierung des Ehemannes, indem sie seine innerfamiliäre Autorität stützte.
Auf die jüdischen Ehemänner hatte die Verfolgung, die sie – längst aus der Jüdischen Gemeinde ausgetreten – wieder zwangsweise zu dieser Gruppe rechnete, eine uneinheitliche Wirkung, die auch bei anderen in Mischehe lebenden Juden erkennbar wird: Während die einen eine neue Bindung an die jüdische Gemeinschaft entwickelten, hielten sich die anderen um so betonter von ihr fern. Sie wollten die Distanz vor der Umwelt dokumentieren.
Ernst Eder und seine Frau sorgten sich kaum um die Zukunft ihrer Töchter. Die bei Kriegsende jungerwachsenen Frauen schienen – zumindest nach dem Bericht ihres Vaters – keine Selbstwertprobleme oder Zukunftsängste entwickelt zu haben. Eine hatte sich sogar „verlobt“, was allerdings aufgrund der Gesetzeslage nie zu einer Eheschließung hätte führen können. Dagegen mußten Margarethe Moser und Martha Kadisch ihren sehr viel jüngeren Kindern mehr Aufmerksamkeit schenken, wuchsen diese doch erst in der NS-Zeit heran, waren mit Ausgrenzung in Schule und Nachbarschaft konfrontiert, mußten sich zur Herkunft von Mutter bzw. Vater verhalten oder erlebten gar im Jungvolk die Faszination nationalsozialistischen Jugendkults. Angesichts der Neigung von Kindern, in kritischen Phasen ihrer Entwicklung eine Disposition zu radikalen und gewaltsamen Lösungen zu entwickeln,127 mußten die Mütter Vorsorge treffen, daß ihre Kinder sich weder mit den Positionen der Verfolger noch mit dem Status der Ausgegrenzten identifizierten. Dabei beschritten sie unterschiedliche Wege: Margarethe Moser bezog ihren Sohn von Beginn an in alle Überlegungen ein und erklärte ihm frühzeitig, daß in ihrem Fall öffentliche Anforderungen von den privaten differierten. Martha Kadisch verschwieg ihrem Sohn, der vier Jahre jünger als der Margarethe Mosers war, lange Zeit die Konflikte, die sich aus ihrer und damit auch seiner Herkunft ergaben, verlangte jedoch von ihm geschärfte Aufmerksamkeit für die Verfolgung und Parteinahme für die Verfolgten. Beide Söhne aber erlebten ausgesprochen starke, couragierte Mütter, die ihre Handlungsfähigkeit nicht verloren und von ihren Ehemännern als Handelnde akzeptiert wurden.
Durch die Familie Eder ging kein Riß, der den „arischen“ vom jüdischen Teil trennte: Die „arische“ Schwiegermutter lebte nach ihrer Ausbombung bei den Kindern, die Enkelin als „Mischling ersten Grades“ zog zeitweise zur jüdischen Stiefmutter Ernst Eders, um sie zu versorgen. Zur Aufrechterhaltung der Konventionen, an denen Ernst Eder, seine Frau und seine Töchter festhielten, gehörten auch die Pflichten gegenüber der älteren Generation, gleich ob diese sich auf die jüdische oder die nichtjüdische Herkunftsfamilie bezog. Das Ehepaar Moser dagegen erlebte, wie sich der „arische“ Vater zum Nationalsozialisten entwickelte und den jüdischen Schwiegersohn ablehnte. Die Schwester dagegen half Margarethe Moser selbst bei so exponierten Handlungen wie dem Verstecken von Umzugsgut jüdischer Emigranten. Aufgrund der Tarnung Martha Kadischs ging der Riß durch die jüdische Herkunftsfamilie, es gab keine Verwandten des Ehemannes, die zusätzliche Komplikationen hätten schaffen können. Innerhalb der jüdischen Familie sorgte die verschwiegene Abstammung für Konfliktstoff. Nur die Emigration von Mutter und Schwester verhinderte eine Eskalation des Streits um die Offenlegung, die die Verwandten aus Legalismus und Angst forderten.
Die drei dargestellten Familien bewältigten den Verfolgungsdruck innerfamiliär erfolgreich, so daß die Ehen daran nicht zerbrachen. Dennoch überlebten nicht alle jüdischen Partner die NS-Zeit: Alfred Moser wurde 1943 deportiert und ermordet. Ernst Eder war von der Deportation am 14. Februar 1945 nur freigestellt. Bei länger andauerndem Kriegsverlauf hätte er trotz seiner Anpassungsleistungen mit dem „Arbeitseinsatzbefehl“ rechnen müssen. Martha Kadischs Tarnung blieb unentdeckt. Doch es bleibt fraglich, ob dies auf Dauer hätte aufrechterhalten werden können. Selbst wenn also eine „privilegierte“ Mischehe dem äußeren Druck standhielt, schützte sie den jüdischen Teil immer nur bedingt und vorläufig, so lange dieser nicht die Aufmerksamkeit der staatlichen Verfolgungsorgane auf sich zog oder Denunzianten auf den Plan rief.
III. Verstärkung des Verfolgungsdrucks ab 1942
Im Januar 1942 erörterten die Teilnehmer der Wannsee-Konferenz „im Zuge der Endlösungsvorhaben“ auch das weitere Schicksal der „Mischlinge“ sowie der 28.000 Mischehen im Reichs- und Protektoratsgebiet.128 Diese sollten in die Vernichtungspolitik einbezogen werden, doch sollte von Einzelfall zu Einzelfall entschieden werden, ob ein jüdischer Mischehepartner zu „evakuieren“ oder mit Rücksicht auf die „deutschen Verwandten“ in ein Altersghetto zu überstellen war.129 Abgesehen von der unerwünschten Öffentlichkeit, die ein solches Unternehmen gefunden hätte, wenn tausende Ehepartner mit ungewissem Schicksal getrennt worden wären, sah Staatssekretär Stuckart unendliche Verwaltungsarbeit auf das Innenministerium zukommen und forderte eine einfachere Problemlösung im Vorfeld, „daß der Gesetzgeber etwa sagt: ‚Diese Ehen sind geschieden.‘“130
Auf der ersten Nachfolgesitzung zur Konferenz zeichneten sich zwei mögliche Wege ab: Alle Mischehen – darunter wurden hier sowohl die mit „volljüdischem“ wie auch die mit „halbjüdischem“ Partner verstanden – sollten zwangsweise geschieden werden, oder aber der „deutschblütige“ Teil – respektive der Staatsanwalt – eine Scheidung beantragen. Um nach außen den Eindruck des Zwangs zu vermeiden, setzte sich der Vertreter des Propagandaministeriums für die zweite Möglichkeit ein.131 Den „deutschblütigen“ Ehegatten könnte eine Frist zur Einreichung der Klage gewährt werden, nach deren Ablauf dann der Staatsanwalt aktiv würde.132 Ein solches Vorgehen unterstützte der Staatssekretär im Reichsjustizministerium, Franz Schlegelberger: „Schließlich ist ein Festhalten des deutschblütigen Teils an der Ehe wohl nur bei älteren Ehen, die lange Jahre hindurch bestanden haben, zu erwarten.“133 In solchen Fällen sollten die „deutschblütigen“ Gatten ebenfalls im Ghetto „Aufnahme finden“.134 Doch gegen die zwangsweise Eheaufhebung meldete er gewichtige Bedenken an.135 Eine abschließende Entscheidung wurde nicht getroffen: Hitler, angerufen einen Weg zu weisen, verschob diese auf die Zeit nach dem „Endsieg“. Ein Vorstoß der Gestapo, die im März 1943 „wilde Deportationen“ von jüdischen Mischehepartnern initiierte, um die Einbeziehung in den Vernichtungsprozeß zu beschleunigen, lief ins Leere.136
Zwar erarbeitete das Innenministerium im Frühjahr 1943 mit Verweis auf den Wunsch des „Führers“, daß „Mischehen ohne weiteres geschieden werden“ sollten, einen Entwurf.137 Von den „vorhandenen rd. 19000 Mischehen würden auf die Ausnahmen rd. 4 – 5000 entfallen. Hierbei macht die Gruppe der vor 1919 geschlossenen Ehen unter ungefährer Berücksichtigung der seit 1939 erfolgten Abgänge etwa 3500 – 4000 aus“, präzisierte Innenminister Frick den Personenkreis, der von der Zwangsscheidung betroffen sein sollte.138 Doch da Hitler den Entwurf nicht entgegennahm, scheiterte der Anlauf ebenso wie ein Vorstoß der Partei-Kanzlei im Januar 1944.139 Adam weist darauf hin, daß Hitlers Verweigerung einer Entscheidung mit seinem Verbot zusammenhing, die Judenfrage öffentlich zu diskutieren. Auf dem Höhepunkt der „Endlösung“ vertraute Hitler offensichtlich darauf, daß sich „so oder so“ eine Lösung in seinem Sinne ergeben würde und daß „im Gefolge der Ausrottung eine spezielle Vorschrift zur gesetzesförmigen Regelung dieses Fragenkomplexes über kurz oder lang überflüssig werden würde.“140 Auch Hilberg bewertet die Verschonung der Mischehen als Zugeständnis der Nationalsozialisten, die zu dieser Zeit nicht den gesamten Vernichtungsprozeß durch öffentliches Aufsehen gefährden wollten.141
Während die Vertreter der einzelnen Ministerien und der Partei um die Einbeziehung der Mischehen in die „Endlösung“ stritten, versuchten die regionalen Organisationen der Reichsvereinigung, den Verfolgungsalltag der noch in Deutschland verbliebenen Juden zu regeln.142 Der Verband, der 1942/43 zur Zwangsorganisation auch für die in Mischehe lebenden Juden geworden war, wurde am 10. Juni 1943 in seiner ursprünglichen Form aufgelöst.143 Dennoch existierte er als „Neue Reichsvereinigung“ (Benz) weiter, die als „Werkzeug der Gestapo bei der Deportation und Vernichtung der deutschen Juden mißbraucht“144 wurde.
Eine Sichtung der Akten des Jüdischen Religionsverbandes und der Hamburger Bezirksstelle Nordwest der RVJD“,145 die beide von Max Plaut146 vertreten wurden, öffnet den Blick auf ein extrem vielfältiges Aufgabengebiet in den Jahren 1942 bis 1945. Der Gestapo direkt unterstellt, war sie dieser in allen Fragen berichtspflichtig und verantwortlich. Sie verhandelte mit allen Behörden, hatte nicht nur das Informationsmonopol auf die Verbreitung staatlicher antijüdischer Maßnahmen, sondern war letztlich auch für deren Einhaltung verantwortlich. Als Vollstreckerin der staatlichen Verfolgungsmaßnahmen mußte die RVJD den von diesen Maßnahmen Betroffenen oft genug Zwang androhen oder auf ihr Handlungsmonopol pochen. Immer die Abwendung der schlimmsten Bedrohungen für die Gesamtgruppe im Auge, geriet sie oft genug mit einzelnen in Konflikt oder doch in den Verdacht, gegen deren Interessen zu handeln. Da jedwede Eingaben von Juden ausschließlich über die RVJD gestellt werden mußten, war die Organisation Anlaufstelle für jedes im Verfolgungsalltag anfallende Problem. Sie vermittelte Adressen sowie Post- und Paketbestimmungen der Konzentrationslager, mußte von der Zensur retournierte Briefe zurück- oder Todesnachrichten weiterleiten wie auch die Ehepartner Inhaftierter oder Deportierter beraten.
Sowohl die Zwangsmitglieder der RVJD wie die für diese Organisation Tätigen lebten überwiegend in Mischehe, ebenso wie die als „Krankenbehandler“ praktizierenden Ärzte oder die als „Konsulenten“ tätigen Rechtsanwälte.
Innerhalb der Hamburger Behörden war die Behandlung von „Judenangelegenheiten“ inzwischen aus etlichen Ämtern in „Sonderdienststellen J.“ verlagert worden: So in der Sozialverwaltung, wenn es um Kostenübernahmen beispielsweise für Krankenhaus- und Heimkosten ging; im Haupternährungsamt, wenn es die Lebensmittelkarten betraf und beim Arbeitsamt, weil der „Arbeitseinsatz“ auch auf jüdische Männer und Frauen aus Mischehen ausgeweitet worden war. Die Behördenvertreter dieser Sonderdienststellen gingen teilweise extrem rücksichtslos mit ihrer jüdischen Klientel um.
1. Wohnraumpolitik
Eine der zentralen Aufgaben der Hamburger RVJD war die Beschaffung und Verteilung von Wohnraum in der Zeitspanne von 1942 bis 1945. Das Reichsgesetz über Mietverhältnisse mit Juden vom 30. April 1939147 hatte die Voraussetzungen geschaffen, die jüdische Bevölkerung zu isolieren, zu konzentrieren und zu ghettoisieren.148 Besonders als die alliierten Luftangriffe auf deutsche Großstädte zunahmen, wurde der Wohnraum von Juden als Manövriermasse der Sozialpolitik für ausgebombte „Volksgenossen“ betrachtet. Was scheinbar alle Mischehen in gleicher Weise betraf, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als besondere Härte gegenüber denjenigen, in denen der Ehemann als Jude galt.
In Hamburg war die RVJD bereits vor den Deportationen von 1941/42 angewiesen worden, Wohnraum von „Volljuden“ durch Zusammenlegungen freizumachen. Wer in seiner angestammten Wohnung verbleiben konnte, mußte Einquartierungen hinnehmen. Die Umgesiedelten wurden in jüdische Wohnstifte, Alters- und Pflegeheime eingewiesen. Nach den „Volljuden“ verloren die in „nichtprivilegierten“ Mischehen Lebenden ihre bisherigen Wohnungen. Die Paare, deren Männer „Sternträger“ waren, wurden in sechs „Judenhäuser“ einquartiert, die im Grindelviertel lagen, dem Hauptwohngebiet der Hamburger Juden.149 Grundsätzlich mußte sich ein Ehepaar, manchmal eine Familie ein Zimmer teilen. Diese Aktion war bis Mitte 1942 weitgehend abgeschlossen, doch das Problem der Wohnraumbeschaffung und -verteilung beschäftigte die RVJD bis zum Kriegsende: Einerseits wurden immer wieder Wohnungen für ausgebombte „Deutschblütige“ gefordert, andererseits verfügte die Reichsvereinigung durch Zwangsverkäufe von Häusern und Grundstücken über immer weniger Belegungsmöglichkeiten, bei deren Ausschöpfung sie sich obendrein noch streng an die vorgegebenen „rassischen“ Kategorien halten mußte.
Der Wohnraumverlust durch die großen Luftangriffe auf Hamburg im Sommer 1943 betraf die Mischehefamilien prozentual in derselben Weise wie die übrige Bevölkerung.150 Dennoch wirkten sich die Zerstörungen noch verheerender aus, weil die „privilegierten“ Mischehen mit jüdischem Ehemann nur bei ebensolchen untergebracht werden durften. So war der entsprechende Wohnraum bald stark überbelegt.
Zu den Mischehepaaren mit jüdischer Ehefrau hingegen quartierten die Ortsämter häufig andere Ausgebombte ein. Manchmal hatten diese auch ohne Weisungen Bombengeschädigte aufgenommen. In solchen Fällen konnte die Reichsvereinigung nicht über die Unterkünfte verfügen – und im übrigen konnte sie vor dieser Situation auch nur warnen: „Mischehen, die Arier aufgenommen haben, sollen darauf hingewiesen werden, daß wenn sie diese nicht gütlich loswerden, sie ihre Wohnung verlieren können.“151
Auch Wohneigentum schützte nicht vor Ein- und Umquartierungen: Im Oktober 1943 wurde festgelegt, daß in Eigenheime in den Außenbezirken, die einem Mischehepaar mit jüdischem Mann gehörten, ebensolche Paare eingewiesen werden dürften, Einquartierungen bei Familien mit „arischen“ Haushaltsvorstand hingegen nur dann vorzunehmen seien, wenn derselbe eingewilligt hatte. Verwitwete oder geschiedene Jüdinnen sollten bei Mischehen mit jüdischer Ehefrau wohnen. Wenn nichtjüdisch erzogene Kinder in diesen Familien lebten, sollten diese allerdings nicht von den Eltern getrennt werden.152
Im September/Oktober 1943 forderte die Gestapo Räumungen von zweimal 200 Zimmern153 trotz inzwischen hoffnungslos überfüllter „Judenhäuser“ und Privatwohnungen.154 Widersetzten sich die Bewohner oder versuchten sie, die Zuweisungen zu verzögern, so kam es durchaus vor, daß Max Plaut als Verantwortlicher der RVJD drohte: „Wir behalten uns vor, falls Sie wiederum die Erlaubnis zur Besichtigung der Wohnung ablehnen, Ihre Wohnung unserer Aufsichtsbehörde [der Gestapo, B.M.] zur Kündigung vorzuschlagen.“155
Überbelegung und Enge bei rationiertem Strom und eingeschränkter Gasversorgung schlugen sich hausintern in Streit, Nörgelei und endlosen Kämpfen um Küchen- und Badbenutzung nieder, die von der RJVD als Vermieterin geschlichtet werden mußten. Erschien ein Beauftragter der Reichsvereinigung in der Absicht, Zimmer zu vermessen, und verhielt sich dabei nicht ganz korrekt, kam es bisweilen sogar zu Handgreiflichkeiten.156 Immer wieder erhoben Mieter heftigen Einspruch gegen neue Zuweisungen in ihren Wohnraum, so daß sich die RVJD veranlaßt sah, ihnen mit Einschaltung der Gestapo zu drohen.157 Da die Betroffenen sich nicht mehr selbst an Behörden oder Entscheidungsträger wenden durften, fühlten sie sich der RVJD ausgeliefert.158
Teilweise hatten ausgebombte Juden – wie andere Bevölkerungsgruppen auch – Hamburg im Juli/August 1943 panikartig verlassen. Während ein kleiner Teil Sicherheit in der Evakuierung suchte und dort die Identität manchmal erfolgreich verbergen konnte, waren andere verunsichert, ob sie dem Arbeitseinsatz fernbleiben durften. Örtliche Stellen konnten ihnen oft keine Auskunft geben. So regelte die RVJD von Hamburg aus auch die Angelegenheiten der nun auswärts Lebenden und mußte Lösungen finden, wenn beispielsweise die Gestapo des Evakuierungsortes einen weiteren Aufenthalt nicht duldete, aber „grundsätzlich eine Rückkehr von Juden nach Hamburg unerwünscht (war), insbesondere auch von Frauen und Kindern.“159 Hatten die „privilegierten“ Mischehen in Hamburg die volle Lebensmittelzuteilung erhalten, so wollten örtliche Behörden oft nur eingeschränkte Rationen ausgeben. Die RVJD konnte aus der Ferne nur darauf hinweisen, daß diesen Familien zwar „sinngemäß“ die vollen Karten sowie Sonderrationen zustünden, mußte „jedoch raten, keinerlei Beschwerde zu erheben, da Gemeinden, die nicht ausgesprochene Aufnahmegaue für Ausgebombte sind, schon öfters auch in „privilegierten“ Mischehen lebenden Juden die Aufenthaltserlaubnis entzogen haben.“160
Wie die staatlichen Stellen hatte auch die Bezirksstelle Nordwestdeutschland der RVJD in dem Evakuierungs-, Untertauch- und Rückkehrgewirr die Übersicht über ihre Mitglieder verloren, die die Luftangriffe überlebt hatten. Um die „Judenkartei“ wieder auf den Stand zu bringen, wurden Registrierung und Lebensmittelkartenausgabe gekoppelt.161 Im Oktober 1943 notierte Max Plaut:
„Am 25. Juli 1943 waren in Hamburg karteimäßig 1257 Juden gezählt.
Von diesen sind durch die Terrorangriffe etwa 600 Juden ausgebombt.
Am 23.10.43 sind laut Kartei noch 900 Juden in Hamburg anwesend.
In dieser Zahl sind etwa 200 Juden enthalten, die vorübergehend außerhalb Hamburgs waren und zum Arbeitseinsatz zurückgekehrt sind. Sämtliche in dieser Statistik gezählten Juden sind in Mischehe verheiratet (…)“162
Der RVJD „fehlten“ also 357 Juden, die tot, vermißt oder versteckt sein konnten.163 Als hochproblematisch stellen sich rückblickend die Anstrengungen der RVJD dar, Nachforschungen nach untergetauchten bzw. versteckt lebenden Juden anzustellen, um eine neue „Judenkartei“ für die Gestapo anzufertigen. Die Beauftragten der Reichsvereinigung suchten zu diesem Zweck Vermieter auf und fragten bei Verwandten nach.164 Allerdings versuchte die Bezirksstelle Nordwestdeutschland auch, die Weitergabe von Unterlagen über einzelne Mitglieder an die Zentrale der RVJD in Berlin – und damit sozusagen ins Vorzimmer des RSHA – zu verhindern, was ihr nicht gelang. Detaillierte Fragebögen über rund 900 noch in Hamburg lebende Juden und ihre Familien wurden weitergegeben.165
Je mehr sich die Wohnraumsituation Ende 1943/Anfang 1944 zuspitzte, desto rüder wurden (notgedrungen) die Methoden der RVJD, wollte sie die Anforderungen der Gestapo erfüllen. So kündigte sie den „arischen“ Witwen nach dem Tod ihrer Ehemänner die Unterkunft, die vorher gezwungenermaßen mit ihren jüdischen Ehegatten in ein „Judenhaus“ gezogen waren.166 Angesichts des knappen Wohnraums in Hamburg und erbost über diese Behandlung, protestierten die Frauen gegen die Zwangsmaßnahmen, wenn auch nicht immer mit den geeigneten Mitteln. Eine Witwe: „Teile Ihnen ergebenst mit, daß ich mit dem heutigen Datum an den Führer Adolf Hitler geschrieben habe. Es ist noch nicht das letzte Wort in der Wohnungsangelegenheit gesprochen und ehe [nicht, B.M.] eine Antwort des Führers in meinen Händen ist, räume ich meine jetzige Wohnung nicht (…).“167 Die Gestapo wiederum drohte der RVJD bei Nichträumung der geforderten Wohnungen die Verlegung aller Mischehen in „einwandige Baracken“ bei Elmshorn an.168
Hatten die Maßnahmen 1942/43 vor allem „nichtprivilegierten“ und dann „privilegierten“ Mischehen mit jüdischen Ehemännern gegolten, so setzten ab Oktober 1944 dann verstärkt Kündigungen und Zusammenlegungen „privilegierter“ Paare mit jüdischen Frauen ein und hielten bis März 1945 an. In dieser Zwangssituation übte der zuständige Beamte des Amtes für Raumbewirtschaftung, Hubenthal, besonderen Druck aus.169 Rückblickend bewertete Max Heinemann, der als Vertreter der RVJD mit Wohnraumfragen befaßt war, das Vorgehen dieses Beamten:
„Ausführende Organe waren auf Seiten der Staatspolizei Kommissar Göttsche, später Kriminalsekretär Stephan, auf Seiten des Amtes für Raumbewirtschaftung der Beamte Hubenthal. Teils gingen die Anforderungen von der Staatspolizei aus, teils von den Beamten des Amts für Raumbewirtschaftung. Man kann sagen, daß im letzten halben Jahr bis einschließlich März 1945 durchweg der Beamte Hubenthal der treibende und drängende Teil gewesen ist, während objektiv zu bestätigen ist, daß der Kriminalsekretär Stephan vielfach bemüht gewesen ist, zu bremsen und besondere Härten abzumildern, wenigstens hat sich uns die Sache so dargestellt.“170
Neben Hubenthal besichtigte auch der Gestapobeamte Stephan171 Wohnungen, die er dann zur Kündigung vorschlug. Besonders erbittert vermerkten die Ausquartierten, daß die freigewordenen Wohnungen nach Gutdünken an Gestapobeamte, Parteifunktionäre und deren Freunde vergeben wurden, wobei selbstredend keine Raumbegrenzungen galten.172
Selbst die noch nicht in „Judenhäuser“ eingewiesenen Mischehefamilien lebten in einem Zustand permanenter Verunsicherung, weil Beamte der Gestapo, des Amts für Raumbewirtschaftung und Vertreter der RVJD regelmäßig ihre Wohnungen aufsuchten, begingen, vermaßen und verplanten. Auch drangen immer wieder Gerüchte über kleinere Deportationstransporte zu ihnen, die Personen aus aufgelösten Mischehen betrafen.
Hinzu kam die Einbeziehung der „jüdisch versippten“ Männer in den Zwangsarbeitseinsatz „Sonderkommando J“.173 Die Aktion begann offiziell im April 1944,174 für die meisten Hamburger jedoch erst ab Oktober 1944. Die einberufenen Männer wurden 1944 zum Aufräumungsamt „dienstverpflichtet“, dessen Leiter der Architekt Herbert Sprotte war. Diesem Amt oblagen Trümmerräumungen, die Beseitigung einsturzgefährdeter Ruinen und die Aufrechterhaltung von Verkehr und Versorgung. Der Arbeitseinsatz betraf in Hamburg insgesamt 1.088 Männer, von denen 197 mit Jüdinnen verheiratet waren.175 Verantwortlich war wiederum der Gestapobeamte Stephan. Eine kleine Gruppe von 67 Männern wurde „kaserniert“, d.h. in ein Lager auf dem Ohlsdorfer Friedhof eingewiesen.
Die „jüdisch versippten“ Männer hatten sich Diskriminierungen bzw. Verfolgungsmaßnahmen eher als „jüdisch versippte“ Frauen entziehen können. Aus einigen Berichten der Ohlsdorfer Lagerinsassen wird deutlich, welchen Einschränkungen sie unterlagen und welche sie nicht trafen: Einem Buchhalter wurde der Arbeitsplatzverlust angedroht, wenn er sich nicht scheiden ließe. Der private Arbeitgeber verwirklichte die Drohung jedoch nicht.176 Ein selbständiger Kaufmann, der nach dem 1. April 1933 (Boykott jüdischer Geschäfte) das Geschäft seines jüdischen Schwagers weiterführte, hatte nach Aktionen der Parteistellen Umsatzrückgänge zu verzeichnen und erhielt mit Verweis auf seine Frau keine Erlaubnis zum Wiederaufbau des Geschäftes nach der Ausbombung.177 Ein Arzt verlor die Kassenzulassung, konnte jedoch bis September 1944 praktizieren.178 Einem Schiffszimmerer wurde, während er im Lager Ohlsdorf kaserniert war, im Dezember 1944 sein Wohnhaus gekündigt.179 Waren diese Beschneidungen der beruflichen und privaten Freiheit verglichen mit denen der Familien mit jüdischen Ehemännern nicht so gravierend, so traf die Zwangsarbeiter um so härter, daß ihre Ehefrauen am 14. Februar 1945 in ihrer Abwesenheit deportiert wurden.
Diese als „auswärtiger Arbeitseinsatz“ bezeichnete Deportation der jüdischen Männer und Frauen aus Mischehen war auch eine der letzten Aufgaben, die die Hamburger Bezirksstelle der RVJD organisatorisch zu bewältigen hatte. Auf Anordnung des RFSS sollten nunmehr alle arbeitsfähigen, in Mischehe lebenden Juden und Jüdinnen einschließlich der „Geltungsjuden“ nach Theresienstadt überstellt werden. Als Konsequenz aus der unerwünschten Aufmerksamkeit, die die Berliner „Fabrik-Aktion“ erregt hatte, sollte bei dieser Deportation darauf geachtet werden, daß Personen, deren Abtransport „eine gewisse Unruhe“ hervorrufen konnte, ausgenommen blieben.180 Um die Illusion eines „auswärtigen Arbeitseinsatzes“ aufrechtzuerhalten, fanden ärztliche Untersuchungen statt. Die Frauen und Männer, die danach als nicht arbeitsfähig frei- oder zurückgestellt wurden, erhielten ihre Lebensmittelkarten von Schallerts Sonderdienststelle J. zurück.181 Von den auf mehreren Listen verzeichneten Männern und Frauen wurden nach Frei- und Rückstellungen 128 Männer und 66 Frauen deportiert. 11 Männer und 10 Frauen waren nicht erschienen. Wenn die Befreiung nicht krankheitsbedingt war, resultierte sie daraus, daß Söhne oder Ehemänner bei der Wehrmacht dienten, Frauen schwanger waren, Kleinkinder zu versorgen hatten oder Männer reklamiert wurden.182 Die 194 Deportierten überlebten bis auf vier Personen diesen späten Transport und konnten im Sommer 1945 nach Hamburg zurückkehren.183
2. Die Verhaftungsaktion 1943
Am 27. Februar 1943 wurden in Berlin, Breslau, Dresden und anderenorts Juden verhaftet, die in der Rüstungsproduktion Zwangsarbeit leisteten.184 Die „deutschblütigen“ Ehefrauen und Verwandte der Berliner „Rüstungsjuden“ protestierten lautstark und öffentlich in der Berliner Rosenstraße, wo die Inhaftierten untergebracht waren. Ein vom Historiker Wolf Gruner erst kürzlich gefundener Gestapo-Erlaß erhellt das Geschehen. In dem Dokument wurde für Ende Februar 1943 eine reichsweite Groß-Razzia angekündigt: Nachdem die im „Altreich“ lebenden Juden fast ausnahmslos umgesiedelt worden seien, wollte das RSHA nunmehr „sämtliche noch in Betrieben beschäftigten Juden zum Zweck der Erfassung aus den Betrieben entfernen“, vor allem „die in Mischehe lebenden Juden.“185 In der Reichshauptstadt waren jedoch entgegen den Anordnungen die Mischehepartner nicht nur erfaßt, sondern ebenso wie andere Juden verhaftet worden, die aufgrund von Sonderregelungen noch im Altreich verbleiben durften. Während diese deportiert wurden, brachte die Gestapo die Mischehepartner und internierten „Mischlinge“ in Gebäuden der Jüdischen Gemeinde in der Rosenstraße unter. In dieser Straße kam es in den folgenden Tagen zu lautstarken Protesten der „deutschblütigen“ Ehefrauen und anderer Verwandter.186 Die ungefähr 1.700 in Mischehe lebenden Berliner wurden freigelassen. In der Forschungsliteratur wurde diese einmalige Protestaktion der Frauen bisher als Lehrbeispiel dafür gewertet, daß öffentliche Gegenwehr die verantwortlichen nationalsozialistischen Institutionen sehr schnell zum Zurückweichen gezwungen hätte. „Der erfolgreiche Ausgang des öffentlichen Protestes legt die Vermutung nahe, daß ähnliche Aktionen den Kurs der nationalsozialistischen Judenpolitik in andere Bahnen hätten leiten können“,187 urteilt beispielsweise Konrad Kwiet. Der amerikanische Historiker Nathan Stoltzfus geht noch einen Schritt weiter, wenn er in seiner Abhandlung über den Protest in der Rosenstraße gar die Möglichkeit erörtert, die Transporte in die Vernichtungslager hätten generell gestoppt werden können, hätten die Deutschen gegen die Isolierung der Juden protestiert und die politischen Kosten so weit in die Höhe getrieben, daß die Machthaber zurückgewichen wären.188 Gruner, gestützt auf den Gestapo-Erlaß, hält solchen Argumenten entgegen, daß die Deportation dieser Männer gar nicht beabsichtigt gewesen war, sondern nur eine Registrierung. Insofern hätten die Ehefrauen und „deutschblütigen“ Verwandten offene Türen eingerannt.189 Dies mindert zwar die Zivilcourage der Beteiligten keineswegs, lenkt aber den Blick vom vermeintlichen Erfolg mehr auf den Protest selbst.
Die Verantwortlichen für die Verhaftungen, allen voran Goebbels, der in seiner Eigenschaft als Gauleiter von Berlin die Aktion vorangetrieben hatte, beabsichtigten – nachdem sie auf den „Endlösungskonferenzen“ gescheitert waren – die Einbeziehung der Mischehen in die Vernichtungspolitik nun gleichsam „von unten“ zu initiieren. Ihr Vorgehen ähnelte dem in den besetzten Ostgebieten: Lastwagen fuhren vor und transportierten tagsüber in aller Öffentlichkeit die in Zwangsarbeit stehenden Juden ab.190 Doch die Geheimhaltung war mißlungen, etliche Arbeitgeber hatten von der Aktion Kenntnis erhalten und die Zwangsarbeiter gewarnt, so daß ca. 4.000 entflohen waren. Zudem befanden sich ungewöhnlich viele Angehörige der Eliten, besonders aus „Künstlerkreisen“, unter den Betroffenen.191 Erst dieses Zusammenspiel, so vermutet der Historiker Christof Dipper, hätte den Berliner Protest bewirkt.
Goebbels selbst zeigte sich wenig beeindruckt:
„Die Verhaftungen von Juden und Jüdinnen aus privilegierten Ehen hat besonders in Künstlerkreisen stark sensationell gewirkt. Denn gerade unter Schauspielern sind ja diese privilegierten Ehen noch in einer gewissen Anzahl vorhanden. Aber darauf kann ich im Augenblick nicht übermäßig viel Rücksicht nehmen. Wenn ein deutscher Mann es jetzt noch fertigbringt, mit einer Jüdin in einer legalen Ehe zu leben, dann spricht das absolut gegen ihn, und es ist im Kriege nicht mehr an der Zeit, diese Frage allzu sentimental zu beurteilen.“192
Allerdings zog das RSHA aus dem Protest bei späteren Deportationen – wie weiter unten ausgeführt – die Konsequenz, Personen, deren Abtransport Unruhe erwarten ließ, vorerst zurückzustellen.
Auch in Hamburg kam es zu Verhaftungen, die im Zusammenhang mit der „Fabrik-Aktion“ standen. Im Februar 1943 nahm die Gestapo siebzehn jüdische Ehemänner fest, die mehrheitlich in „privilegierten“ Mischehen lebten, darunter den ehemaligen Modehausbesitzer Benno Hirschfeld. Kriminalkommissar und SS-Hauptsturmführer Claus Göttsche, Leiter des „Judenreferats“ der Staatspolizeileitstelle Hamburg, hatte zuvor Willibald Schallert, den Leiter der „Sonderdienststelle J.“ beim Arbeitsamt Hamburg, Dienststelle Sägerplatz, angewiesen, eine Personenliste unter dem Titel „Jüdische Sabotage am Arbeitseinsatz“ zu erstellen. Daß es sich um eine „Berliner Aktion“ handelte, erfuhren die Ehefrauen der Verhafteten, als sie bei der Gestapo nach Verbleib und künftigem Schicksal ihrer Männer fragten. „Ihr Mann kommt nach Auschwitz, tun Sie man jetzt schon so, als wenn sie keinen Mann mehr haben“, antwortete Schallert einer hilfesuchenden Ehefrau. Einer anderen riet er, sich nicht weiter zu bemühen, ihr Mann käme nicht mehr wieder, aus Auschwitz käme keiner zurück. Auf seinen Karteikarten hatte er zu diesem Zeitpunkt schon „Auschwitz“ vermerkt.193
Der jüngste Verhaftete war 45, die meisten zwischen 50 und 60, der älteste 67 Jahre alt. Er unterlag dem Zwangsarbeitseinsatz für Juden damit altersmäßig gar nicht mehr. Allerdings wurden parallel zum Vorgehen gegen die Mischehen zwischen Jahresende 1942 und dem offiziellen Auflösungsdatum der RVJD, dem 10. Juni 1943, die Berliner Mitarbeiter der Organisation deportiert. Den Hamburgern wurde dasselbe Schicksal angedroht.194 Zwei der Deportierten arbeiteten tatsächlich ehrenamtlich beim Jüdischen Religionsverband bzw. der RVJD und könnten aus diesem Grund auf die Liste gelangt sein.195 So flossen in der Hamburger Aktion offensichtlich zwei Motive zusammen: Die Helfer der RVJD zu beseitigen und einen Angriff auf die „privilegierten“ Mischehen zu starten. Die Betroffenen vermuteten schnell, daß es der Gestapo nicht nur um die Beseitigung bestimmter Personen, sondern auch um das übergeordnete Ziel ging, die „privilegierten“ Mischehen schrittweise in die Deportationen einzubeziehen.
Die Angehörigen und die Verhafteten, denen keine Begründungen mitgeteilt wurden, erklärten sich den Vorgang meist damit, daß ihr Name wegen persönlicher Differenzen mit Willibald Schallert oder aufgrund von Denunziationen auf die Liste geraten war. Der einzige Überlebende der Gruppe, Rudolf Hamburger, sagte nach dem Krieg aus, sein Meister habe ihn kurz zuvor der Gestapo gemeldet, weil er den Kollegen geraten habe, ihre Pflicht zu tun, aber nicht mehr als nötig zu arbeiten, das verlängere nur den Krieg.196 Daraufhin hätte Schallert ihn als Querulanten auf die Liste gesetzt. Aus den Aussagen der Ehefrauen im Prozeß gegen Schallert nach Kriegsende werden die Erklärungsversuche der Häftlinge bzw. ihrer Frauen deutlich: Einen Mann hatte Schallert zu Besprechungen grundsätzlich in Lokale beordert, die er als Jude gar nicht hätte betreten dürfen. Schallert bestellte sich dort auf die Lebensmittelmarken von dessen Ehefrau Speisen. Dieser Inhaftierte vermutete, jemand habe den Lokalbesuch angezeigt. Außerdem wußte er um Schallerts sexuelle Kontakte zu Jüdinnen. Ein anderer schließlich erklärte sich seine Verhaftung damit, daß Schallert einer Frau seinen Posten in der Kleiderkammer des Jüdischen Religionsverbandes verschaffen wollte, ein weiterer war in Bereicherungsaktionen Schallerts eingeweiht und glaubte, ein Mitwisser sollte beiseite geschafft werden. Einige Männer sahen im Gestapoquartier einen Vermerk auf ihrer Akte: „Hat durch sein Verhalten bewiesen, daß er nicht länger im jüdischen Arbeitseinsatz belassen werden kann“.197 Die Aussagen des Überlebenden und der Ehefrauen vor den Ermittlungsbeamten geben keinen Aufschluß über die Hintergründe der Aktion, die den Betroffenen nicht bekannt waren. Sie zeugen vor allem davon, daß Menschen in Verfolgungssituationen versuchen, sich die Vorgänge, denen sie mehr oder weniger willkürlich ausgeliefert waren, aus einer Einzelfallperspektive zu erklären und ihnen einen „Sinn“ zu unterlegen, der aus ihrem persönlichen Verhalten resultiert oder aus der Beziehung zu Verantwortlichen hergeleitet ist.
In Hamburg ging die Gestapo – anders als in Berlin – in pseudolegaler Weise vor: Die Männer erhielten Aufforderungen, sich bei der Gestapo zu melden, andere waren einzeln unauffällig abgeholt worden. Die Aktion erstreckte sich auf zwei Tage und betraf in erster Linie ehemals selbständige Kaufleute, die zwar in Hamburg relativ bekannt waren, nicht aber Verbindungen zu einflußreichen Gruppierungen hatten. Die individuellen Bemühungen ihrer Angehörigen, die – wie aus dem folgenden hervorgeht – ebenso wie die der Berliner Protestlerinnen – aus „elementarer Familiensolidarität“ (Stoltzfus) resultierten, waren weder aufsehenerregend noch erfolgreich. Dipper verweist auf zeitgleiche Verhaftungen in Darmstadt, die ebenfalls nicht in einen öffentlichen Protest mündeten.198 Auch dort waren die Verantwortlichen anders als in Berlin vorgegangen: Sie verteilten die Verhaftungen der zwölf jüdischen Ehemänner aus „privilegierten“ Mischehen auf den Zeitraum März bis Mai 1943. Den Arretierungen waren jeweils einzelne Anzeigen von Seiten des SD oder des RSHA vorausgegangen. Der Leiter des Darmstädter „Judenreferats“ hatte angeblich von seinem Vorgesetzten die Auskunft erhalten, daß „aufgrund einer neuen Weisung gegen die jüdischen Partner in Mischehen unbegrenzte Lagerhaft beantragt werden könne“.199 Er wurde – wie Schallert auch – nach dem Krieg wegen dieser Verhaftungen angeklagt und der schweren Freiheitsberaubung im Amt für schuldig befunden.
Die meisten Hamburger Verhafteten wurden am 1. oder 2. März 1943 in das Konzentrationslager Fuhlsbüttel eingewiesen und verblieben dort bis Ende April/Anfang Mai 1943.200 Ein Mann wurde freigelassen, einer „verstarb“ noch in Fuhlsbüttel, einer konnte fliehen, als er in einem Außenkommando arbeitete. Die restlichen Männer wurden in kleinen Transporten nach Auschwitz gebracht. Keiner überlebte das Vernichtungslager. Sie starben im September und Oktober 1943, einzig Benno Hirschfeld überstand die Haft bis kurz vor Kriegsende. Er stand mit seiner Familie im schriftlichen Kontakt, der über den Jüdischen Religionsverband bzw. die RVJD abgewickelt werden mußte.201 Sohn und Ehefrau unternahmen mehrere nicht ganz ungefährliche Versuche, seine Freilassung oder wenigstens Hafterleichterungen zu erreichen.202 1944 wandte sich der Sohn, der als Ingenieur in einem kriegswichtigen Betrieb arbeitete, mit einer Eingabe – erfolglos – an Göring. Den Vater rettete er damit nicht, sondern wurde im Betrieb gemaßregelt:
„Ich bin (…) furchtbar von dem Leiter des Personalbüros angeschnauzt worden, wie ich dazu käme, einen Antrag zu stellen und ein Schreiben an den Generalfeldmarschall Göring, den ich nämlich seinerzeit gebeten hatte, es sei so unvereinbar für mich als Mensch auf der einen Seite – ich habe bewußt jetzt folgende heuchlerische Worte gewählt – ‚für das Großdeutsche Reich in einem Rüstungsbetrieb Flugmotoren zu schaffen und nach bestem Gewissen zu bauen und einzufahren auf den Prüfständen und kann es nicht begreifen, daß man einem ehrwürdigen Vater, der eine korrekte deutsche Familie hat …‘– Ich habe diese Worte wählen müssen, um auch in der Dialektik [gemeint ist: Diktion, B.M.] dieser Leute zu sprechen – ‚in ein KZ sperrt und bitte augenblicklich gnädigst, ihn aus diesem Lager zu entlassen. Schließlich sind wir seine Familie, und ein Verbrechen ist ihm nicht vorzuwerfen. Ich bitte hiermit, diesem Antrag und diesem Gesuch wohlwollendst stattzugeben.‘“203
Nach diesem Fehlschlag fuhren Mutter und Sohn persönlich nach Auschwitz in der Hoffnung, vor Ort etwas zu erreichen:
„Ich selber bin einmal, es muß im Jahre 1944 gewesen sein, in einer Blitzaktion mit meiner Mutter von Berlin (…) mit einem Zug ganz schnell nach Oberschlesien bis nach Liegnitz gefahren, also letzte Station vor Auschwitz, den Rest mit der Straßenbahn mit einem Riesenpaket mit der Hoffnung, daß ich irgendwo vielleicht doch am Lagertor einen Kontakt mit meinem Vater aufnehmen kann. Das war eine irrsinnig mutige – wenn ich es heute sage – und vermessene Aktion, aber sie ist wahr. Ich sehe heute noch das riesenhafte Lager vor mir und diese riesenhafte Eisenbahnbrücke, die über die gesamten gebündelten Eisenbahngleise hinwegging, die alle in Richtung Osten nach Krakau und Lodz führten. Auf dieser Brücke begegnete mir ein Trupp KZ-Häftlinge in der typischen KZ-Kleidung mit bewaffneter SS, so daß die alle natürlicherweise guckten, was die beiden Zivilisten, meine Mutter und ich, auf dieser Brücke wollten. Aber ich ging mit einem Paket zum nächsten Lagertor (…) und fragte, ob es eine Möglichkeit gäbe, daß ich meinen Vater sprechen könnte: Ich sei in einem Rüstungsbetrieb tätig und müßte ja nun doch mal einmal Guten Tag sagen dürfen, ich hätte hier ein Paket für ihn. Ich habe das sehr höflich gesagt, habe hinzugefügt: ‚Schießlich bin ich ja ein Flugmotorenbauer, alles, was hier oben fliegt, das baue ich, und Ihr müßt ja mal irgendwo Einsehen haben.‘ Ich habe erstaunlicherweise keine Ablehnung, kein Grinsen, noch irgendwie eine barsche Anfeindung erlebt, sondern ich habe eine sehr sachliche Entgegennahme dieses Paketes erfahren können. Es hat mich wahnsinnig gewundert. Man hat mir versprochen, daß dieses Paket auch an meinen Vater ausgehändigt werde. Ich habe gesagt: ‚Selbstverständlich dürfen Sie das in seiner Gegenwart kontrollieren. Es ist nichts Verwerfliches darin.‘ Das haben wir fertiggebracht! Wir haben uns danach angeguckt und haben gesagt: ‚Und das ist die Reise schon wert gewesen, daß wir dieses Paket hier abgegeben haben.‘“204
Tatsächlich hätte diese Reise beide in große Schwierigkeiten bringen können. Vielleicht hat jedoch gerade das ungewohnt selbstsichere Auftreten der Bittsteller die beiden vor den üblichen Reaktionen der SS-Wachmannschaften, Einschüchterung und der Demonstration absoluter Machtbefugnisse, gerettet. Der Vater soll sogar das Paket bekommen und dies schriftlich bestätigt haben. Gegen Ende des Krieges wurde er mit anderen Häftlingen in das KZ Buchenwald transportiert, wo er kurz vor der Befreiung erschossen wurde.
Der Sohn eines anderen Verhafteten, Dennis Berend, damals 16 Jahre alt, erinnert sich genau an die Reaktionen seiner Mutter auf die Verhaftung des Vaters. Seine Beobachtungen werfen ein Schlaglicht auf die Ohnmacht und Hilflosigkeit der meisten Ehefrauen:
„Und auf dem Küchentisch liegt ein Zettel – ich habe den lange aufbewahrt, jetzt existiert er nicht mehr – von meiner Mutter, ganz hastig hingekritzelt: ‚Vati ist abgeholt worden. Ich bin hinterhergefahren. Ich komme wieder, sobald ich kann.‘ Also irgendwann hatte es an der Tür geklingelt, und sie haben ihn abgeholt. Meine Mutter ist mit der Straßenbahn hinterhergefahren, weil man ihr sagte, wo er hinkommt, in die Rothenbaumchaussee. Hat ihn aber nicht zu sehen gekriegt. Sie haben meiner Mutter den Eintritt verweigert. Sie kam wieder nach Hause, natürlich in Tränen. Am nächsten Tag ist sie wieder hingegangen, da hat sie ihn zu sehen bekommen, mit ihm gesprochen. Sie hat erzählt, wie er versucht hat – unter den Augen der Gestapo natürlich – ihr irgendeinen Hinweis zu geben: ‚Geh‘ zu Schallert, geh’ zu Schallert.’ Mehr konnte er nicht sagen. Sie sagte, er war ein Wrack, nervös und aufgeregt. Das kann man verstehen. Er wußte ja, wo er war. Aber das war das letzte Mal, wo einer von uns ihn wenigstens gesehen hat. Meine Mutter natürlich hat das ganze Leben lang daran gedacht: Was wollte er ihr sagen? Und hätte das was genützt oder nicht. So hatte sie die zwei Lasten, die eine, daß sie sich geweigert hatte zu emigrieren, und die andere, daß sie vielleicht hätte was tun können, wenn sie nur verstanden hätte, was er ihr sagen wollte.“205
Die Ehefrau konnte Alfred Berend nicht helfen. Nun suchte der ältere Sohn, zu dieser Zeit noch Soldat der deutschen Wehrmacht,206 die Gestapo in Uniform auf:
„Mein Bruder ging rein und war zehn Minuten später wieder da, leichenblaß in seiner Uniform, und sagte, man hätte ihn – erstmal hat er die Worte gar nicht rausgekriegt, der war so aufgeregt – … einfach rausgeschmissen und ihm gedroht, wenn er nicht sofort verschwindet, kommt er nicht mehr raus. Seine Uniform würde ihm nichts nützen. Und das hatte er nicht erwartet … Er glaubte, sie würden sagen: ‚Oh, entschuldigen Sie. Wir haben einen Fehler gemacht. Hier ist Ihr Vater.‘ So ging es nicht. Nur das haben wir da erst gemerkt.“207
Der Schock über die Erkenntnis der absoluten Rechtlosigkeit saß tief und bestimmte (nicht nur) bis zum Kriegsende das Verhalten der Familienmitglieder. Hinzu kamen, zumindest bei der Mutter, Schuld- und Versagensgefühle, die – nach Aussagen ihres Sohnes – selbst nach dem Auftritt als Zeugin im Nachkriegsprozeß gegen Schallert nicht verschwanden. Der inzwischen siebzigjährige Sohn, nach dem Krieg in die USA ausgewandert, arbeitet immer noch an der Aufklärung dieses letzten Kapitels der Familiengeschichte.208
Andere Angehörige zeigten den Mut der Verzweiflung. Während eines Besuches im KZ Fuhlsbüttel hatte der bereits erwähnte Alfred Moser seine Ehefrau darauf vorbereitet, daß ein Mithäftling, Rudolf Hamburger, eventuell fliehen und sie aufsuchen würde. Dieser gehörte zu einem Außenarbeitskommando für die Firma Hugo Stolzenberg & Co und nutzte eine Gelegenheit zu entkommen. Hilfesuchend wandte er sich zunächst an Verwandte, die ihn abwiesen, und dann an die Ehefrauen der Mitverhafteten. Die unvorbereitete Frau Berend half ihm trotz großer Angst mit Zivilkleidung aus, Margarethe Moser nahm ihn auf:
„Ich habe nur die Tür aufgemacht – und das werde ich nie vergessen und ihm in die Augen [gesehen], ich kannte ihn ja nicht – da sage ich: ‚Sind Sie Herr Hamburger?‘ ‚Ja.‘ ‚Sind Sie geflohen?‘ ‚Ja.‘ ‚Haben Sie gut gemacht.‘ Habe ich mir gar nichts bei gedacht. Und dieses: ‚Das haben Sie gut gemacht‘, … hat er mir am nächsten Morgen erzählt: ‚Bei meinen ganzen Verwandten habe ich gehört: ‚Was hast du bloß gemacht, Rudi. Hier nimm meine Freßkarten, mein letztes Geld. Alles sollst du haben, aber Rudi, geh! Geh!‘ Und ich habe die Tür aufgemacht und habe gesagt: ‚Das haben Sie gut gemacht.‘“209
Unwissentlich hatte Margarethe Moser mit ihrer Begrüßung eine wichtige psychologische Hilfestellung gegeben, die Rudolf Hamburger über den Schock hinweghalf, daß bis dahin solidarische Verwandte (seiner nichtjüdischen Frau) durch die Verhaftung offensichtlich so abgeschreckt waren, daß sie ihm Hilfe verweigerten. Eine Woche versteckte Margarethe Moser den Entflohenen in der kleinen 2-Zimmer-Wohnung, in der sie auch ihre Kundinnen für die in Heimarbeit geschneiderten Kleidungsstücke empfing. Der Sohn verständigte unauffällig die Ehefrau Hamburgers, die ein nächstes Versteck bei einem sozialdemokratischen Tischler organisieren konnte, das bis zu den großen Luftangriffen auf Hamburg Schutz bot. Danach nutzte er die Evakuierungen, um Hamburg Richtung Osten verlassen zu können. Nach Kriegsende kehrte er zurück und gründete ein Fuhrunternehmen. Im Verfahren gegen Willibald Schallert trat er, der einzige Überlebende der Aktion, als einer der wichtigsten Belastungszeugen auf. Margarethe Moser hingegen erhielt im Dezember 1943 über die Reichsvereinigung die Nachricht vom Tod ihres Mannes.210
3. Porträt: Der „Judenkommissar“ – Willibald Schallert
Willibald Schallert, der die „Arbeitssaboteure“ auf die Verhaftungsliste der Gestapo gesetzt und damit ihren Tod in Auschwitz verschuldet hatte, wurde am 2. April 1896 in Berlin-Charlottenburg geboren.211 Sein Vater war Lagerist gewesen, er selbst erlernte nach dem Besuch der Volksschule den Beruf des Schaufensterdekorateurs, den er später allerdings nie ausübte. Während des Ersten Weltkrieges meldete er sich freiwillig zur Marine, danach kämpfte er in einem Freikorps im Baltikum.212 Er erlitt eine Schußverletzung und zog sich 1916 in der Türkei Malaria zu. Dennoch müssen diese Jahre von 1914 bis 1921, in denen er weit herumkam und in „Männerbünden“ für eine „gerechte Sache“ kämpfen konnte, sehr prägend gewesen sein. So prägend, daß er sich nicht von den Erinnerungsstücken an diese Zeit trennen mochte und in den folgenden Jahren zweimal wegen „Aufbewahrung von Kriegsgerät“ zu kleineren Strafen verurteilt wurde.213 1921 nach Deutschland zurückgekehrt, lebte er in Altona und versuchte sich als Werftarbeiter, Hausdiener und Geschäftsführer in einem Restaurant. Taxifahrer, Kellner und Schuhmacher soll er ebenfalls gewesen sein. Von 1930 bis 1933 war er erwerbslos.214 Er hatte bis dahin in keinem Beruf Fuß fassen können, nie umfassende Kenntnisse in einem Arbeitsgebiet erworben, nie langfristig Verantwortung übernommen, nie das Rollenverständnis eines Dienstboten, Angestellten oder gar das eines Amtsinhabers entwickelt. Gleichwohl muß er die Fähigkeit besessen haben, schnell mit Menschen in Kontakt zu kommen und im fremden Arbeitsgebiet zu improvisieren.
Daß der Beginn seiner Erwerbslosigkeit mit dem Eintritt in die NSDAP (Mitglieds-Nr. 341.597) und die SA zusammenfiel, ist sicher kein Zufall.215 Bis 1933 verbrachte er seine Zeit vor allem in SA-Gruppen, wo er bis zum Sturmführer aufstieg.216 Die rauhe, alkoholgetränkte Geselligkeit und die unkonventionellen, allenfalls militärisch ausgerichteten Verkehrsformen der Männer untereinander, auch die Einheit von Dienst und Freizeit ließen die Kriegs- und Freikorpserfahrungen wieder aufleben. Gewohnheiten aus dieser Zeit legte Schallert auch später nicht ab. Beispielsweise erschien er häufig in SA-Uniform im Arbeitsamt, obwohl er seit Jahren vom aktiven Dienst der Formation befreit war.217
Im August 1933 zahlte sich das Engagement in der braunen Bewegung aus: Über das Sonderprogramm für „Alte Kämpfer“ der NSDAP erhielt Schallert eine Stelle beim Arbeitsamt Altona als Außendienstmitarbeiter, später als Sachbearbeiter. Als solcher wäre der 37jährige, der keinerlei Verwaltungserfahrungen aufweisen konnte, zu anderen Zeiten nie eingestellt worden. 1939 zog die Marine ihn ein, stellte ihn aber schon nach einem halben Jahr im Januar 1940 dem Arbeitsamt wieder zur Verfügung. Dort übernahm er nun die Leitung des Arbeitseinsatzes für Juden, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehr umfangreich war: Er betraf nur erwerbslose Juden, die Erd-, Meliorations- (Bodenverbesserung) oder andere beschwerliche Arbeiten verrichten mußten.218
Im Mai 1940 wurde Schallert zum Leiter des Arbeitsamtes Ozorkow berufen, einer Nebenstelle des Arbeitsamtes „Litzmannstadt“ im Gau Wartheland. Dort warb er Arbeiter für den Einsatz im „Altreich“ an. Was der Beginn einer steilen Karriere hätte werden können, endete aufgrund eines Zwischenfalls bei nächtlichen Sauftouren „nur“ als kurzer Ausflug in den Osten: Im betrunkenen Zustand legte Schallert, der bewaffnet war, auf einen polnischen Kneipengast an. Zwar war der Schuß nicht tödlich, doch erregte dieser Vorfall unliebsames Aufsehen, das dem Gaugericht Wartheland gemeldet wurde. Schallert wurde nach Hamburg zurückbeordert. Ab 1. Januar 1941 arbeitete er wieder beim Arbeitsamt Hamburg. Im April desselben Jahres verurteilte ihn das Hanseatische Sondergericht zu drei Monaten Gefängnis wegen versuchter Tötung, die gleichzeitig auf dem Gnadenwege erlassen wurden. Schallert hatte den Vorfall auf einen Malariaschub zurückgeführt und Trunkenheit geltend gemacht.219 Verurteilungen von SA-Leuten mußten dem Verband gemeldet werden, und dieser leitete in der Regel ein Ausschlußverfahren ein. So stellte die SA-Gruppe Hansa am 17. Juni 1942 beim Gericht des obersten SA-Führers den Antrag, Schallert „wegen Ungeeignetheit“ aus der SA zu entlassen.220 Schallert trat am 15. August 1942 aus.221
Seinen Dienst im Arbeitsamt beeinträchtigten weder die Vorstrafe noch der SA-Austritt. Sein Arbeitsgebiet hatte sich im Gegenteil erheblich ausgedehnt, denn der Arbeitseinsatz für Juden war auf Männer zwischen 14 und 65 und Frauen zwischen 15 und 55 Jahren erweitert worden.222 Bis auf Kinder und Greise mußten alle Hamburger Jüdinnen und Juden bei Schallert registriert werden. Die kleine Dienststelle war disziplinär, aber nicht fachlich dem Arbeitsamt unterstellt.223 Ein untergeordneter Mitarbeiter erledigte die anfallende Arbeit, während Schallert nur selten am Schreibtisch anzutreffen war. Der „Judenkommissar“, wie er sich nun gern nennen ließ, stolzierte in seiner braunen Uniform lieber durch die Wohngebiete der Juden, suchte sie am Arbeitsplatz auf oder inspizierte das jüdische Krankenhaus. Die RVJD mußte ihre Karteien mit seinen Daten abgleichen, so daß er über den Aufenthalt jeder Person stets auf dem laufenden war.224 Auch andere Verwaltungsarbeiten übernahm die Reichsvereinigung, so beispielsweise die Beschaffung von Fahrtausweisen für die im Arbeitseinsatz beschäftigten Männer.225 Die Arbeitseinsätze stimmte er im persönlichen Gespräch mit dem Leiter des Judenreferats Claus Göttsche ab,226 dem er regelmäßig Listen über Firmen, Arbeitseinsätze oder -befreiungen zu erstellen hatte. Von der Gestapo erhielt er auch die Todesmeldungen aus den Konzentrationslagern zur Berichtigung seiner Kartei. Die von der letzten Deportation aus Hamburg frei- und zurückgestellten Personen erhielten von seiner Dienststelle ihre eingezogenen Lebensmittelkarten zurück.227
In der Gestapo-Dienststelle ging er ein und aus wie in der eigenen.228 Einen einzuhaltenden Dienstweg zur Klärung anstehender Probleme gab es für ihn ebensowenig wie den Weg über das Vorzimmer Göttsches. Schallert konnte jederzeit zu Besprechungen erscheinen und regelte die Angelegenheiten – wie es ihm lag – von Mann zu Mann ohne großen Schriftverkehr. Seine Kontaktfähigkeit und das Improvisationsvermögen bewährten sich auch hier. Sein Verhältnis zu Göttsche muß das eines Kumpels gewesen sein, der selbstverständlich zu dessen Dienstjubiläumsfeier eingeladen wurde.
Die zum Arbeitseinsatz verpflichteten Jüdinnen und Juden machten mit ihm sehr unterschiedliche Erfahrungen: Selbstherrlichkeit und Leutseligkeit wechselten in rascher Folge, Anbiederung und vertrauliche Mitteilungen schlugen in unverhüllte Erpressungen um. So befragte er einen Juden, ob dieser Schallplatten besitze und forderte ihn dann auf, die umfangreiche Sammlung in seinem Privathaus abzuliefern.229 Er eignete sich vom Gasboiler bis zum Fahrrad alle möglichen Gegenstände an, die bei Hausbesuchen seine Begehrlichkeit geweckt hatten.230 Frauen bedrängte er sexuell, wenn er sie überraschend in ihren Wohnungen besuchte. Anderen stellte er bei Gefälligkeit Arbeitserleichterungen in Aussicht. Unter den von ihm abhängigen Juden sprach sich dieses Verhalten schnell herum: Einerseits erweckte es große Angst, denn Schallert konnte ohne jede übergeordnete Instanz schalten und walten – und die Gestapo stellte keine Kontrollinstanz dar, die gegenüber Juden auf das Einhalten von Regeln pochte. Andererseits erwuchs aus dem Wissen um seine Bestechlichkeit die Möglichkeit, sich Erleichterungen im Arbeitseinsatz zu verschaffen, von einer „Evakuierungsaktion“ zurückgestellt oder bei einem „Vergehen“ nicht gemeldet zu werden. Auch die Reichsvereinigung nutzte die Tatsache, daß man bei Schallert „mit Geld etwas machen (könne)“, um über ihn als „Zwischenträger“ (Plaut) gezielte Informationen zur Gestapo gelangen zu lassen.231
Die Gerüchte um Schallerts Bestechlichkeit besagten auch, daß es keineswegs nur auf große, wertvolle „Geschenke“ ankam. Dies deutete darauf hin, daß er neben materiellen Bedürfnissen, die er befriedigte, gleichzeitig seine Macht demonstrierte, indem er wie ein Fürst Gaben entgegennahm: Wein, aber auch Zigaretten, Zigarren, Kunsthonig, Marzipan, Fett oder anderes. Etliche legten ihm ihre „Gaben“ über Jahre regelmäßig unaufgefordert auf den Schreibtisch. Meist arrangierte er dann die „Gefälligkeit“, um die er sich trotzdem unterwürfigst bitten ließ. Ging es um Arbeitserleichterungen, sicherte er sich durch Atteste ab, wobei er dem Amtsarzt vorher telefonisch das gewünschte Ergebnis der Untersuchung durchgab.232
War eine Person zur „Evakuierung“ bestimmt, so konnte es geschehen, daß Schallert sie vorher zu Hause aufsuchte und den Besitz in Augenschein nahm. Die Betroffenen wußten, daß es für zurückbleibende Verwandte günstiger war, ihm den begehrten Gegenstand „spontan zu schenken“, denn Schallert galt als rachsüchtig und nachtragend, wenn jemand ihm nicht zu Gefallen war. Frauen, die ihm ausweichen wollten und die Unterkunft wechselten, liefen Gefahr, wegen Nichteinhaltung der Meldepflicht bestraft zu werden. In Gespräche streute der „Judenkommissar“ kleine Hinweise darauf ein, daß er Herr über Leben und Tod war.233
Allein materielle „Geschenke“ reichten ihm oft nicht, zunehmend forderte er mehr als Unterwerfung. Er wollte Freundschaft oder gar Liebe. Hatte er diese bekommen, ließ er die betreffenden Personen fallen. Eine Frau, die er zum Geschlechtsverkehr gedrängt hatte, wurde von ihrer nichtjüdischen Zimmernachbarin wegen „Rassenschande“ denunziert.234 Obwohl Schallert namentlich genannt war, ging gegen ihn niemand vor – hier schützten die guten Beziehungen zu Göttsche. Die Frau hingegen war einem Kesseltreiben ausgesetzt, bis sie schließlich Selbstmord beging. Schallert hatte für sie keinen Finger gerührt. Auch nach dem Krieg wies er jede Mitverantwortung an dem Freitod weit von sich.
Wie aus den Beispielen deutlich wurde, suchte Schallert die räumliche wie emotionale Nähe zu den von ihm abhängigen Personen und forderte immerfort persönliche Bestätigung. Er war maßlos und gefährdete mit dieser Maßlosigkeit sich und andere. Jeder „Schutz“, den er gewährte, konnte – mit dem entsprechenden Paragraphen wie beispielsweise „Rassenschande“ oder „Korruption“ belegt – auch zur tödlichen Bedrohung werden. Darüber hinaus pflegte er den privaten Verkehr mit Mischehepaaren235 – ohne dabei auf die regelmäßigen Zuwendungen zu verzichten.
Für Personen, die Schallert bestachen, und sich ansonsten von ihm fernhielten, war die von Schallert ausgehende Grenzverletzung deutlich. „Gehe nie zu deinem Ferscht [gemeint: Fürst, B.M.], wenn du nicht gerufen werscht“, war die Devise dieser Juden.236 Für diejenigen jedoch, die eine solche „Freundschaft“ eingingen, verwischten sich auch nach dem Krieg Fragen nach Freiwilligkeit, Schuld und Täterschaft völlig.237
Schallert war überzeugter Nationalsozialist. Seine Gesinnung hatte ihm die zum Schluß mit 325 RM dotierte Stellung eingetragen238 und ihm eine Machtposition verschafft, die er in Friedenszeiten ohnehin nie und als Arbeitsamtsleiter im Osten nur vielleicht erreicht hätte. Die Leitung des Arbeitseinsatzes entsprach seinen Fähigkeiten: Sie war nicht in Verwaltungsabläufe eingebunden, konnte im Gespräch mit Gestapo und Verpflichteten geregelt werden, erforderte immer neue Improvisation und verschaffte ihm Freiräume in der Arbeitszeitgestaltung.
Zu Juden hatte Schallert ein sehr eigenartiges Verhältnis. Die Zeit als Leiter des Arbeitseinsatzes ermöglichte ihm umfassende Bedürfnisbefriedigung auf Kosten der Juden: Was immer er Begehrenswertes sah, es würde ihm gehören, wenn er es denn wollte. Die zum Arbeitseinsatz Verpflichteten sicherten nicht nur seinen Arbeitsplatz, sondern versorgten ihn mit Essen, Trinken, Tabak, Sex sowie mit Zuwendung und Bestätigung, von denen er offensichtlich nie genug bekommen konnte.239 Hinzu kam, daß er in der Hamburger Gesellschaft der 20er Jahre aus Gründen des sozialen Gefälles mit etlichen von ihnen nicht hätte verkehren können. Während der NS-Zeit hatten sich die Vorzeichen geändert: Sie waren sozial sehr tief abgestiegen, ihn hatten günstige Zeitumstände in eine Position gelangen lassen, die ihm Macht über sie gab. Ein Antisemit im Sinne einer tiefgehenden Ablehnung der Juden war Schallert nicht. Aber daß er wegen seiner Freundschaft zu Juden in der SA kritisiert worden sei, wie er nach 1945 geltend machen wollte, und deshalb die SA verlassen hatte, war eine bewußte taktische Lüge.
Am 9. Juli 1945 wurde er wegen seiner NSDAP-Mitgliedschaft entlassen und kurz darauf (mit Hilfe eines vorher von ihm erpreßten Juden) verhaftet. Es folgten zehn Monate Internierung in Neuengamme. Aus gesundheitlichen Gründen wieder in Freiheit, handelte er nun mit Textilien, seine Frau verdiente mit Heimarbeit hinzu.240
Ein erstes, seit 1947 geführtes Ermittlungsverfahren wurde 1948 eingestellt.241 Zwar gab es jüdische und nichtjüdische Belastungszeugen, aber kaum Personen, die über Zuständigkeiten und Abläufe Angaben machen konnten. Gestapobeamte hatten – wie Göttsche und Mecklenburg – Selbstmord begangen oder waren – wie Wohlers – unauffindbar.242 Max Plaut, der als Vertreter der Reichsvereinigung mit der Gestapo, aber auch mit Schallert zu tun hatte, lebte noch in Israel.243 Erst im zweiten Anlauf konnte das Verfahren 1950 vor dem Schwurgericht beim Landgericht Hamburg eröffnet werden. Obwohl Schallert jede Schuld vehement abstritt und beispielsweise die Erstellung der Verhaftungsliste vom Februar 1943 einer Angestellten der jüdischen Gemeinde zuordnete, fügten sich die Beweise nun zusammen.244 Auch ein Schlaganfall mit „völligem Gedächtnisverlust“ Schallerts und ein ärztliches Attest über progressive Paralyse245 (Endstadium der Syphilis, Gehirnerweichung) verhinderten nicht, daß ihn das Gericht wegen „Unmenschlichkeitsverbrechen“ zu einer Zuchthausstrafe von 3 1/2 Jahren und der Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte für fünf Jahre verurteilte.246 Er hatte im übrigen kein Bedauern oder gar Trauer über den Tod derer gezeigt, die er auf die Verhaftungsliste gesetzt hatte. Er selbst lebte bis zu seinem Tod am 9. September 1961 in einem kleinen schleswig-holsteinischen Ort.247
Willibald Schallert verkörperte einen nationalsozialistischen Tätertypus, der sowohl vom Schreibtischtäter als auch vom ideologischen Überzeugungstäter unterschieden werden muß. Der Schreibtischtäter hätte die räumliche und erst recht die emotionale Nähe zu Juden vermieden, sondern vom Dienstzimmer aus die Arbeitseinsätze geplant. Ein ideologischer Überzeugungstäter hätte den Antisemitismus im Arbeitsalltag durch Schikanen, Überwachungen oder Strafsysteme in die Praxis umgesetzt. Schallert, der Schreibtisch wie Schriftverkehr mied, suchte hingegen die Nähe der ihm Ausgelieferten. Aber er wollte sie nicht als Juden erniedrigen oder vernichten, sondern dachte ausschließlich in personalen Beziehungen, die ihm aus der Kameraderie der NS-Bewegung vertraut waren und die der Stabilisierung seiner Persönlichkeit dienten. Er benutzte die Jüdinnen und Juden als ein geradezu unerschöpfliches Reservoir für seine Bedürfnisse. Er konnte sie gebrauchen, austauschen und entfernen. Dabei verletzte er über Jahre Gesetze, Regeln und politische wie „rassische“ Prinzipien. Es ist bezeichnend für die Struktur des nationalsozialistischen Herrschaftssystems, daß jemand, der gegen grundlegende Normen so offensichtlich verstieß, dennoch unangefochten in dieser Machtposition verbleiben konnte, weil jegliche Kontrollinstanzen abgeschafft worden waren.
Schallert und die Gestapobeamten handelten den Mischehefamilien gegenüber als „die“ Vertreter des NS-Regimes. Dies wird vor allem aus den Interviews mit „Mischlingen“ deutlich. Für die Repräsentanten der RVJD bedeutete Schallerts Bestechlichkeit die Gewißheit, ihren Mitgliedern Erleichterungen verschaffen zu können. Sie war ein durchaus positives Moment. Was bedeutete es aber für die einzelnen Verfolgten, wenn ein Mann wie Schallert mit Macht über Leben und Tod ausgestattet war? Mit Schallert trat ihnen ein Amtsinhaber entgegen, der sich weder von antisemitischen Ideen leiten ließ noch sich die Pflicht zur buchstabengetreuen Umsetzung reichsweiter Anordnungen auferlegt hatte. Er führte seine Anweisungen nicht erbarmungslos aus, sondern war scheinbar auf einer Beziehungsebene erreichbar. Er hatte Verständnis, hörte zu, bedachte die persönliche Situation der Bittsteller, verschaffte Erleichterungen und lud Auserwählte sogar zum Kaffee ein. Daß all dies seinen Preis hatte, sprach sich schnell herum. Viele waren notgedrungen bereit, den Gegenwert zu zahlen, zumal Schallert diesen ihren persönlichen Verhältnissen anpaßte. Letztlich blieben den Abhängigen nur zwei Verhaltensmöglichkeiten: Entweder sie hielten strikt Distanz – mit allen Komplikationen, die aus einer Kränkung Schallerts entstehen konnten – oder sie waren ihm zu Willen. Im zweiten Fall verwischte sich für sie langfristig die Scheidelinie zur Verfolgerseite. Freundschaft, Sexualität, Dankbarkeit und Unterwerfung mit Dauerangst im Hintergrund über Jahre zu bieten, war ohne innere Beteiligung und ohne Auswirkung auf das Selbst- und Weltbild kaum möglich.
IV. Scheidungen von Mischehen
1. Das Eherecht im Nationalsozialismus
Die eheliche Gemeinschaft hatte nach Auffassung der Nationalsozialisten in erster Linie der „Volksgemeinschaft“ zu dienen und deren Fortbestand in erbgesundheitlicher sowie „rassischer“ Hinsicht zu sichern. Aus dieser Perspektive war es nach der Machtergreifung dringend geboten, bereits bestehende Mischehen aufzuheben bzw. – wenn dies aus politischen Rücksichten nicht möglich war – deren Auflösung auf Antrag des nichtjüdischen Partners erheblich zu erleichtern. Bis zur Verabschiedung des Ehegesetzes von 1938, das entsprechende Paragraphen enthielt, trieben nationalsozialistische Juristen eine Wandlung der bisherigen Rechtsprechung sowohl „von unten“ wie auch „von oben“ voran: Auf der unteren Ebene präjudizierten die Kammergerichte in ihren Urteilen und deren Veröffentlichung in den entsprechenden juristischen Zeitschriften eine weitgehende Auslegung bisher anders definierter Paragraphen des Bürgerlichen Gesetzbuches. Auf der „oberen Ebene“ wurde um die Formulierung eines einheitlichen Familienrechts gestritten, das als neuer Gesetzeskomplex rassisch-völkische Kriterien (nicht nur) in das Scheidungsrecht einführen sollte.
Die Versuche, die Rechtsprechung „von unten“ zu radikalisieren, setzten am §1333 BGB an, der eine Anfechtung der Ehe zuließ, wenn sich ein Gatte in der Person des anderen oder über dessen persönliche Eigenschaften geirrt hatte, die ihn, in Kenntnis der Sachlage, von einer Heirat abgehalten hätten. Bis 1933 war damit allerdings nicht die „rassische“ Zugehörigkeit einer Person gemeint. Zudem konnte ein Irrtum nur binnen sechs Monaten nach seiner Aufdeckung geltend gemacht werden, und wer die Ehe mündlich, schriftlich oder durch Geschlechtsverkehr bestätigte, verlor sein Anfechtungsrecht nach den §§1339 und 1337 BGB. Nationalsozialistische Richter definierten nun die Zugehörigkeit zur „jüdischen Rasse“ als „persönliche Eigenschaft“. Da aber kaum ein Scheidungswilliger behaupten konnte, diese sei ihm jahrelang verborgen geblieben, wurde dieser „Irrtum über die Person“ durch den „Bedeutungsirrtum“ ergänzt: Erst durch Aufklärung nach der nationalsozialistischen Machtübernahme hätte die Bedeutung des Irrtums erkannt und geltend gemacht werden können, was wiederum die Anfechtungsfrist auf die Zeit nach dem 30. Januar 1933 verschob.248 Später wurde die Anfechtungsfrist auf eine „angemessene Zeit“, deren Anlaufdatum noch bestimmt werden mußte, erweitert.249
Diese Auslegung stieß nicht auf die Zustimmung aller Juristen, forcierte aber reichsweit Urteilsbegründungen der Kammergerichte, die sich auf einzelne Teile oder die Gesamtargumentation bezogen, bis Roland Freisler, zu diesem Zeitpunkt Staatssekretär im Justizministerium, in einer Stellungnahme vor „Anarchie“ und einer „Sprengung des Staates“ durch Richter warnte, die eine entsprechende Gesetzgebung nicht abwarteten.250 Marius Hetzel, der jüngst eine rechtshistorische Arbeit zur „Anfechtung der Rassenmischehen“ vorlegte, in der er unveröffentlichte Urteile aus den Jahren 1933 bis 1939 auswertet, bezeichnet die Rechtsprechung folgerichtig als ambivalent.251
Auch die Vorbereitung des am 6. Juli 1938 verkündeten „Gesetzes zur Vereinheitlichung des Rechts der Eheschließung und der Ehescheidung im Lande Österreich und im übrigen Reichsgebiet“252 war von jahrelangen Auseinandersetzungen gekennzeichnet. Bereits am 26. Juni 1933 hatte Hans Frank253 die Akademie für Deutsches Recht ins Leben gerufen, deren Familienrechtsausschuß, ein hochkarätig besetztes wissenschaftliches Diskussionsgremium, über eine zukünftige Rechtsprechung nachdachte. Der Ausschußvorsitzende, Ferdinand Mößmer, definierte die Ehe als „Lebensgemeinschaft zweier rassegleicher, erbgesunder Personen verschiedenen Geschlechts zum Zweck der Wahrung und Förderung des Gemeinwohls (…) und der Erzeugung rassegleicher, erbgesunder Kinder und ihrer Erziehung zu tüchtigen Volksgenossen.“254 Von diesem Zweck ausgehend sollten sich Scheidungen nicht mehr am Schuldprinzip, sondern am Zerrüttungsprinzip orientieren. War die Ehe so zerrüttet, daß das „rassegleiche“ Paar keine Kinder mehr erzeugte, sollte sie geschieden werden. Damit wurde der individualistisch-liberale Kern des Zerrüttungsprinzips in sein Gegenteil verkehrt, es drohte „zum Instrument der Entmündigung der Eheleute (…) gegenüber dem familienpolitischen Generalplan eines totalitären Staates“255 zu werden. Das Justizministerium, geleitet von Franz Gürtner, geriet durch die Vorlage der Akademie in Handlungszwang. Der ehemals deutschnationale Minister wollte Wesen und Bedeutung der Ehe nicht verringern und auf keinen Fall im Bewußtsein der Volksgenossen die grundsätzliche Unauflöslichkeit verwischen.256 Er fürchtete zudem die Ausbeutung staatlichen Rechts durch Egoismen. Hitler, vorab um seine grundsätzliche Meinung zum Scheidungsrecht gebeten, plädierte für eine „Mittellinie“.257 Der erste, 1937 vom Justizministerium vorgelegte Entwurf öffnete sich dem Zerrüttungsprinzip nur minimal: Nur wenn die Ehepartner wenigstens fünf Jahre getrennt gelebt hatten, sollte dieses – ohne das Verschulden zu prüfen – als Scheidungsgrund gelten. Vermutlich hätten die Beratungen noch längere Zeit beansprucht, wenn nicht der „Anschluß“ Österreichs die Verabschiedung des neuen Gesetzes beschleunigt hätte. Die Vereinheitlichung der konfessionsbeherrschten, äußerst zersplitterten Rechtslandschaft Österreichs wurde mit einer Neuregelung des Scheidungsrechts in Deutschland verknüpft. Hitler intervenierte persönlich, um Unfruchtbarkeit als Scheidungsgrund zu etablieren (Kinderlosigkeit hingegen nicht) und die Möglichkeit zu schaffen, auch beim Scheidungsgrund Ehebruch eine spätere Ehe einzugehen. Das neue Gesetz hielt zwar am Ehehindernis Ehebruch fest, aber nur bei mangelnder Erbgesundheit oder zu großem Altersunterschied.258 Zur Trennung von „Rassenmischehen“ wurde der politische §37 EheG geschaffen, die Aufhebungsklage aus „rassischen“ Gründen. Im weiteren kombinierte das Ehegesetz Verschuldens- und Zerrüttungsprinzip: Bei Ehebruch (§47 EheG), Verweigerung der Fortpflanzung (§48 EheG) und anderen schwerwiegenden Eheverfehlungen (§49 EheG) galt das Schuldprinzip. Hinzu kamen „eugenische“ Scheidungsgründe.259 Neu waren die §§Unfruchtbarkeit (§53 EheG) und „Auflösung der häuslichen Gemeinschaft“ (§55 EheG). Die im Entwurf noch geforderten fünf Jahre Trennung waren auf drei reduziert worden. Danach galt die Ehe als so zerrüttet, daß ihre Wiederherstellung entsprechend dem „Wesen der Ehe“ nicht erwartet werden konnte. Die Nichtigkeitserklärung einer Ehe – beispielsweise bei einer nach den Nürnberger Gesetzen verbotenen Eheschließung – galt im Gegensatz zur Aufhebung rückwirkend.260 Zum Teil hatten „generalklauselartige unbestimmte Rechtsbegriffe“ wie „das Wesen der Ehe“, das im Gesetz nicht definiert wurde, Eingang in das neue Eherecht gefunden,261 die den Richtern große Freiräume ermöglichten.262
Bezogen auf die Aufhebung von Mischehen zeichnete sich die Rechtsprechung der Instanzgerichte nach dem neuen Ehegesetz durch großzügige Anwendung des §37 EheG (Bedeutungsirrtum) aus, dessen Frist sie auch 1939 noch nicht als abgelaufen ansah. Das Reichsgericht präzisierte 1940 seine Rechtsprechung zu Mischehen dahingehend, daß es nun die Aufhebung stets für sittlich gerechtfertigt hielt und zwar auch dann, wenn der „jüdische“ Teil kein „Volljude“ war.263 Es wies zudem auf die Möglichkeit hin, Mischehen nach dem §55 EheG (Zerrüttung) unproblematisch zu scheiden – in juristischer Terminologie: Diese Ehen genossen geringen Bestandsschutz, weil die Volksgemeinschaft kein Interesse an ihrer Aufrechterhaltung hatte.264 Dennoch entwickelte der Zerrüttungsparagraph in der Praxis nicht die Schärfe eines „schrankenlos wütenden Nazi-Paragraphen“ (Blasius), der er nach Intention seiner rassenhygienisch und bevölkerungspolitisch denkenden Befürworter hätte werden sollen.265
Die Teilnehmer der Wannsee-Konferenz 1942 hatten sich nicht auf eine gesetzliche Vorgabe zur Zwangsscheidung der Mischehen einigen können. Somit galt das Ehegesetz von 1938 bis zum Kriegsende. „Die gerichtliche Auflösung deutschjüdischer Mischehen kann, da besondere gesetzliche Vorschriften hierüber bisher nicht ergangen sind, nur auf der Grundlage der Vorschriften des Ehegesetzes über die Eheaufhebung und Ehescheidung stattfinden“,266 bedauerte der Justizminister 1944 und wies darauf hin, daß kein geschiedener Ehemann seiner jüdischen Frau die Weiterführung des Namens versagen könne. Da das Drängen der Rassenpolitiker auf neue Instrumentarien zur Trennung der Mischehen von seiten des Gesetzgebers nicht erfüllt wurde – so meine im folgenden ausgeführte These –, suchten Richter und Gerichte ihre eigenen Lösungen, radikalisierten die Rechtsprechung also „von unten“, wie sie es zwischen 1933 und 1938 schon einmal praktiziert hatten.
Die aus Deutschland emigrierten Mischehepaare stellten den Gesetzgeber vor Sonderprobleme. Waren sie beispielsweise nach Frankreich, in die Niederlande oder in die östlichen Nachbarländer ausgewandert, wurden sie dort von den deutschen Truppen und den nachfolgenden Zivilverwaltungen eingeholt. Während diese einheimische Mischehen zumeist wie Juden behandelten, zeigten sie bei der Behandlung der Mischehen mit einem „deutschblütigen“ Partner Unsicherheit. So wies das Auswärtige Amt für die westlichen besetzten Länder darauf hin, daß diese Ehepaare und bei ihnen lebende Kinder ausgebürgert werden, d.h. wie staatenlose Juden behandelt werden sollten. Bei getrennt lebenden Paaren sollte Scheidung „angestrebt“ werden.267
Der Oberlandesgerichtspäsident von Kattowitz, Reichsgau Wartheland, wählte einen einfacheren Weg, als er im Februar 1943 an die Landgerichtspräsidenten schrieb:
„Seit dem Sommer 1942 sind im größerem Umfang von der Geheimen Staatspolizei früher im hiesigen Bezirk ansässig gewesene Juden ausgesiedelt worden. Sie haben zum Teil in Mischehen mit Deutschblütigen gelebt. Es ist damit zu rechnen, daß – wie es in mehreren Fällen bereits geschehen ist – die zurückgebliebenen arischen Ehefrauen in zunehmenden Maße Klage auf Ehescheidung erheben werden, ohne jedoch häufig zur Begründung etwas anderes vorbringen zu können, als daß der Beklagte als Jude das Reichsgebiet habe verlassen müssen. Es dürfte nicht nur im Interesse des arischen Eheteils, sondern auch der Allgemeinheit liegen, daß diese Mischehen alsbald gelöst werden.“268
Im Gegensatz zu den Regelungen in den besetzten Niederlanden hatte die Existenz einer („privilegierten“) Mischehe in Kattowitz keinen Schutz vor der Deportation geboten. Es ging nicht darum, die „deutschblütigen“ Partner vor der Deportation zur Scheidung zu bewegen, um diese durchführen zu können, sondern nur darum, die zwangsweise vollzogene Trennung post festum rechtlich zu fixieren. Deshalb schlug der Oberlandesgerichtspräsident den Landgerichten eine klare Rechtsbeugung vor. Sie sollten den §55 des Ehegesetzes anwenden, auf die darin vorgeschriebene dreijährige Trennungszeit hingegen verzichten:
„Wenn der Gesetzgeber beim Ehegesetz den Fall einer Aussiedlung von Juden und anderer ähnliche Fälle, in denen Trennung, gleichviel ob freiwillig oder erzwungen, von vornherein als eine dauernde sicher zu erkennen ist, vorausgesehen hätte, dann hätte er von dem Erfordernis der dreijährigen Trennung abgesehen. (…) Unter den augenblicklichen Kriegsverhältnissen soll man nicht abwarten, (…) sondern jetzt schon durch entsprechende Gesetzesauslegung helfen.“269
Das Justizministerium selbst verwies darauf, daß Regelungen ausstünden270 und ließ den Gerichten damit immense Spielräume.
Nach der Besetzung Polens wandten die dort eingesetzten Gerichte ohne formelle Einführung das deutsche Eherecht zur Auflösung deutsch-polnischer Mischehen an, das die Richter aber zu sehr an Kriterien band, um „den völkischen Belangen in jedem Fall die ihnen gebührende Beachtung zu verschaffen.“271 Deshalb wurde ein Scheidungsentwurf ausgearbeitet, der diese „Belange“ berücksichtigte: Die künftige Schließung deutsch-polnischer Mischehen wurde per Gesetzesakt verboten. Für bereits bestehende Ehen wurden „Scheidungserleichterungen“ ausgearbeitet, nach denen ohne Schuldprüfung einem Scheidungsbegehren des „deutschblütigen“ Partners stattgegeben werden sollte. Diese Regelung erstreckte sich ausdrücklich auch auf „Deutschblütige“, die vor der Besetzung Polens dort oder in Danzig mit einem jüdischen Partner verheiratet waren.272
Die hier nur ausschnitthaft dargestellte Scheidungspraxis der Gerichte in den besetzten Gebieten bedarf dringend weiterer Forschungen. Aber selbst über die Scheidungspraxis im „Altreich“ ist letztlich wenig bekannt. Während die Strafjustiz aufgrund ihrer Instrumentalisierung und der inneren Radikalisierung Gegenstand von Untersuchungen geworden ist,273 blieb die Ziviljustiz weitgehend unbeachtet. Obwohl der große Spielraum, den das Ehegesetz von 1938 den Richtern gab, in der juristischen wie auch in der historischen Literatur hervorgehoben wird, fehlt es bis heute an einer Auswertung der tatsächlichen Rechtsprechung, die sich nicht nur auf einzelne publizierte Fälle der Instanzgerichte stützt, sondern die Scheidungs- bzw. Aufhebungspraxis für Mischehen im zeitlichen Längsschnitt untersucht, wie es in dieser Arbeit am Beispiel der Urteile des Hamburger Landgerichtes geschehen soll.
Marius Hetzels Untersuchung über die Rolle der Ziviljustiz gibt immerhin Aufschluß über die Anfechtungsmöglichkeiten der Mischehen bis 1938. Hetzel kommt zu der Schlußfolgerung, daß die Rechtsprechung, anfangs an unterschiedlichen Maßstäben orientiert, in der NS-Zeit mit zunehmender Dauer immer radikaler und immer stärker vom Wunsch geleitet wurde, solche Ehen zu trennen.274 Der Jurist Reginald Puerschel wies für Hamburg anhand etlicher Entscheidungen aus den Jahren 1933 bis 1939 nach, daß bis zur Neufassung des Eherechts die Rechtsprechung hinsichtlich der Anfechtung von Mischehen nicht einheitlich war:275 So wurden Klagen abgewiesen, während andere Richter über „rassisch“ motivierte Entscheidungen des Reichsgerichts hinausgingen. Bei einigen Klagen war zwar die Anfechtung nicht erfolgreich, wohl aber ein alternativer Scheidungsantrag. Aus den von Puerschel untersuchten Urteilen276 ergibt sich das Bild einer Gemengelage aus Rechtsunsicherheit, Bemühungen um Radikalisierung der Auslegungen oder Festhalten am Althergebrachten. Eine große Bandbreite traditioneller Entscheidungen mit geschlechtsspezifischen Argumentationen stand Urteilen gegenüber, die rassistisch begründet oder als „Rechtsprechung contra legem“ einzuordnen waren.277
Doch Puerschel wie Hetzel untersuchen die Anfechtungspraxis lediglich für jene Zeitspanne, als die Judenverfolgung in Deutschland vom Ziel der Auswanderung und Vertreibung bestimmt war. Sie blenden die Zeit nach der Einführung des neuen Ehegesetzes weitgehend aus. Dieses fixierte mit dem §37 die vormalige Anfechtung nun als Aufhebung erstmals rechtlich und hätte eine einheitliche Rechtsprechung ermöglicht, zu der es jedoch nicht kam. Inzwischen hatte sich die Situation der Mischehen ebenfalls geändert: Sie waren nun in „nichtprivilegierte“ und „privilegierte“ unterschieden worden. Der jeweilige Status sorgte für Rück- bzw. Freistellung von den Deportationen, die ab Herbst 1941 anliefen. Eine Scheidung erhielt damit ab Ende 1941, als die Emigration nicht mehr möglich war und die Deportationen bereits angelaufen waren, eine neue Dimension: Sie konnte für den jüdischen Partner tödlich enden, weil sie dessen Einbeziehung in die Vernichtungspolitik bedeutete.
Hinzu kommt, daß die Aufhebungsverfahren nur einen kleinen Teil – nach meiner Auswertung der Hamburger Urteile ungefähr ein Viertel – der Scheidungsprozesse darstellten. Die Mehrheit der scheidungswilligen Mischehepartner reichte die Klage – ebenso wie Angehörige der Mehrheitsbevölkerung – wegen (oder unter dem Vorwand) der Verletzung ehelicher Pflichten ein. Erst wenn dieser vermeintlich unpolitische Bereich der Rechtsprechung ebenfalls zum Gegenstand der Auswertung wird, ergibt sich ein Gesamtbild der Zivilrechtsprechung bezogen auf Mischehen im NS-Staat.
2. Judenverfolgung und Geschlechterrollen im Spiegel der Scheidungspraxis bei Mischehen
Als Puerschel Anfang der 1990er Jahre die Rechtsprechung der Landgerichte Hamburg und Altona in Ehe- und Familiensachen von 1933 bis 1939 untersuchte, beinhaltete das Archiv des Landgerichts Hamburg „die fast komplette Überlieferung der Entscheidungen (…) aus der Zeit des Dritten Reiches.“278 1995 war dieser Bestand bereits erheblich durch Kassation reduziert. Dennoch gelang es, insgesamt 130 Scheidungs- oder Aufhebungsurteile für die folgende Auswertung zu erschließen, die überwiegend aus den Jahren 1938 bis 1945 stammen.279
Die 130 Scheidungs- bzw. Aufhebungsurteile sollen vor einer inhaltlichen Auswertung zunächst quantitativ aufgeschlüsselt werden. Die im Anhang abgedruckten Tabellen 1 bis 5 geben darüber detailliert Auskunft. Bei der Mehrheit der geschiedenen Mischehepaare war der Mann der jüdische Teil: 103 Männer gegenüber nur 27 jüdischen Ehefrauen. Dies bedeutet nicht nur, daß sich der höhere Anteil der Ehen mit jüdischem Ehemann im Scheidungsanteil widerspiegelt, sondern daß diese Ehen darüber hinaus weit häufiger geschieden wurden. Gab es – gemessen an der von Lippmann für Hamburg angegebenen Zahl der Mischehen von 972 im Jahr 1940 fast doppelt so viele Mischehen mit jüdischem Ehemann wie mit jüdischer Ehefrau (623:349), so wurden diese Ehen fast vier Mal häufiger geschieden als Ehen mit jüdischen Ehefrauen.
Auffällig an der zeitlichen Verteilung der Scheidungen ist zunächst, daß die Zahl der Anträge zwischen 1938 und 1943 kaum abfällt.280 Erst 1944 sinkt sie deutlich. Die Gesamtzahl der Mischehescheidungen zwischen 1933 und 1938 ist nicht bekannt. Bisher wurde – ohne zeitliche Differenzierung – davon ausgegangen, daß im „Altreich“ insgesamt 7-10% der Mischehen geschieden wurden.281 Es ist aber zu vermuten, daß – bedingt durch den sozialen Abstieg, den die Judenverfolgung gerade in den ersten sechs Jahren nach der nationalsozialistischen Machtübernahme verursachte – die Anzahl der Scheidungen in diesem Zeitraum wesentlich höher zu veranschlagen ist als die hier für den Zeitraum 1938 bis 1945 erfaßten Urteile. Selbst wenn berücksichtigt wird, daß die Scheidungsrate in der Stadt Hamburg höher als im übrigen Reich lag,282 muß wohl entgegen den bisherigen Annahmen von einer Scheidungsrate von über 20% ausgegangen werden.283
Aus der Tabelle 2 wird deutlich, daß der §37 EheG (Aufhebung) keineswegs der dominierende Scheidungsparagraph war. Er wurde lediglich in ungefähr einem Viertel der Verfahren angewendet. Fast die Hälfte der Paare hingegen wurde nach dem §49 EheG geschieden, der unterschiedliche Formen ehewidrigen Verhaltens umfaßte und den Richtern zudem individuelle wie gemeinsame Schuldzuweisung ermöglichte. Der neugeschaffene §55 EheG, der eine dreijährige Trennung voraussetzte und Scheidungen ohne Schuldzuweisungen ermöglichte, wurde insbesondere bei Emigration oder Abwesenheit des jüdischen Ehepartners zur Begründung herangezogen.
Entsprechend dem Scheidungsverhalten der nichtjüdischen deutschen Bevölkerung waren es auch bei den Mischehen in erster Linie die bis zu fünf Jahren geführten Ehen, die geschieden wurden (Tabelle 3). Da Mischehen nach 1935 nicht mehr geschlossen werden durften, drückt sich dies verlagert in den Scheidungszahlen der Ehen aus, die bis zu zehn Jahre gedauert hatten. Auch für den Zeitraum von 1933 bis 1938 darf vermutet werden, daß angesichts der ökonomischen Existenzvernichtung die Ehen mit bis zu fünf Jahren Dauer ebenfalls den größten Anteil an den Scheidungen ausmachten. Für die Zeit von 1938 bis 1945 fällt auf, daß der Anteil der 10 bis 25 Jahre bestehenden Ehen an den Scheidungsverfahren ebenfalls nicht gerade niedrig ist, d.h. daß selbst Ehepaare, die den Verarmungs- und Ausgrenzungsprozeß noch miteinander ertragen hatten, sich angesichts der befürchteten schrittweisen Einbeziehung in den Vernichtungsprozeß trennten.
Ein Blick auf die in den Urteilen angegebenen Aufenthalts- bzw. Wohnorte der Ehepartner (Tabelle 4) läßt auf den gesteigerten Verfolgungsdruck schließen, dem beide Partner ausgesetzt waren. Nur von knapp der Hälfte der Paare wohnte der jüdische Partner zum Zeitpunkt der Scheidung noch in Deutschland und war dort nicht inhaftiert oder ins „Judenhaus“ eingewiesen worden. Rund ein Viertel der Ehen wurde während einer KZ- oder Gefängnishaft geschieden. Auch die hohe Zahl der Emigranten wirft ein erstes Schlaglicht darauf, daß viele Paare zunächst die faktische, dann die juristische Trennung vollzogen. War ein Paar zusammen emigriert und ausgebürgert worden, galten beide Teile in ihrem Aufnahmeland oftmals als Staatenlose. Scheiterte eine Ehe dann, mußten sie – jedenfalls bis Kriegsbeginn – vor einem deutschen Gericht die Scheidung einreichen, das betraf sechs gemeinsam emigrierte Paare.
Nach dem Ehegesetz von 1938 war – wie oben kurz beschrieben – die Schuldverteilung teilweise durch das Zerrüttungsprinzip abgelöst (§55), teilweise aber auch mit ihm kombiniert worden (§49/§60). In der Praxis der Scheidungsurteile ergibt sich – wenn nicht auf Zerrüttung oder Aufhebung erkannt wurde – daß zwischen 1937 und 1945 Schuldzuweisungen überwiegend an die jüdischen Ehemänner ergingen (Tabelle 5): Von 79 Scheidungen mit Schuldspruch waren dies 45. Die geschiedene jüdische Ehefrau war nur in 4 Fällen schuldig.
Geschieden wurden 59 Mischehen, aus denen Kinder hervorgegangen waren, und 56 ohne Kinder, bei 15 Fällen ist dies nicht ersichtlich. Die Gerichtsentscheide geben keine Auskunft darüber, ob die Kinder jüdisch erzogen wurden, d.h. ob die geschiedenen Ehen als „privilegiert“ oder „nichtprivilegiert“ anzusehen waren. Da aber – wie am Anfang des Kapitels ausgeführt worden ist – der Nachwuchs aus Mischehen überwiegend nichtjüdisch erzogen wurde, kann aus diesen Zahlen geschlossen werden, daß „privilegierte“ Ehen im ähnlichen Umfang wie „nichtprivilegierte“ geschieden wurden – ungeachtet des lebenserhaltenden Schutzes der „Privilegierung“. Von 130 Geschiedenen waren 33 emigriert (gemeinsam oder getrennt). Von den restlichen 97 Personen wurden 69 deportiert und/oder ermordet.284 Davon waren 63 Männer und 6 Frauen.
Die Begründungen für Scheidungsklagen und -urteile unterlagen im Laufe der NS-Herrschaft einem extremen Wandlungsprozeß:
1937 begründete die Ehefrau Bertha H. ihre Scheidungsklage mit der Lieblosigkeit und den außerehelichen sexuellen Beziehungen ihres Ehemannes.285 Weil sie ihre Vorwürfe nachweisen konnte, entsprach die Zivilkammer 4 dem Wunsch der „mosaischen“ Ehefrau und schied die Ehe aus Verschulden des Mannes.286 Im selben Jahr forderte ein jüdischer Ehemann die Scheidung, weil seine Frau durch „vollkommen unwirtschaftliches Verhalten, durch Versetzen von persönlichen Sachen des Klägers, durch Schuldenmachen“ und persönliche Beleidigungen wie „Judenpack“ oder „alter Jidd“ die Ehe zerrüttet habe. Das Gericht wertete dieses Verhalten als Verstoß gegen die weiblichen Pflichten und sprach die Ehefrau schuldig.287 In beiden Fällen urteilten Richter, die ihre Rechtsprechung an klaren Vorstellungen von weiblichen und männlichen Pflichten und der Nachweisbarkeit von Verstößen ausrichteten – wenn auch die Art der Beschimpfungen zeigt, daß die Diskriminierung der Juden längst Einzug in die eheliche Gemeinschaft gehalten hatte. Gleichwohl hatte aus Sicht der Scheidungsrichter eine Ehefrau ihren Mann weder zu beschimpfen, wenn dieser seinerseits die ehelichen Pflichten erfüllte, noch relativierte die „Rassenzugehörigkeit“ des Ehepartners per se vorgebrachte Vorwürfe. Auch der jüdische Ehepartner reichte noch die Scheidung ein, wenn ihr oder ihm der Ehealltag unerträglich schien und mußte diese Belastung noch nicht gegen die Angst abwägen, deportiert zu werden.
Andere Scheidungsklagen zeugen vom Wunsch nach einer schnellen und einvernehmlichen Scheidung und dem Bemühen, ohne Schuldzuweisung an den jüdischen Partner die amtliche Trennung herbeizuführen, wenn die Ehe denn schon zerrüttet oder der Druck von Arbeitgebern, Vorgesetzten, Gestapo oder auch von Eltern oder der Nachbarschaft nicht mehr auszuhalten war. Eine solche in den Vorkriegs- und ersten Kriegsjahren wiederkehrende Begründung ist die, der jüdische Ehemann habe sich sexuell immer mehr von der Ehefrau zurückgezogen, ihren Unterhalt vernachlässigt und damit die Zerrüttung der Ehe verschuldet.288 So hatte er zwar traditionelle ehemännliche Pflichten verletzt, dem „Rasseempfinden“ der Richter aber durch vorauseilende Enthaltsamkeit Genüge getan und schließlich auch die Ehefrau entlastet.
Eine andere Argumentationsfigur lautete auf Zerrüttung der Ehe aus beider Verschulden, wenn sich beispielsweise Eheleute wechselseitig Verfehlungen wie Streitsucht oder mangelnde Rücksichtnahme vorwarfen.289
In solchen Fällen forschten die Richter weder nach Einzelheiten noch urteilten sie nach „rassischen“ Gesichtspunkten. Manche fügten der Begründung, die sich auf innereheliche Vorgänge bezog, dann allerdings hinzu, von dieser Lebensgemeinschaft sei „auch angesichts des Rassen- und Glaubensunterschiedes (…) eine Wiederherstellung einer dem Wesen der Ehe entsprechenden Lebensgemeinschaft nicht zu erwarten.“290 Andere Ehen wurden in diesem Zeitraum geschieden, weil ein Partner gegen Pflichten verstoßen hatte, beispielsweise hatte eine Ehefrau ihren jüdischen Mann nicht nur verlassen, sondern ihm vorher auch die Wohnung ausgeräumt, eine Handlung, die ihr die Schuldzuweisung bei der Scheidung eintrug.
Schließlich gab es – wie zu allen Zeiten – Ehen, deren tiefe Zerrüttung im beiderseitigen Bedürfnis zum Ausdruck kam, ausführlich die Verfehlungen von Partnerin oder Partner darzustellen. In diese Scheidungsurteile flossen ebenfalls keine „rassischen“ Gesichtspunkte ein, wenngleich Momente der Judenverfolgung als alltagsbestimmend auftauchten. So hatte ein jüdischer Ehemann argumentiert, er hätte seine Familie nicht versorgen können, da ihm als Juden der Gewerbeschein und damit die Existenzgrundlage entzogen worden wäre. Sein beleidigendes Verhalten der Ehefrau gegenüber begründete er aber damit, daß er ihren Ehebruch entdeckt hatte. Das Gericht folgte dem, wertete den Ehebruch als schwerwiegender und schied die Ehefrau schuldig.291
Diese kurze Darstellung der Scheidungsbegründungen zwischen 1937 und 1939 gibt einen Eindruck von der Vielfältigkeit der Trennungsgründe. In den Jahren 1937 bis 1939 zeichnen sich die Begründungen der Kläger wie auch die richterlichen Urteile immer noch durch ein ungeregeltes Nebeneinander von geschlechtsspezifischen Pflichtverletzungen und bereits dem rassistischen Gedankengut Rechnung tragenden Argumentationen aus. 16 von 130 Urteilen zeugen von dieser noch nicht normativ veränderten Scheidungsrechtspraxis. Die Urteilsbegründungen der Richter zeigen, daß die Mehrheit von ihnen zwischen 1937 und 1939 versuchte, die Auswirkungen der Judenverfolgung als vom Ehepaar gemeinsam zu ertragende Belastungen zu behandeln, die die geschlechtsspezifischen Pflichten neu definierten.
Ab 1939 allerdings änderten sie ihre Rechtsprechung sukzessive dahingehend, die Auswirkungen der Judenverfolgung nun als ein Verschulden des Verfolgten zu werten. Das befreite den „deutschblütigen“ Partner von seinen ehelichen Verpflichtungen – in der Ehe und auch nach der Scheidung. Gab es dennoch bis 1942 vereinzelte Urteile nach anderen Kriterien, so brach diese Praxis 1942 abrupt ab. Eine Analyse der Urteile ergibt, daß sich sowohl die Vorwürfe der Kläger als auch die Entscheidungsgründe der Richter im rassenpolitischen Sinne radikalisierten. Dies betraf nicht nur die einzelnen Richter, sondern den gesamten Ziviljustizbereich. In Lenkungsbesprechungen, die bisher vor allem aus der Strafjustiz bekannt sind, wurde die Rechtsprechung vereinheitlicht. Von diesem Zeitpunkt an wurden „unpolitische“ Urteile allenfalls im Bereich des §55 EheG gefällt, der Zerrüttung nach mindestens dreijähriger Trennung, oder bei Tatbeständen wie dem §47 EheG, nachgewiesenem Ehebruch. Doch selbst hier fehlte die Eindeutigkeit. Dieser Gleichklang zerfiel erst im Jahr 1944 wieder, als der Kriegsverlauf bewirkte, daß ein Teil der Richter zur alten Form der geschlechtsspezifischen ehelichen Pflichtverletzungen zurückkehrte, während andere die Radikalität auf die Spitze trieben.
Die Scheidungswilligen waren in der Mehrheit die „deutschblütigen“ Frauen. Ihre Begründungen und korrespondierende Aktenbestände geben einen Einblick in die vielfältigen Motive, die dazu führten, die Trennung von ihren jüdischen Ehepartnern herbeizuführen und damit willentlich oder unwissentlich zu Akteurinnen im Prozeß der Judenverfolgung zu werden.
3. Die rassistische Aufladung der Eheaufhebungs- und Scheidungsparagraphen
Scheidungsgrund Ehebruch
Ehebruch war nach altem und neuem Eherecht ein Scheidungsgrund, wenn auch die Folgen für den schuldig geschiedenen Teil bei einer späteren Eheschließung nicht mehr so gravierend waren wie vor 1938. Vier Urteile des Hamburger Landgerichts in den Jahren 1939 bis 1944 zeugen davon, daß die Kammern in Fällen von Ehebruch schnell und ohne weitere Recherchen entschieden. Wesentlich war dabei, daß der Seitensprung mit einer „gleichrassigen“ Person begangen worden sein mußte. Andernfalls entstand aus dem „harmlosen“ Ehebruch ein Strafverfahren wegen „Rassenschande“, denn durch die Nürnberger Gesetze war die Strafverfolgung von außerehelichem Sexualverkehr zwischen Juden und „Deutschblütigen“ bekanntlich ein Offizialdelikt. So finden sich in dem untersuchten Sample neben vier Scheidungsurteilen wegen Ehebruchs mit „Gleichrassigen“ fünf weitere aus den Jahren 1937 bis 1942, die an ein „Rassenschandeverfahren“292 anknüpften und mit einem Schuldspruch gegen die jüdischen Ehepartner (vier Männer, eine Frau) endeten.
Weitere zwei „deutschblütige“ Ehefrauen hatten befürchtet, mit anderen Scheidungsgründen nicht anerkannt zu werden und den jüdischen Ehemann „vorsorglich“ der „Rassenschande“ bezichtigt. In beiden Fällen erwiesen sich die Anzeigen als haltlos, doch wurde einer der Ehemänner in Untersuchungshaft genommen. Die Klägerin zog nun die Anzeige zurück und führte als Scheidungsgrund Zerrüttung aus „rassischen“ Gründen an. Das Gericht folgte ihr, denn „sie habe sich vom Kläger getrennt, weil sie zu spät erkannt habe, daß ihre Ehe als Mischehe und durch das ehebrecherische Verhalten des Klägers unhaltbar geworden sei“,293 und bewertete neben der „Rassenverschiedenheit“ auch den Altersunterschied von 16 Jahren als eheabträglich.
In dem zweiten Fall hingegen sah die zuständige Zivilkammer in der Anzeige der Ehefrau, die „an der jüdischen Abstammung des Beklagten bis dahin Anstoß nicht genommen“ hatte, einen Verstoß gegen deren eheliche Treuepflicht. Es wies darauf hin, dieses Vorgehen sei ein Grund, sie schuldig zu scheiden, wenn das Gericht nicht zu ihren Gunsten annähme, daß sie eine leicht erregbare Frau sei, die im übrigen über die Folgen ihrer Anzeige nicht im Bilde gewesen sei. Als die Klägerin jedoch ein halbes Jahr später – immer noch vier Monate vor Inkrafttreten des neuen Eherechts – Revision gegen das Urteil beim Oberlandesgericht (OLG) einlegte, folgte diese Instanz ihren „Belegen“ für ehebrecherische Aktivitäten des Ehemannes. Auch die Anzeige erschien plötzlich in anderem Licht. Das Gericht mahnte zwar, Strafanzeigen seien im allgemeinen mit der ehelichen Treuepflicht nicht vereinbar. Auch verwunderte es das OLG, „wenn die arische Klägerin, die nach fünfundzwanzigjähriger Ehe mit einem Juden keinen Anspruch auf Rassegefühl machen kann, an den Beziehungen ihres Mannes zu einer Arierin so schwer Anstoß nimmt“, dennoch billigte das Gericht der Frau zu, sich als „Rechtsunkundige“ zunächst an die Polizei gewendet zu haben, zumal
„wenn die Strafanzeige nicht erstattet worden wäre, doch der Scheidungsprozeß zur Strafverfolgung geführt haben (würde). Schließlich ist nicht außer Acht zu lassen, daß eine im guten Glauben und nicht leichtfertig erstattete Strafanzeige wegen Rassenschande im öffentlichen Interesse liegt (…). Mag daher die Klägerin gegen die eheliche Treuepflicht verstoßen haben, so hat sie doch andererseits, wenn vielleicht auch unbewußt, im öffentlichen Interesse gehandelt.“294
Der Scheidung wurde stattgegeben, der jüdische Ehemann schuldig gesprochen. Zwar meinte das OLG, auch die Klägerin rügen zu müssen, aber es wird deutlich, daß sie nicht länger an weiblichen ehelichen Pflichten gemessen wurde, weil die Strafanzeige im öffentlichen Interesse lag. Noch bevor das neue Eherecht in Kraft getreten war, hatte das OLG also seine Prinzipien nicht nur im „politischen“ Paragraphen des Bedeutungsirrtums, sondern auch bei Scheidungen nach dem Schuldprinzip etabliert, eine Linie, die es fortan bei allen zur Revision vorgelegten Fällen anwandte.
Scheidungsgrund Zerrüttung (Langjährige Trennung)
Der Paragraph 55 des Ehegesetzes vom 6. Juli 1938 ermöglichte eine Scheidung ohne Schuldzuweisung nach dreijähriger Trennung. Einige Paare sahen hier offensichtlich eine Möglichkeit der einvernehmlichen Scheidung.295 In der Vorkriegszeit machten davon Mischehepaare Gebrauch, die ohnehin nachweisbar seit Jahren nicht mehr zusammenlebten, wenn auch der Entschluß, diese Trennung formal zu vollziehen, wohl selten ohne äußeren Druck entstanden war. So verwehrte beispielsweise eine Ehefrau ihrem jüdischen Mann nach der KZ-Entlassung Ende 1938 den Zugang zur gemeinsamen Wohnung. Als Getrenntlebender aus „nichtprivilegierter“ Mischehe erhielt er 1942 den Deportationsbefehl, Anlaß für seine Ehefrau, nun die Scheidung einzureichen. Offensichtlich hatte er seine Frau gebeten, mit der Klage abzuwarten, um die „Evakuierung“ hinauszuzögern. Er widersprach dem Scheidungsbegehren und trug schließlich vor, sie habe ihn betrogen. Das Gericht verwarf seine Interventionen, da „der Beklagte Volljude ist und damit einer Rasse angehört, die zu den geschworenen Feinden des neuen Deutschlands gehört und jetzt im Kriege auf Seiten der Gegner steht.“296 Es sei der Ehefrau nach der KZ-Entlassung nicht zuzumuten gewesen, „wegen des Judentums des Beklagten (…) mit ihm erneut wie Mann und Frau zusammenzuleben“,297 und den Ehebruch habe sie erst viel später begangen, so daß er diesen nicht als ehezerstörend habe empfinden können. Um die anstehende Deportation nicht zu verzögern, zog das Gericht die Tatsache der langjährigen Trennung und nicht die zeitaufwendige Prüfung einer schuldhaften Zerrüttung für die Scheidung heran. Damit hatte es alle an geschlechtsspezifische Pflichten gebundenen Scheidungsgründe verworfen, nach denen der Scheidung entweder nicht stattgegeben oder die Ehefrau schuldig geschieden worden wäre.298
Doch in der Regel fehlt in den auf dem §55 EheG fußenden Urteilen jede „rassische“ Begründung, die hier auch nicht erforderlich war. Selten schimmert wie im dargestellten Fall die Realität einer Ehe durch die knappen Begründungen hindurch.299 Oft weist nur die Adresse des jüdischen Ehepartners, die als KZ, Haftanstalt oder unbekannter Aufenthaltsort angegeben ist, oder eine Hamburger Hausnummer, die als „Judenhaus“ identifizierbar ist, auf die „Gründe“ des Auseinanderlebens hin.
Scheidungsgrund schwerwiegende Eheverfehlungen
Sehr viel deutlicher hingegen schlagen sich in den Scheidungen nach §49 EheG, die– wie die Statistik gezeigt hat – die Mehrheit der Fälle ausmachten, die Auswirkungen nationalsozialistischer Judenverfolgung im Ehealltag sowie der richterliche Paradigmenwechsel von der ehelichen Pflichterfüllung zur „rassischen“ Begründung nieder.
Wie eingangs bereits an einem Fall demonstriert, galten Beleidigungen als schuldhaftes Verhalten für eine Ehefrau, auch wenn diese sich auf das Judentum des Ehemannes bezogen. In einem anderen Scheidungsverfahren warf die Klägerin ihrem Mann vor, sie hätte, weil er Jude wäre, ihre Arbeitsstelle verloren, was um so schwerer wöge, als er aufgrund seiner beruflichen Diskriminierung nicht für ihren Unterhalt sorgen könnte. Außerdem habe er Geld verwettet. Das Gericht hingegen wertete ihre solchermaßen im Ehealltag häufig in liebloser Weise vorgebrachten Vorwürfe als grobe Pflichtverletzung ihrerseits und schied die Ehe aus beiderseitigem Verschulden.300
In den Jahren 1937 bis 1939 werden in allen urteilenden Zivilkammern Bemühungen deutlich, Anforderungen zu formulieren, wie Eheleute im Rahmen männlicher und weiblicher ehelicher Pflichten mit dem äußeren Druck durch die Verfolgungsmaßnahmen umgehen sollten: Wer keinen Antrag auf Aufhebung der Ehe gestellt habe, könne „rassische“ Gründe im Scheidungsverfahren nicht anführen.301 Die Richter versuchten, männliche und weibliche Pflichten in der Ehe angesichts der Verfolgungsmaßnahmen neu zu definieren: Sie untersuchten, ob beide Eheleute die Auswirkungen der Judenverfolgung solidarisch, mit gegenseitigem Verständnis und Rücksichtnahme ertragen hatten. Dahinter stand die Vorstellung, ein Paar hätte in guten wie in schlechten Tagen zusammenzuhalten.
In anderen Fällen mischten sich geschlechtsspezifische Kriterien mit dem gar nicht so heimlichen Auftrag, diese Ehen zu scheiden. Als beispielsweise eine „deutschblütige“ Klägerin geltend machte, ihr jüdischer, staatenloser Ehemann sei aus dem gemeinsamen Haushalt ausgezogen, habe den Geschlechtsverkehr verweigert, trage sich mit Auswanderungsgedanken und sorge nicht für das gemeinsame Kind, lehnte die Kammer eine Alleinschuld des Mannes trotzdem ab. „Sie hat jedoch jahrelang zu dem Beklagten gehalten. Ihre Gesinnungsänderung gereicht ihr daher zum Verschulden.“302 In diesem wie ähnlichen Fällen wiesen die Richter nicht etwa die Klagen zurück, sondern sprachen beide Partner schuldig.
Waren diese Urteile vom Bemühen getragen, eine Vermittlung von geschlechtsspezifischen Kriterien und rassischer Verfolgung zu finden, so traten ab 1939 in den Begründungen für schwerwiegende Eheverfehlungen antijüdische Maßnahmen stark in den Vordergrund. War ein Ehepartner von einer derartigen Maßnahme betroffen, hatte er damit bereits die Ehe schuldhaft zerrüttet:
– Vorbestrafte Juden, die teilweise in Mischehen lebten, waren in der Juni-Aktion,303 andere nach der Pogromnacht verhaftet und in das KZ Sachsenhausen verbracht worden. Etliche Ehefrauen leiteten 1939 die Scheidung ein. Die Zivilkammern werteten generell Verhaftungen als schuldhafte Zerrüttung der Ehe durch den Verhafteten.304
– Verlor ein jüdischer Ehemann seinen Arbeitsplatz und brachte dadurch die Familie in Schwierigkeiten, wurde er schuldig geschieden.305
– Waren jüdische Ehemänner wegen des Verstoßes gegen die antijüdischen Vorschriften im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel inhaftiert, urteilte die Zivilkammer: „Der Beklagte hat sich durch sein zugegebenes staatsfeindliches Verhalten einer ehrlosen Handlung schuldig gemacht und dadurch die Ehe unheilbar zerrüttet.“306
Aus diesen Urteilen der Jahre 1939 bis 1942/43 wird deutlich, daß Verstöße gegen geschlechtsspezifisch verteilte Ehepflichten längst keine Rolle mehr spielten, wenn es darum ging, eine Mischehe zu scheiden.307 In diesen Jahren war es für zurückgewiesene „deutschblütige“ Klägerinnen und Kläger auch nicht mehr notwendig, zur Korrektur eines vielleicht zu sehr an diesen alten geschlechtsspezifischen Kriterien orientierten Urteils das OLG anzurufen, vielmehr hatte das Landgericht seine eigene Linie gefunden.
Wie oben bereits angedeutet, wurde auch die Tatsache der beabsichtigten oder schon erfolgten Emigration als Scheidungsgrund des „arischen“ Ehepartners herangezogen. Dieses Scheidungsmotiv durchlief einen ähnlichen Wandlungsprozeß, der sich in den Jahren 1938/39 in gegensätzlichen Entscheidungen niederschlug: Einerseits besaß der Ehemann das Wohnortsbestimmungsrecht, und es herrschte die Erwartung, daß die Ehefrau seine Entscheidung respektieren und unterstützen müsse. So klagte beispielsweise ein jüdischer Ehemann auf Scheidung, weil seine Frau ihm weder den Haushalt ordentlich führte noch ihm in die Emigration hätte folgen wollen. Die Ehefrau wurde wegen dieser Verfehlungen schuldig geschieden.308 Andererseits urteilte eine Kammer, das Ansinnen einer gemeinsamen Emigration wäre an sich grob ehewidrig309 oder die Wahl eines Einwanderungslandes mit unverträglichem Tropenklima eine schwere Eheverfehlung.310 Eine Zivilkammer hingegen wies die Klage einer „deutschblütigen“ Ehefrau ab, die nach 25jähriger Ehe ihrem Mann Pflichtverletzungen vorwarf, die in seinen Auswanderungsplänen gipfelten. Das Gericht jedoch wertete die Tatsache, daß er ihr vor der Emigration das gesamte Vermögen zur Absicherung der Zukunft übertragen hatte, als Pflichterfüllung311 und verlor kein Wort über die Absicht, Deutschland und die Ehefrau zu verlassen.
Etliche Mischehepaare gingen offensichtlich davon aus, ein Leben in unbekannter Umgebung und ökonomisch unsicheren Verhältnissen nicht gemeinsam bewältigen zu können. So emigrierte der jüdische Partner – meist der Ehemann – und die zurückgebliebene Ehefrau reichte als „verlassener“ Ehepartner dann in Hamburg die Scheidung ein. Zu diesem Zeitpunkt lebte das Paar also faktisch bereits getrennt. Vor Kriegsbeginn – oder bis zum Kriegseintritt des Emigrationslandes – wurden solche Klagen den Emigranten über die deutschen Botschaften zugestellt, damit sie oder ein Anwalt reagieren konnten. Später erfolgte die „öffentliche Zustellung“, d.h. der Betroffene erfuhr von seiner Scheidung nur, wenn er den Reichs- und Staatsanzeiger studierte, in dem die beabsichtigte Scheidung „eingerückt“ und das ergangene Urteil abgedruckt wurde.
Wenn nicht ehewidrige Beziehungen der Zurückgebliebenen nachgewiesen werden konnten,312 wurde bei der Mehrzahl dieser Scheidungsfälle der emigrierte Ehepartner schuldig gesprochen, der den vorgebrachten Gründen in diesen Fällen meist nicht widersprach oder widersprechen konnte. Die Emigration, die die „deutschblütige“ Partnerin nicht hatte teilen wollen oder können, galt nun ebenso als Pflichtverletzung bzw. „schwere Eheverfehlung“ bei vierzehn jüdischen Ehemännern wie bei den drei Emigrantinnen.313 In der Regel fielen die Begründungen dieser Fälle sehr kurz aus. Wenn durch die Emigration eine mehr als dreijährige Trennungszeit verflossen war, konnte die Ehe – wie oben bereits angeführt – nach dem §55 EheG geschieden werden.
Ehefrauen von jüdischen Emigranten gerieten nach deren Auswanderung nicht nur in wirtschaftliche Bedrängnis und immer wieder in einen Erklärungsnotstand, weshalb sie immer noch mit einem Juden verheiratet waren. Für etliche tat sich ein noch anderes, ebenfalls existentielles Problem auf: Sie hatten durch die Eheschließung mit einem inzwischen staatenlosen oder ausgebürgerten Ehemann auch ihre Staatsangehörigkeit verloren: „Da der Ehemann seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt hat, so hat er damit als Jude nach der 11. VO zum Reichsbürgergesetz v. 25.11.41, RBGl S. 722, seine Reichszugehörigkeit verloren. Mit ihm ist auch die Ehefrau staatenlos geworden.“314
Andere Ehefrauen waren ihren jüdischen Männern in die Emigration gefolgt, erlebten aber, wie ihre Ehe dort zerbrach und reichten die Scheidung ein – vor deutschen Gerichten, die sie teilweise als Staatenlose behandelten.315 Diese Ehefrauen mußten von Brasilien, Argentinien oder Palästina aus Gerichte an ihrem letzten deutschen Wohnort um die Scheidung ersuchen und diese sprachen – nach Prüfung der Zuständigkeit – Recht: Sie schieden Ehen wegen Zerrüttung, Ehebruch oder mehr als dreijähriger Trennung, als handele es sich nicht um ehemalige Staatsbürger, die vertrieben worden waren.316
Die mit Juden aus Osteuropa verheirateten Frauen befanden sich in besonders bedrohlicher Lage, wie die folgenden Fälle zeigen: Eine Hamburgerin und ihr ungarischer jüdischer Ehemann zogen 1938 mit drei Kindern nach Budapest. Nachdem ihnen dort die ungarische Staatsbürgerschaft aus unbekannten Gründen aberkannt worden war, mußte die Familie in einem Internierungslager leben, bis sie nach einem Jahr über die serbische Grenze abgeschoben wurde. Der Ehemann entfloh, die Ehefrau kehrte mit den Kindern nach Hamburg zurück und reichte die Scheidung wegen Verlassens ein. Erst nach der Scheidung erhielt sie die deutsche Staatsbürgerschaft zurück.317
Auch die Frauen ehemals polnischer Juden hatten ihre Staatsangehörigkeit verloren. Als die „deutschblütige“ Ehefrau eines aus Polen zugewanderten Juden nach jahrelangem Krankenhaus- und Heimaufenthalt ihres Mannes die Scheidung einreichte, wurden beide als Staatenlose behandelt.318 Die Scheidung von ihrem gelähmten Ehemann wurde aufgrund der krankheitsbedingten Trennung und der „Rassenverschiedenheit“ ausgesprochen. Diese Ehefrau war bei der Heirat zum jüdischen Glauben übergetreten und hatte der Israelitischen Gemeinde bis 1938 angehört. Durch die veränderte Scheidungspraxis der Richter, die die Mischehenscheidung höher ansetzten als andere Prinzipien, konnte sie die Staatsbürgerschaft zurückerlangen und nach der Scheidung und dem Austritt aus der jüdischen Gemeinde in den „deutschen Blutsverband zurücktreten“. Ihre Kinder jedoch blieben als „Geltungsjuden“ eingestuft.
Aufhebungen der „Rassenmischehen“
Der explizit politische Paragraph 37 EheG zur Aufhebung der „Rassenmischehen“ wurde beim Hamburger Landgericht sehr viel häufiger von Klägerinnen und Klägern bemüht, als Richter dann tatsächlich nach ihm entschieden. Während die Richter unsicher waren, wann die Frist, in der die Bedeutung des Irrtums über die Rassezugehörigkeit des jüdischen Ehepartners erkannt worden war, begonnen hatte, beantragten die Scheidungswilligen, die Ehe entweder aufzuheben oder sie wegen Zerrüttung zu scheiden.
Doch auch die Auslegung des §37 EheG unterlag in den Jahren 1938 bis 1945 einem ähnlichen Wandlungsprozeß wie die der oben behandelten anderen Paragraphen des Ehegesetzes: Beispielsweise wies die Zivilkammer die Klage einer „deutschblütigen“ Frau ab, die 1938 ihre Ehe aufheben lassen wollte, weil sie „mit der Verschlechterung der Wirtschaftsverhältnisse, wie sie für den Beklagten wie für alle Juden in letzter Zeit eingetreten ist, (…) nicht gerechnet (hatte).“319 Die Kammer verfügte, die Klägerin hätte die Folgen ihres in Kenntnis der „rassenbiologischen und rassenpolitischen Gesichtspunkte“ eingegangenen Ehebündnisses zu tragen – eine Maßregelung der „deutschblütigen“ Ehepartner, der etliche Kammern in der Vorkriegszeit nicht widerstehen konnten.320
Im Gegensatz zur Anforderung an diese Klägerin entschied eine andere Kammer, die „deutschblütige“ Ehefrau sei 1933 zu eigener Erkenntnis über die Bedeutung des „Rassenunterschiedes“ gar nicht fähig gewesen. „Auch seit der Zeit der Machtergreifung sei sie infolge ihrer unkomplizierten Denkweise noch zu sehr in jüdische Beziehungen verstrickt gewesen (…) Erst in allerletzter Zeit habe sich bei ihr ein wirkliches Verständnis für die Tragweite der Arierfrage durchgesetzt.“321 Die Verhaftung ihres Ehemannes und Inhaftierung im KZ Sachsenhausen hätte ihr Aufschluß über die Bedeutung gegeben, die die Abstammung ihres Mannes für sie persönlich habe, zumal die jüdischen Eltern des Verhafteten sich geweigert hatten, sie materiell zu versorgen. So hatte sie erwerbstätig werden müssen, was wiederum durch den jüdischen Familiennamen erschwert worden war. In dieser Situation – dies erkannte die Kammer an – habe sie sofort Klage erhoben und damit die geforderte Frist individuell gewahrt.
Die Argumentation, ein sozialer Abstieg wäre nicht zumutbar, war allerdings in parallelen Scheidungsverfahren nicht anerkannt worden. Es herrschte also auch hier bis in die Kriegsjahre hinein eine sehr uneinheitliche Rechtspraxis. Ein Richter wollte selbst die „Rassereinheit“ des „englischen Volkes“ wahren und gab einer Klage mit dieser Begründung statt: „Auch in Kreisen des englischen Volkes hat der Rassegedanke immer mehr an Boden gewonnen. Die Kammer nimmt es daher der Klägerin ab, daß sie als reinblütige Engländerin niemals in Kenntnis des Sachverhaltes einen Volljuden zu ihrem Ehemann gewählt hätte.“322
Besonders problematisch war der Umgang der Richter mit der Frist, innerhalb derer eine Aufhebungsklage einzureichen war. Nach 1933 hatten etliche Juristen sie für ein Jahr erneut anlaufen lassen, nach der Einführung des neuen Eherechts sollte sie wiederum ein Jahr gelten. Die Richter gingen mehrheitlich davon aus, daß der Zeitpunkt neu bestimmt würde, wenn genau zu datierende antijüdische Maßnahmen den „deutschblütigen“ Partner mit den Auswirkungen der Ehe mit einem Juden konfrontiert hatten. Einige Juristen erweiterten allerdings auch diesen großzügigen Umgang mit den Fristen noch: Sie bestanden darauf, daß der Zeitpunkt einer persönlichen Erkenntnis fristeröffnend werden sollte. Damit existierte in der Beurteilung der Fristen eine uneinheitliche Rechtspraxis unter den Zivilkammern, die bis 1945 fortbestand.
In den Aufhebungsurteilen werden folgende Gründe für Fristeröffnungen akzeptiert:
1. Emigrationsabsichten des jüdischen Ehemannes;
2. die Kennzeichungspflicht für Juden;
3. die Deportationen;
4. die Definition von Juden als Kriegsgegner.
Das OLG begründete die Neueröffnung der Frist angesichts der Deportationen in einem veröffentlichten Grundsatzurteil so:
„Wenn diese Maßnahme auch für Mischehen in der Regel nicht gilt, so zeigt sie doch die stärkere Verfemung der Angehörigen der jüdischen Rasse. Im weiten Umfang sind im letzten Jahre Evakuierungen von Juden ausgeführt worden. Die Beklagte selbst ist, wie eine Auskunft der Polizeibehörde ergibt, noch vor der Berufungsverhandlung evakuiert. Es ist dem Kläger zu glauben, daß sich bei ihm die Erkenntnis durchgesetzt habe, daß die Fortdauer der Ehe mit seiner jüdischen Ehefrau für ihn untragbar sei.“323
Das betroffene Paar hatte als „privilegierte“ Mischehe gegolten. Der Ehemann hatte bereits 1941 die Trennung von seiner jüdischen Frau verlangt, doch seine Klage war abgewiesen worden. Danach hatte er die gemeinsame Wohnung mit den Kindern verlassen. Seine immer noch mit ihm verheiratete jüdische Ehefrau wurde noch vor dem Aufhebungsverfahren deportiert, was zwar nicht der Regelfall war, aber doch im Einzelfall vorkam.
Absurd wirkt in einer zivilrechtlichen Auseinandersetzung die Subsumierung eines Ehepartners unter die Kriegsgegner des Deutsches Reiches:
„Besonders seit dem Eintritt Amerikas in den Krieg ist dem deutschen Volk klar geworden, daß das Weltjudentum der geschworene Feind des neuen Deutschlands ist und die Hauptschuld am Kriege trägt. Das ist dem deutschen Volke seitdem immer wieder eingeprägt worden, zuletzt noch eindringlich durch die Führerrede vom 8. Nov. 1942. Die Einstellung des deutschen Volkes zum Judentum und dessen allgemeine ‚Diffamierung‘ hat sich gerade im letzten Jahre so verschärft, daß es heute grundsätzlich keinem Deutschen mehr zugemutet werden kann, gegen seinen Willen die Ehe mit einer Jüdin fortzusetzen, auch wenn er noch vor einem Jahre keinen oder nur geringen Anstoß an dem Judentum genommen hat.“324
Waren dies die an antijüdische Maßnahmen geknüpften Fristeröffnungen, so gestatteten die Gerichte daneben an die individuelle Erkenntnis geknüpfte Fristeröffnungen: So wollte eine „deutschblütige“ Ehefrau die Auswirkungen des Rassenunterschiedes erst mit zunehmender Verfolgung und durch den Kriegsbeginn bemerkt haben:
„Die Klägerin ist dadurch, daß der Beklagte Volljude ist und sich auch jetzt eng an seine Rasse- und Glaubensgenossen hält, als deutsche Frau in eine immer schwierigere Lage und immer größere Gewissensnöte gekommen. Ihre Töchter aus erster Ehe sind beide mit Soldaten verheiratet, die im Felde stehen. Ihre Verwandten haben sich jetzt wegen des Judentums ihres Mannes von ihr zurückgezogen.“325
Eine andere Ehefrau, deren jüdischer Mann 1939 vom KZ Gurs aus deportiert worden war, hätte bis zur Klageinreichung 1942 – so das Gericht – vermutlich als getrenntlebende Frau weniger unter antijüdischen Maßnahmen gelitten, als wenn sie mit ihrem Gatten zusammengelebt hätte, und daher die Aufhebungsklage so spät eingereicht.326
Dennoch waren die Richter 1942 mit der eigenen widersprüchlichen Auslegungspraxis unzufrieden, zumal Vorgaben „von oben“ ausblieben: Weder das Reichsgericht noch der Gesetzgeber führten die Einheitlichkeit herbei, die sie in ihren Urteilen einforderten,327 und die Teilnehmer der Wannsee-Konferenz einigten sich nicht auf Zwangsscheidungen von Mischehen. Im Prinzip stand das Hamburger Landgericht 1942 also wieder an einem ähnlichen Punkt wie 1934/35: Durch Dynamisierung und Radikalisierung hatte sich die Auslegung der Gesetze so weit von deren Wortlaut entfernt, daß dieser der Rechtspraxis hätte angepaßt werden müssen oder die Richter von den dort festgelegten Beschränkungen hätten befreit werden müssen. 1934/35 hatte Roland Freisler die Richter davor gewarnt, dem Willen des nationalsozialistischen Gesetzgebers durch eigene Rechtsauslegung zum Ausdruck zu verhelfen, und schließlich hatte das Eherecht von 1938 später neue Bestimmungen eingeführt. Doch 1942 blockierten sich die konkurrierenden Machtblöcke des nationalsozialistischen Staatsapparates gegenseitig, ein Gesetzesvorhaben zur Vereinheitlichung der Rechtsprechung war nicht in Sicht. So erfolgte eine Radikalisierung der Rechtsprechung „von unten“: Die Hamburger Landgerichtsdirektoren schritten zur Selbsthilfe und formulierten Richtlinien für die künftige erleichterte Scheidungspraxis.328 Fortan gingen sie davon aus, daß die Frist für Aufhebungen jederzeit anlaufen könne und daß der jüdische Ehepartner zwar nicht generell schuldig gesprochen werden dürfe, ihm aber auf keinen Fall Unterhalt zustünde.
Das Ergebnis dieser Lenkungsbesprechung und der Urteils-Nachschauen329 war ein neuer Anstieg der Aufhebungsklagen im Jahr 1943, die nun einheitlich behandelt wurden und sich manchmal bis in die Formulierungen hinein glichen. Die Richter fühlten sich im Recht: „Denn wenn der Staat bisher auch davon abgesehen hat, die Mischehen durch Gesetzesakt zur Aufhebung zu bringen, so kann doch kein Zweifel bestehen, daß derartige Ehen nationalpolitisch unerwünscht sind. Demgegenüber haben alle von der Beklagten vorgetragenen Gesichtspunkte zurückzutreten.“330
Die Mehrzahl der im Jahr 1943 entschiedenen Aufhebungsklagen richteten sich gegen einen inhaftierten oder im „Judenhaus“ lebenden jüdischen Ehepartner. Einer Ehefrau wurde etwa zugebilligt, daß sie durch die U-Haft ihres jüdischen Mannes Probleme bei Arbeits- und Wohnungssuche bekommen habe, auch sei Aussicht auf Haftentlassung nicht gegeben.331 Andere Ehefrauen führten die bevorstehende Deportation des Ehemannes an oder äußerten die Furcht, selbst einen „Evakuierungsbefehl“ zu erhalten.332 Die meisten Begründungen waren allerdings knapper: Die „Rassenverschiedenheit“ sei der Partnerin erst jetzt bewußt geworden, oder: Man habe die Einstellung des jetzigen Staates Juden gegenüber nicht voraussehen können.333
Während die Mehrheit der Klagen von den Ehefrauen ausgingen, wurden drei der Aufhebungsklagen in diesem Zeitraum von nichtjüdischen Ehemännern gestellt: In einem Fall war die Ehefrau wegen Nichtbefolgens der Vorschriften gegen Juden im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel inhaftiert. In den beiden anderen Fällen handelte es sich um Ehen, die 27 und 31 Jahre bestanden hatten. In einem Fall lebte die Ehefrau bereits im „Judenhaus“ und hatte den Deportationsbefehl bekommen, im anderen machte der Ehemann gegen die Mutter seiner sieben Kinder (!) geltend, er hätte die Maßnahmen gegen Juden nicht voraussehen können. Geschlechtsspezifische Argumentationen traten in diesen Klagen und den Urteilsbegründungen also völlig hinter dem staatlichen Interesse zurück, die Ehen zu scheiden.334
Auffällig an diesen Aufhebungsklagen ist, daß etliche der verhafteten oder im „Judenhaus“ lebenden jüdischen Männer (sowie eine Frau) den Deportationsbefehl bereits erhalten hatten, als die Aufhebung der Ehe beantragt wurde. Dabei handelte es sich nur zum Teil um „nichtprivilegierte“ Mischehen. Im Text der Scheidungsurteile wird implizit deutlich, daß – wenn ein jüdischer Mischehepartner kriminalisiert und verhaftet wurde – der Schutz der Mischehe spätestens ab 1942 nicht länger galt. Die Untersuchungshaft bzw. Haftverbüßung hatte keine deportationsaufschiebende Wirkung,335 wobei der von der Gestapo ausgeübte Druck auf die Ehepartner nicht in den Urteilen zum Ausdruck kam.
In den Jahren 1944/45 sank die Anzahl der Aufhebungsklagen – wie die Statistik zeigt – rapide ab. Auch inhaltlich ist von einem einheitlichen Kurs der Richter nichts mehr zu bemerken. Die noch ungeschiedenen Ehepaare waren offensichtlich durch Erhöhung des Drucks nur noch selten zur Scheidung zu bewegen. Nun ging es meistens um Sonderfälle wie eine im Ausland geschlossene Mischehe. Konnte nachgewiesen werden, daß das Paar nur wegen der Heirat ins Ausland gefahren war, griff die in den Nürnberger Gesetzen festgelegte Nichtigkeitserklärung. Lebte es aber ständig dort, mußte eine derartige Ehe in einem ordentlichen Verfahren aufgehoben oder geschieden werden,336 so bei einem 1940 in Paris verhafteten Ehepaar, das der „Rassenschande“ angeklagt wurde. Das Gericht verurteilte den jüdischen Ehemann, der als Polizeigefangener bis zum Ende des Krieges eine schwere Krankheit simulieren und deshalb im Israelitischen Krankenhaus in Hamburg überleben konnte. Seine freigesprochene Frau beantragte 1944 die Aufhebung ihrer Ehe. Das Landgericht „billigte“ die Klage scheinheilig, denn aufgrund des Auslandsaufenthalts und der anschließenden Haft habe sie länger gebraucht, sich über die Auswirkungen der „Rassenverschiedenheit“ Klarheit zu verschaffen.337
Einige späte Klagen waren von nichtjüdischen Ehemännern eingereicht. Sie demonstrieren den Zerfall einheitlicher richterlicher Radikalität: Ein bei Cholm/Lublin stationierter Feldwebel begründete sein Trennungsbegehren von der jüdischen Ehefrau:
„Er habe sein Amt als Politischer Leiter [der NSDAP, B.M.] wegen der Rassezugehörigkeit der Beklagten niederlegen müssen und als Kriegsteilnehmer erlebt, wie seine Kameraden auf bestialische Weise von Juden hingemordet wurden, wobei er selbst leicht verwundet wurde. Durch diese Erlebnisse sei ihm klar geworden, daß er die Ehe mit ihr nicht fortsetzen könne.“338
Nun war es im Gebiet Lublin keineswegs so, daß Juden deutsche Soldaten mordeten. Im Gegenteil fanden gerade in diesem Gebiet, das ursprünglich als riesiges Ghetto geplant war, über Jahre Mordaktionen der SS, der Polizeibataillone und der Wehrmacht statt, denen tausende jüdischer Einwohner oder dorthin verschleppter Arbeitssklaven zum Opfer fielen. Erschießungsaktionen, Mord in Gaswagen und schließlich Massendeportationen nach Sobibor und Treblinka kennzeichneten den örtlichen Alltag des Vernichtungskrieges. Die Begründung dieses Soldaten, dessen Leiterfunktion darauf hinwies, daß er überzeugter Nationalsozialist war, könnte gegen den Strich so interpretiert werden: In Anbetracht meines Wissens um den Judenmord kann ich es nicht ertragen, mit einer Angehörigen dieser Gruppe verheiratet zu sein, deren Anblick mir täglich diese ungeheure Schuld in Erinnerung rufen würde.
Vielleicht waren die Gründe aber viel banaler: Eventuell hielt ihn die Minderjährigkeit seines Sohnes, 1922 geboren, in den 30er Jahren von einer Scheidung ab. Inzwischen war dieser volljährig und als Besatzungsmitglied eines deutschen Schiffes im fernen Mexico interniert.339 Der Kläger bekleidete den Rang eines Feldwebels und hatte damit die höchste Beförderungsstufe erreicht, die für „jüdisch Versippte“ möglich war.340 Es könnte auch sein, daß er diesmal nicht auf eine Karriere, wie seinerzeit im Parteiapparat, verzichten wollte und sich vom Hindernis der jüdischen Ehefrau befreite. Nach der Scheidung verweigerte er der schwer erkrankten Frau jegliche Unterhaltszahlung, weil „es nicht der Billigkeit entsprechen würde, daß er seiner früheren Ehefrau als Volljüdin weiteren Unterhalt zahlt.“341
Ein anderer „deutschblütiger“ Ehemann, sicher durch die Praxis der Gerichte zur Klage ermutigt, reichte ebenfalls 1944 Aufhebungs-, hilfsweise Scheidungsklage wegen Zerrüttung ein. Er war wegen seiner Ehefrau 1937 von der Reichspost, 1943 aus der Wehrmacht entlassen worden. Zudem habe die Ehefrau ständig gegen den Nationalsozialismus gehetzt. Nun machte er den „Rassenunterschied“ geltend – und erlebte, daß seine Klage abgewiesen wurde. Die Frist für eine Anfechtung – so die Richter – sei abgelaufen, im übrigen hätte er die Nachteile einer Ehe mit einer Jüdin längst erfahren. Ehewidriges Verhalten wäre seiner Frau nicht nachzuweisen, im Gegenteil war zu vermuten, er wolle eine andere Frau heiraten.342 Die Klage wäre noch ein Jahr zuvor sicher anders entschieden worden.
Diese späten Urteile zeugen vom Zerfall nationalsozialistischer Weltanschauung auch auf dem Gebiet des Zivilrechts: Anarchisch und schubweise hatte sich eine Radikalisierung von unten in den Jahren bis 1942 vollzogen, die in einheitlicher Rechtsauslegung 1943 gipfelte. Dann zerbröselte die Einheitlichkeit: Neben einem Urteil wie dem obigen, das die Verkehrung der Verhältnisse als Ausgangspunkt der Argumentation akzeptiert, kamen plötzlich wieder alte Kriterien zur Geltung, nämlich die, ob eine jüdische Frau sich ehewidrig verhalten habe und ob ein Ehemann nicht vielleicht aus sehr egoistischen Gründen die Scheidung verlange.
Auf der politischen Ebene hingegen verschärfte sich teilweise der Umgang mit den geschiedenen Mischehepartnern: Das 1938 formulierte „Angebot“ an die „deutschblütigen“ Frauen, in den „deutschen Blutsverband“ zurückzukehren, wurde in den Folgejahren eingeschränkt. 1943 wurde per Runderlaß geregelt, daß Beamte – männlichen wie weiblichen Geschlechts – Partner, die einmal mit einem Juden verheiratet gewesen waren, nicht ehelichen durften.343 Begründet wurde dies mit der „Achtung und dem Vertrauen“, das den Beamten entgegengebracht würde.
Nichtigkeitserklärungen
Unter den 130 ausgewerteten Urteilen befand sich nur eine Nichtigkeitserklärung einer Ehe, die unter Umgehung der Nürnberger Gesetze geschlossen worden war.344 Das Paar hatte im 26. Oktober 1939 vor einem Hamburger Standesamt die Ehe geschlossen, wobei der jüdische Mann falsche Papiere vorgelegt hatte. Zunächst verhaftet, weil er sich als Lebensmittelgroßhändler rechtswidrig Bedarfsscheine verschafft hatte, wurde auch die illegale Eheschließung offenkundig. Am 2. August 1940 verurteilte das Hanseatische Sondergericht den Ehemann wegen Kriegswirtschaftsverbrechen in Tateinheit mit Urkundenfälschung und wegen Verbrechens gegen das Blutschutzgesetz zum Tode.345 Ein „Rassenschandeverfahren“ gegen die Ehefrau wurde abgetrennt. Sie mußte eine zweijährige Zuchthausstrafe in Lübeck-Lauerhof verbüßen. Gegen die „verwitwete“ inhaftierte Frau beantragte dann der Oberstaatsanwalt beim Landgericht Hamburg die Nichtigkeit der Ehe. Wohlgemerkt: Es ging nicht um eine existierende Ehe oder um Erbschaftsansprüche, die abgewehrt werden sollten. Auch versorgungsberechtigte Kinder waren nicht vorhanden. Dennoch bestand der nationalsozialistische Staat darauf, posthum diese gesetzeswidrige Ehe zu annullieren, als wäre niemals seinem Verbot zuwider gehandelt worden.
4. Scheidungsgründe aus der Perspektive der Geschiedenen
Die Bundesrepublik Deutschland ermöglichte es mit dem „Gesetz über die Anerkennung freier Ehen rassisch und politisch Verfolgter“ vom 23. Juni 1950,346 verhinderte Eheschließungen posthum nachzuholen und vollzogene Scheidungen, die nachweislich unter dem Druck der Verfolgung zustande gekommen waren, zu korrigieren. Die zunächst auf ein Jahr bemessene Frist zur Beantragung wurde 1957 nochmals eröffnet.347 Im Schriftwechsel mit der Landesjustizverwaltung legten die Antragsteller ihre Gründe für die Scheidung dar.
Zunächst fällt auf, daß kein geschiedener Ehemann – weder jüdisch noch nichtjüdisch – ein solches Anerkennungsverfahren angestrebt hat. Nun hatten die jüdischen Männer meist nicht überlebt, und die Gruppe der „deutschblütigen“ Ehemänner geschiedener Jüdinnen war nicht sehr groß. Auch war ein Teil zur Wehrmacht eingezogen und vermutlich gefallen. Zudem hatten die Männer, wenn die geschiedene jüdische Frau ermordet worden war, wahrscheinlich keinen materiellen Grund zur nachträglichen Eheschließung, denn die Frauen dürften über kein nennenswertes Vermögen mehr verfügt haben. Selbst wenn die jüdische Frau überlebt hatte, taten sich die Paare nicht wieder zusammen. Die Scheidungen, auch wenn sie unter äußerem Druck entstanden waren, hatten doch langfristig das Vertrauen in den Partner zerstört. Die meisten hatten neue Familien gegründet.
Von den 22 Antragstellerinnen (darunter nur eine Jüdin),348 die ein Verfahren nach dem Eheanerkennungsgesetz initiierten, hatten die meisten handfeste materielle Gründe, sich an die Landesjustizverwaltung zu wenden. Es ging um Renten, Wiedergutmachung oder Erbansprüche für sich und die Kinder. Insofern sind diese Quellen komplementär problematisch zu den Scheidungsurteilen: In der Scheidungsklage vor 1945 ging es darum, die innere Zerrüttung einer Ehe mit einem Juden so glaubwürdig und widerspruchsfrei zu begründen, daß die Richter die Argumentation akzeptierten und das erwünschte Urteil sprachen, um die Nachteile einer Mischehe für die Ehefrau abzuwenden. In den Eheanerkennungsverfahren nach Kriegsende ging es darum, ebenso glaubwürdig und widerspruchsfrei den äußeren Druck auf die überlebende Partnerin zu schildern und mit Dokumenten und Zeugenaussagen zu belegen, um die Vorteile einer posthumen Mischehe zu erlangen.
Die meisten Antragstellerinnen hatten sich zwischen 1941 und 1943 scheiden lassen.349 Werden die Unterlagen zu den 22 Anträgen verglichen, so fällt auf, daß in den Begründungen der bis 1940 erfolgten Scheidungen die Existenzsicherung in den Mittelpunkt gestellt wurde: Die Frauen machten geltend, angesichts der Diskriminierung ihrer Ehemänner hätten sie die Familie ernähren und versuchen müssen, das Vermögen zu retten. Ohne Scheidung vom jüdischen Ehemann sei kaum ein Arbeitsplatz zu bekommen gewesen.
Eine Ehefrau hatte sich beispielsweise scheiden lassen, um ihren ambulanten Blumenstand zu behalten, nachdem die Standkarte des jüdischen Ehemannes nicht verlängert worden war. Ihr Anwalt wies glaubhaft nach, daß wirtschaftliche Sanktionen nicht – wie die Juristen der Landesjustizverwaltung anführten – erst ab November 1938 begonnen hätten, sondern auf der Ebene antisemitischer Politik der Kammern und Berufsverbände sehr viel früher eingesetzt hatten.350 Im nächsten Schritt prüften die Juristen in der Landesjustizverwaltung, ob die Frau nach der Scheidung „zu ihrem Mann gehalten habe“. Dieser war 1938 in der Pogromnacht verhaftet und ins KZ Sachsenhausen verbracht worden. Zwei Besuche im KZ Fuhlsbüttel konnte die Ehefrau nachweisen, weiteren Kontakt nach Sachsenhausen jedoch nicht. Vor allem aber konnten die Urteilenden keine Anhaltspunkte finden, daß sie ihm in die von seinen Eltern (!) vorbereitete Emigration hätte folgen wollen. Jüdische Verwandte, die ihr Erbe bedroht sahen, legten zudem Widerspruch gegen die Annullierung der Scheidung ein. So erhielt die Antragstellerin folgenden Bescheid:
„Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die Antragstellerin zwar unter normalen Verhältnissen sich kaum von ihrem Mann getrennt hätte, unter dem Druck der nationalsozialistisch-rassischen Verfolgungsmaßnahmen hatte sie aber nicht genug Kraft, standzuhalten. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die Antragstellerin etwas erleichtert war, durch die Scheidung von ihrem jüdischen Mann befreit zu sein (wenn sie auch ein schlechtes Gewissen hatte). Für eine Anerkennung reicht der festgestellte Sachverhalt nicht aus.“351
Diese harte und moralisierende Ablehnung revidierten die Juristen nach einer persönlichen Vernehmung. Sie bescheinigten der Frau zwar weiterhin mangelndes Problembewußtsein, sie habe nur „in den Tag hineingelebt“ und einen „geistigen Habitus von nur geringer Höhe“, doch die Annullierung der Scheidung wurde nun anerkannt.352
Neben dem angeführten Motiv der Existenzsicherung begründete die Mehrzahl der nach 1941 geschiedenen Frauen ihre Initiative mit dem Druck, der durch Maßnahmen der Judenverfolgung, insbesondere durch die Deportationsandrohungen, entstanden sei. Wie in den Scheidungsurteilen angeführt, hatten etliche jüdische Ehemänner bereits Deportationsbefehle erhalten oder – seltener – beiden Partnern war dieses Schicksal angedroht worden. Das wirft die Frage auf, warum sich die „deutschblütigen“ Ehefrauen, die so lange an der Seite ihrer diskriminierten, ausgegrenzten und verfolgten Ehemänner ausgehalten hatten, angesichts des nun zu erwartenden Schicksals trennten und warum nicht diejenigen in „privilegierter“ Mischehe versuchten, diesen fragwürdigen Schutz aufrechtzuerhalten oder wenigstens Verzögerungen bei der Deportation anstrebten.
In einigen Eheanerkennungsverfahren werden diese Fragen angesprochen.353 Ein in („nichtprivilegierter“?) Mischehe lebendes Paar hatte nach dem Bericht der überlebenden Ehefrau bereits 1941 einen gemeinsamen Deportationsbefehl erhalten. Sie wandte sich daraufhin an einen Bekannten mit guten Beziehungen zur Gestapo. Dieser riet zur schnellen Scheidung, dann würden die Befehle aufgehoben, was auch geschah. Nach dem Bericht der Ehefrau erfolgte die Scheidung einvernehmlich, und das Paar lebte weiterhin zusammen – bis der Ehemann 8 Monate später einen erneuerten „Evakuierungsbescheid“ erhielt, dem er Folge leisten mußte.354 Die Landesjustizverwaltung hielt der Frau vor, sie habe für die Einvernehmlichkeit keinen Beweis angetreten, sondern „die Scheidung angestrebt, um persönlichen Schwierigkeiten zu entgehen. Durch die Scheidung sei E. der damals noch mögliche Schutz der Mischehe verloren gegangen, so daß sich die Scheidung offenbar zu seinem Nachteil ausgewirkt habe.“355 Auch hier wurde die Scheidung erst im zweiten Versuch annulliert, wobei nicht geklärt wurde, ob von einem „Schutz“ durch die Ehe überhaupt die Rede sein konnte.
In anderen Fällen hatten sich die Ehefrauen sogar im eigenen Interesse um Beschleunigung des Verfahrens bemüht: Ein jüdischer Ehemann hatte gleich nach der Verhaftung im Mai 1943 einen „Evakuierungstermin“ genannt bekommen. Der Anwalt seiner Frau fürchtete, ohne Scheidung würde er „zwangsweise verschleppt“. Im Verein mit dem jüdischen „Rechtskonsulenten“ des Ehemannes gelang es, „in kürzester Frist die Aufhebung der Ehe herbeizuführen, was (…) aus dem angegebenen Grunde notwendig war.“356 Eine andere Ehefrau fürchtete „Zustellungsschwierigkeiten“ bei der Übermittlung des Scheidungsurteils nach einer Deportation.357
Etliche von der Gestapo unter Druck gesetzte Ehefrauen erbaten in ihrer heiklen Situation Rat von der RVJD, deren Vorsitzender Max Plaut ihnen bestätigte, daß sie mit ihrer Entscheidung Einfluß auf das weitere Schicksal ihres Mannes nehmen und per Scheidung die bessere Variante herbeiführen könnten. An wen hätten sie sich sonst wenden können? Unisono rieten Anwälte, Bekannte und der Vertreter der Reichsvereinigung zur schnellen Scheidung und bemühten sich mit vereinten Kräften, diese noch vor dem gesetzten Termin abzuwickeln – und trugen damit gemeinsam dazu bei, der Deportation den Anstrich der milderen Lösung zu geben. Auch nach dem Krieg revidierte Plaut seine Ratschläge nicht, sondern bestätigte im einzelnen rückblickend:
„Nur wenige Frauen haben sich so opfermutig unter persönlicher Gefahr eingesetzt wie Sie für Ihren Mann. Daß Sie sich damals scheiden ließen, geschah auf Veranlassung des Gestapobeamten Wohlers, der Ihnen den Tod Ihres Mannes als Folge der Einweisung in das KZ Auschwitz androhte, falls Sie sich nicht scheiden ließen. Andernfalls bestand Hoffnung, daß er lebend durchkäme (…). Darüber hinaus erkenne ich noch heute dankbar an, daß Sie und ihre Freundin unter Gefahr bis zum Schluß regelmäßig Lebensmittel aller Art zu uns (d.h. zum Gemeindebüro) brachten, die wir nach Theresienstadt geschickt haben und mit denen Sie dazu beigetragen haben, das Schicksal von Gefangenen zu mildern und vielleicht deren Leben zu retten (…).“358
Der Gestapobeamte Wohlers359 hatte dieser Frau versprochen, daß nach erfolgter Scheidung „nur“ Theresienstadt, sonst aber Auschwitz Ziel der Deportation sei. Ähnlich gelagert war der Fall eines anderen Paares, wo der jüdische Ehemann ebenfalls verhaftet war. Deren Tochter faßte die Vorgänge, die zur Scheidung führten, zusammen:
„Viele Bemühungen meiner Mutter und von mir, die Freilassung meines Vaters zu erreichen, schlug[en] fehl. Meine Mutter wurde vielfach allein und einige Male mit mir gemeinsam sowohl bei der Gestapo als auch bei den Betreuungsstellen für jüdische Inhaftierte [gemeint: Gemeindebüro, B.M.] vorstellig, jedoch waren alle Schritte zur Freilassung erfolglos. Wiederholt wurde meiner Mutter damals von Gestapo-Angehörigen, von jüdischen Betreuungsstellen sowie von anderen Verfolgten nahe gelegt, daß die Aufrechterhaltung der Ehe meinem Vater besonders schwere Verfolgungen verursachen würde. Wenn der damals als „Blutschande“ [gemeint: Rassenschande, B.M.] hingestellte Zustand bestehen bliebe, werde mein Vater in ein Konzentrationslager kommen, in welchem [sie] mit seinem Tode rechneten. Bei Trennung der Ehe sei mit einer günstigeren Behandlung meines Vaters zu rechnen. Dann würde er äußerstenfalls evakuiert werden. Von den Angehörigen Evakuierter hatten wir damals gehört, daß es sich bei der Evakuierung mehr um eine Umquartierung handele und daß die Betroffenen bereits seit vielen Monaten Postverbindung hatten, sowie daß Evakuierte Paketsendungen empfangen durften.“360
Nun waren zwar nicht alle, aber doch die meisten geschiedenen Juden nach Theresienstadt transportiert worden, insofern stimmte die Mitteilung, die Plaut und die Gestapobeamten übereinstimmend weitergaben. Nur sagten sie nicht, wie die Zustände in dem „Altersghetto“ selbst waren, wo etliche geschiedene Männer den Tod fanden, und daß Theresienstadt die Durchgangsstation nach Auschwitz war.
Während einige geschiedene Ehefrauen oder Ehemänner den Kontakt zum deportierten Partner nicht aufrecht erhielten, bemühten sich andere darum, ihnen die Situation im KZ zu erleichtern. So schrieb ein geschiedener Anwalt an Plaut, seine Frau hätte einen vertraglichen Unterhaltsanspruch und fragte an, ob er ihr Unterhaltsgelder nach Theresienstadt überweisen könne.361 Plaut riet ihm, Lebensmittelpäckchen zu schicken: „Zweifelsohne würde Ihre Frau sich sehr freuen, wenn sie regelmäßig von Ihnen oder Ihrem Sohn Sendungen erhält.“362
Einem besonderen Druck unterlagen die „deutschblütigen“ Ehefrauen von Ostjuden. Hier spielte neben der Existenzsicherung und der Deportationsandrohung auch der Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft eine große Rolle. Bei Abschiebungen der Ehemänner waren Frauen und Kinder mitbetroffen. So reichte eine geschiedene Frau einen Eheanerkennungsantrag ein, die mit einem Ehemann polnischer Herkunft verheiratet war, der später staatenlos wurde.363 Sie war bei der Eheschließung zum jüdischen Glauben konvertiert und erzog beide Söhne jüdisch. 1938 erfolgte die Deportation der Familie im Rahmen der „Polen-Aktion“. In Abwesenheit wurden die beiden Einzelhandelsgeschäfte in Hamburg „arisiert“. 1939 kehrte die Familie, die in Polen keinen Fuß fassen konnte, illegal zurück. Der Ehemann wurde gefaßt und 1939/40 im KZ Fuhlsbüttel inhaftiert, am 25. Oktober 1941 nach Lodz und am 25. April 1942 weiterdeportiert. Er galt nach Kriegsende als verschollen.364 Die staatenlose Familie war indes mittellos und auf die Wohlfahrt angewiesen. So gab die Ehefrau als offiziellen Scheidungsgrund einen Ehebruch des Mannes mit einer inzwischen emigrierten Jüdin an. „Mein Mann, welcher inzwischen krankheitshalber aus der Haft entlassen worden war, und ich nahmen an, daß diese wirtschaftliche Not wohl kaum als Scheidungsgrund gelten würde und so sind wir übereingekommen, Ehebruch anzugeben.“365 Vor der Scheidung war es der Ehefrau nicht gelungen, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Erst danach konnte sie die beiden minderjährigen Kinder ernähren. Nach ihrer Aussage trat sie nie aus der jüdischen Gemeinde aus, wurde aber trotzdem nicht weiter als Jüdin geführt oder behandelt.366 Ihre Kinder hingegen bekamen als „Geltungsjuden“ 1943 den Deportationsbefehl nach Theresienstadt, von wo sie nicht zurückkehrten.367 Die Landesjustizverwaltung erkannte ohne Vorbehalte die rückwirkende Eheschließung an.368
Während diese Familie nach Hamburg zurückgekehrt war, versuchten andere Abgeschobene, sich in die Herkunftsländer der jüdischen Ehemänner zu integrieren – und gerieten dort nach der deutschen Besetzung in die Verfolgung der einheimischen Juden, die von keinerlei Rücksicht auf „deutschblütige“ Verwandte oder wichtige Beziehungen gemildert war. So hatte eine Ehefrau fast ein Jahr mit Mann und Kleinkind im Niemandsland zwischen Deutschland und Polen gelebt. Nach Ausbruch des Krieges gingen sie nach Lemberg. Die deutschen Truppen und der Gestapoapparat holten sie dort ein. Die überlebende Ehefrau legte der Landesjustizverwaltung das vom 17. März 1942 datierte „Scheidungsurteil“ des Lemberger deutschen Sondergerichts vor, das – nach ihrer Version – ohne Initiative von einem der Ehepartner gesprochen worden war. Dem Paar war nach Vorladung lediglich formell die Tatsache der Scheidung eröffnet worden.369 Das Sondergericht hingegen hielt schriftlich fest, die Ehefrau habe die Klage eingereicht. Nach der Scheidung versteckte die Ehefrau ihren nun „geschiedenen“ Mann mehrere Monate in ihrer Wohnung im „arischen“ Viertel Lembergs, bis Nachbarn sie im Juli 1943 denunzierten. Beide wurden verhaftet, das Kind in ein polnisches Waisenhaus gebracht, der jüdische Ehemann deportiert.370 Der Vorwurf des Sondergerichts gegen die Ehefrau lautete „Judenbeherbergung“ und zog ein Todesurteil nach sich.371 Ein Gnadengesuch ihrer Familie reduzierte die Strafe auf ein Jahr Gefängnis. Als die Todeskandidatin von der Begnadigung erfuhr, hatte sie dieses Jahr beinahe abgesessen. Eine Woche später befreite die Rote Armee die Frau, die „seelisch und körperlich vollkommen erschöpft“ nach Hamburg zurückkehrte.372 Die Landesjustizverwaltung insistierte angesichts dieses Schicksals nicht auf der Klärung einiger Widersprüche, sondern erkannte die Ehe rückwirkend an.373
Die Familie eines aus Ungarn stammenden Juden war nach der Pogromnacht im November 1938 ausgewiesen worden. In Budapest gelang es ihr nicht, eine neue Existenz aufzubauen. Zudem gab es Probleme mit der ungarischen Staatsangehörigkeit aufgrund der jahrelangen Abwesenheit des Ehemannes. Das nun staatenlose Ehepaar zog mit zwei minderjährigen Kindern ins damalige Agram (Jugoslawien). Nach der Besetzung Jugoslawiens wurden beide verhaftet und getrennt in Lager eingewiesen. Auch diese Ehefrau war anläßlich der Heirat zur jüdischen Religion übergetreten und damit stark gefährdet.374 Im Lager Draganice (Kroatien), einem „Lager für Juden und Mischehen“, gebar sie ihr drittes Kind. Vor die Entscheidung gestellt – so die Version der Antragstellerin – in die Scheidung einzuwilligen und das Lager dann mit den Kindern verlassen zu können, kehrte sie nach Hamburg zurück.375 Dort reichte sie die Scheidung ein, um erwerbstätig sein und die deutsche Staatsangehörigkeit zurückerlangen zu können.376 Während sie sich 1942 scheiden ließ, liquidierten Wehrmacht, Gestapo und Ustascha das Lager und töteten die Insassen in Gaswagen. Auch hier billigte die Landesjustizverwaltung den Antrag.377
Zwar hatte die nationalsozialistische Regierung ein Interesse daran, die „deutschblütigen“ Frauen zur Scheidung zu veranlassen und sie als Mütter erwünschter Kinder, die sie in zweiter Ehe gebären sollten, wieder in die Volksgemeinschaft aufzunehmen. Doch die deutsche Staatsbürgerschaft erhielten geschiedene, ehemals deutsche Frauen von staatenlosen Juden nicht wie selbstverständlich zurück. Stellten sie nach der Scheidung einen entsprechenden Antrag, wurde dieser gründlichst geprüft und die Wiedereinbürgerung durchaus bisweilen verweigert.378
Zwischenresümee
Eine Analyse der Scheidungsurteile und der Eheanerkennungsverfahren gibt Einblick, von welchen Seiten Druck auf die „deutschblütigen“ Ehefrauen ausgeübt wurde: Von Vorgesetzten, Vermittlern im Arbeitsamt, mittelständischen Berufsvereinigungen, Fürsorgerinnen, Vermietern, Gestapo und Nachbarn. Die Vertreter der RVJD unterstützten Scheidungsüberlegungen ebenso wie die Anwälte (einschließlich der jüdischen „Konsulenten“) und oft auch die eigene Familie. Bei den nichtjüdischen Ehemännern kamen die militärischen Vorgesetzten hinzu.
Insbesondere, wenn zum sozialen Abstieg, der schlechten Versorgungslage während des Krieges und anderen materiellen Momenten noch die Inhaftierung des Ehemannes und das ohnehin scheinbar kaum abwendbare, nur leicht verbesserbare Schicksal der „Evakuierung“ kam, dürften äußere Bedingungen die Entscheidung präjudiziert haben. Zudem standen die Frauen oftmals subjektiv vor der „Wahl“, nach den bedrückenden Jahren von 1933 bis 1942/43 nun auch den Weg in die Konzentrationslager mitzugehen. Die Scheidung schien die letzte Möglichkeit, das eigene Überleben zu gewährleisten und gleichzeitig, wenn sie auf die Auskunft der RVJD und der Gestapo vertrauten, auch dem Ehemann eine entsprechende Chance zu verschaffen. Die Richter wirkten eifrig im Sinne einer „Rassentrennung“ an diesem Prozeß mit. Dennoch: Getroffen wurde die Entscheidung, sich vom Partner loszusagen, in der Mehrzahl von nichtjüdischen Frauen, die so zwar nicht zu Täterinnen, aber doch zu Akteurinnen im Prozeß der Ausgrenzung und Verfolgung wurden und damit eine Rolle einnahmen, an die sie nach dem Krieg nicht gern erinnert werden wollten.
Jahrzehnte später können die Motive der Frauen nicht mehr eindeutig geklärt werden. Dennoch liegt die Vermutung nahe, daß der rasante soziale Abstieg bis hin zur Verarmung eine nicht unwesentliche Rolle bei der Entscheidung gespielt hat, die Scheidungsklage einzureichen. (Nicht nur) diese Frauen hatten die Ehe meist aus Versorgungsgründen geschlossen, sie waren in eine höhere soziale Schicht aufgestiegen und in der Regel wesentlich jünger als ihr Ehemann. Zudem sahen sich die Ehefrauen mit expliziten und unausgesprochenen Forderungen konfrontiert, von denen sie sich überfordert fühlten, die sie nicht erfüllen konnten oder wollten. Auch hatten sich die Beziehungsstrukturen und teilweise die Persönlichkeit der Ehepartner unter dem äußeren Druck verändert.
Dies betraf die Mischehen mit jüdischen Frauen weniger. Der Verfolgungsdruck war zunächst geringer und setzte sehr viel später ein. Die Verbindungen der relativ altersgleichen Eheleute, deren Hochzeit keinen Wechsel der Herkunftsschicht mit sich gebracht hatte, erwiesen sich dem äußeren Druck gegenüber als stabiler.
Das nationalsozialistische Regime hatte bezogen auf die Mischehen seine Verfolgung geschlechtsspezifisch ausgerichtet: Diejenigen, in denen der Mann jüdisch war, unterlagen stärkeren Repressionen als diejenigen mit jüdischer Ehefrau. Nach einer – vom Regime intendierten, mit allen Mitteln forcierten und in der Rechtsprechung später „geschlechtsneutral“ gehandhabten – Scheidung war die jüdische Frau weiterhin bedingt geschützt, wenn sie minderjährige, nicht jüdisch erzogene Kinder versorgte.379 Der jüdische Mann genoß diesen Schutz nicht. Von den geschiedenen Juden wurden prozentual weit mehr Männer als Frauen ermordet. Andererseits ging es hier um die zahlenmäßig relativ kleine Gruppe der in Deutschland in Mischehe lebenden Jüdinnen und Juden. In den besetzten östlichen Gebieten wurden beide Teile von Mischehen, ob jüdisch oder nicht, in die Mordpolitik einbezogen, in den westlichen die jüdischen Partner, da dort eine gesetzliche Mischehen-Definition fehlte380 – wie ja im „Altreich“ eigentlich auch.
Die Historikerin Gisela Bock fordert, im Zentrum einer angemessenen Analyse der nationalsozialistischen Rassenpolitik müßten ihre Akteure und ihre Opfer stehen, wenngleich sie diesen Anspruch nicht auf die Gruppe der in Mischehe lebenden Frauen und Männer bezieht.381 Doch ihr auf der Betrachtung der Sterilisations- und Vernichtungspolitik beruhendes Ergebnis, daß die nationalsozialistische Rassenpolitik weder geschlechterneutral noch die nationalsozialistische Geschlechterpolitik rassenneutral war,382 gilt auch für die Mischehenverfolgung, allerdings mit Abweichungen: Die rassenpolitisch gleiche Behandlung der Opfer ist hier zwar im Prinzip gegeben, in der Praxis jedoch zeigt sich im „Altreich“ eine Tendenz zur stärkeren Verfolgung des jüdischen Mannes. Diese reichte von der Strafverfolgung in „Rassenschandeurteilen“ bis zur Deportationspraxis geschiedener Mischehepartner.
Akteure der Verfolgung sind neben den aufgezählten Instanzen die nichtjüdischen Ehefrauen und – im weit geringeren Maße – die nichtjüdischen Ehemänner.383 Dies muß auch Nathan Stoltzfus entgegengehalten werden, wenn er – in dem Bemühen, Widerstandspotentiale im deutschen Volk zu orten – die geringe Scheidungsziffer von Mischehen generell und den vielbeachteten Berliner Protest der Ehefrauen der in der „Fabrik-Aktion“ verhafteten Juden im besonderen als „Akt politischer Opposition“ definiert. „Die mit Juden verheirateten Deutschen trotzten der Gestapo an einem den Nationalsozialisten besonders wichtigen Punkt. Für ihre Ehe riskierten sie ihr Leben, ein öffentlicher Dissens, der dem nationalsozialistischen Mythos der makellosen deutschen ‚Volksgemeinschaft‘ abträglich war. Ihre Verweigerung bedrohte die soziale und politische Einheit der Nation.“384 Die alltägliche Tatsache, daß aus einem Teil der Mischehen Kinder hervorgegangen waren, verbucht Stoltzfus ebenfalls auf der Widerstandsseite und meint damit, daß diese Paare der deutschen Bevölkerungsplanung Gebärfähigkeit entzogen hätten. Er gesteht zwar zu, daß die meisten Paare eine Scheidung aus „der alten sozio-religiösen Tradition des Respekts vor dem Ehegelöbnis“ nicht erwogen, konstatiert bei ihnen aber dennoch „lebensgefährlichen zivilen Ungehorsam“.385 In der Protestaktion der Frauen gegen die vermeintliche Deportation ihrer Ehemänner, die nachweislich zur Beunruhigung der Nationalsozialisten führte, sieht er dann den Kulminationspunkt, an dem ziviler Ungehorsam, Dissens, Verweigerung und private Opposition ineinanderflossen. „Dies war das folgerichtige Ergebnis einer Kette von Handlungen, die sich gegen die nationalsozialistischen Maßnahmen richteten.“386 Die „Belege“ der Stoltzfus’schen Argumentation bestehen weniger in der erschließenden Bearbeitung neuer Quellen als in einer radikalen Neubewertung von aktivem und passivem Verhalten. Das gemeinsame Erdulden der Verfolgung wird zum aktiven Widerstandsverhalten umgedeutet – und der aktive Ausstieg aus diesem Prozeß ignoriert. Semantische Herleitungen wie: die „arischen Mischehepartner widersetzten sich“, „trotzten“, „riskierten“, „blockierten“ oder „zerstörten den blinden Gehorsam“ suggerieren auf semantischer Ebene Aktivität dort, wo Treue und gemeinsames Erleiden, also eher passivische Momente, oder auch Trennung den Verfolgungsalltag bestimmten. So wirft Dipper Stoltzfus zu Recht vor, rückblickend die Dinge objektiv – die „Mischehe“ bedeutete immerhin einen gewissen Schutz für Juden – wie subjektiv – die Protestierenden wollten ihre Männer nicht verlieren und konnten einflußreiche Verwandte und Bekannte mobilisieren – auf den Kopf zu stellen.387
Ein „Bollwerk Familie“388 waren die Mischehen nicht, sondern sie spiegelten die gesellschaftlichen Prozesse im privaten Bereich wider: Ab- und Ausgrenzung, Angst, Gleichgültigkeit, die hilflose Suche nach Auswegen und manchmal fast übermenschliche Anstrengungen, als Individuen einem übermächtigen gesellschaftlichen Druck standzuhalten oder ihn gar emotional auszugleichen. So wünschenswert es dem nachgeborenen Forscher erscheinen mag: Weder die jüdischen noch die nichtjüdischen Partner in Mischehen bildeten ein Widerstandspotential, wenngleich die bloße Tatsache der Existenz dieser Ehen – und darauf hat Bruno Blau bereits Ende der vierziger Jahre hingewiesen – für Nationalsozialisten provokativ genug war. Allein das Wissen um diese Ehen und deren Nachkommenschaft führte auch die Verfolger zu Fragestellungen, die Grenzbereiche von Eigenem und Fremdem berührten, und deren Antwort, wenn sie Vernichtung hieß, bedeutete, daß „arisches Blut“ mit vernichtet werden würde.
Daß Mischehen bis zum Ende der NS-Diktatur bestanden, beruhte auch nach Blau auf der Standhaftigkeit ihrer nichtjüdischen Teile, die dem Vernichtungswillen immer wieder getrotzt hätten.389 Allerdings will diese Beurteilung ebenfalls nichts von den tatsächlichen Auswirkungen auf die innere Verfassung dieser Ehen bis hin zu deren Zerfall wissen.
Die Elterngeneration der „Mischlinge“ war – wie aus dem vorangegangenen deutlich wird, einem starken Druck ausgesetzt. In den Jahren 1933–1938 wurde sie mit anderen Juden gleichbehandelt, d.h. sie verlor Besitz und bürgerliche Rechte. Danach galten Ausnahmen bis zur zeitlich versetzten, schrittweisen Einbeziehung in die verschärften Maßnahmen. Da ihre von den Rassenideologen beabsichtigte Einbeziehung in die „Endlösung“ 1942 scheiterte, waren die letzten zweieinhalb Jahre der NS-Herrschaft für sie durch mehrere Prozesse gekennzeichnet:
– Gegen die Mischehen mit jüdischen Ehemännern verschärften sich die regionalen Repressionsmaßnahmen stetig, obwohl reichsweit die Verfolgung stagnierte. Dies wurde durch die Wohnraum- und Lebensmittelknappheit sowie den Arbeitskräftemangel in den Endkriegsjahren verstärkt. Besitz und Arbeitskraft von Juden wurden von regionalen Behörden und einzelnen Verantwortlichen zunehmend als staatliche Reserven und Manövriermasse behandelt, wobei nichtjüdische Familienmitglieder mitbetroffen waren. Dennoch kristallisierte sich kein regionales Verfolgungsprofil heraus, obwohl einzelne in der Stadt Hamburg praktizierte Regelungen weit von den reichseinheitlichen Vorgaben abwichen. Die örtlichen Repräsentanten der RVJD waren in fast jeden Verfolgungsschritt einbezogen, sorgten für reibungslose Abläufe, organisierten aber auch Rettungsaktionen und versuchten, Härten zu verhindern oder im Einzelfall zu intervenieren. Vor allem gewährleistete die Organisation einen Gruppenzusammenhang, der nach der Deportation der nicht in Mischehe lebenden Juden nicht mehr existiert hätte.
– Die Gestapo verunsicherte durch eigene Verhaftungsaktionen und Kriminalisierung einzelner Personen die in Mischehen Lebenden, die als Folge besonderen Wert auf Gesetzestreue und Unauffälligkeit legten. Aus den Quellen wird immer wieder deutlich, daß im Einzelfall weder das Fehlen reichsweiter Anordnungen noch der angebliche Schutz der „Privilegierung“ einer Mischehe Sicherheit boten.
– Die späte Einbeziehung der Mischehen, in denen die Ehefrau jüdischer Herkunft war, schützte diese Gruppe bis Ende 1944/Anfang 1945 vor den Repressionen, denen Mischehen in anderer Konstellation bereits seit 1942/43 ausgesetzt waren.
– Der jahrelange Druck auf die Mischehen hatte insofern Erfolg, als er zu einer sehr viel höheren als bisher angenommenen Scheidungsrate führte, die ich aufgrund meiner Quellenauswertung für Hamburg mit ungefähr 20% ansetze. Scheidungen und Aktionen der Gestapo zusammen ermöglichten die partielle Einbeziehung der jüdischen Mischehepartner in den Judenmord immer dann, wenn der jüdische Ehepartner durch Scheidung oder Verhaftung aus dieser Verbindung herausgelöst war.
Anmerkungen: Erster Teil
1 Vgl. Baruch Zwi Ophir, Zur Geschichte der Hamburger Juden 1919–1939, in: Peter Freimark (Hrsg.), Juden in Preußen – Juden in Hamburg, Hamburg 1983, S.81-97, S.79f.
2 Vgl. Kerstin Meiring, Die Christlich-Jüdische Mischehe in Deutschland 1840–1933, Hamburg 1998, S.140. Dieser Prozeß war nicht auf das Deutsche Reich beschränkt, sondern fand von Kopenhagen bis Triest statt, das die höchste europäische Mischehenzahl im Jahre 1927 verzeichnete. Vgl. Arthur Ruppin, Die Verbreitung der Mischehe, in: Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, 4 (1930), S.53-58, hier: S.53f.
3 Dietz Bering, Der Name als Stigma. Antisemitismus im deutschen Alltag 1812–1933, Stuttgart 1987, S.289, vgl. dazu insbesondere das Kapitel „Namensprobleme bei Mischehen“, S.302-305. Mit der keineswegs liberaleren Änderungspraxis in Hamburg befaßt sich Hans Dieter Loose, Wünsche Hamburger Juden auf Änderung ihrer Vornamen und der staatliche Umgang damit. Ein Beitrag zur Geschichte des Antisemitismus im Hamburger Alltag 1866–1938, in: Peter Freimark / Alice Jankowski / Ina S. Lorenz (Hrsg.), Juden in Deutschland, Hamburg 1991, S.58-80.
4 Vgl. Ina Lorenz, Die Juden in Hamburg zur Zeit der Weimarer Republik, Bd. I, Hamburg 1987, S.LIII. Vgl. auch Mosche Zimmermann, Hamburgischer Patriotismus und deutscher Nationalismus. Die Emanzipation der Juden in Hamburg 1830–1865, Hamburg 1979, S.205ff.
5 Vgl. Leo Lippmann, „ … Dass ich wie ein guter Deutscher empfinde und handele“. Zur Geschichte der Deutsch-Israelitischen Gemeinde in Hamburg in der Zeit vom Herbst 1935 bis zum Ende 1942, Hamburg 1993, S.39.
6 In den Jahren 1906/1910 wurden in Hamburg bereits 25% aller Eheschließungen, an denen Jüdinnen oder Juden (Mitglieder der jüdischen Gemeinde) beteiligt waren, interkonfessionell geschlossen. Damit lag die Mischehenziffer in Hamburg weit über dem Reichsdurchschnitt (knapp 8%) und war höher als in Berlin (ca. 15%). (Vgl. ebd., S.143). 1925 kletterte sie auf 44,19% der Eheschließungen, während der Anteil der Juden, 20.000 Gemeindemitglieder, aufgrund der vergrößerten übrigen Hamburger Bevölkerung auf 1,73% gesunken war (vgl. Lippmann, Geschichte, S.39). In Preußen datierten die ersten Mischehen aus dem Jahr 1847, als bei den Ortsgerichten Register für die Eheschließungen der Angehörigen solcher Religionsgemeinschaften eingeführt wurden, deren Geistliche keine Amtshandlungen mit zivilrechtlicher Wirkung vornehmen durften. Das Preußische Personenstandsgesetz vom 9.3.1874 führte dann die obligatorische Zivilehe ein (BAP, R 22, Reichsjustizministerium, 459, Kammergerichtspräsident Berlin an den Preußischen Justizminister vom 22.3.1934, Betrifft: Konfessionelle Mischehen zwischen Christen und Juden).
7 Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, 3.u.4. (1924), (o. Verf.), S.79. Das mit den Nürnberger Gesetzen 1935 gegen die Juden erlassene Verbot der Mischeheschließung hätte – so Blau – „bei einer längeren Dauer zur inneren Stärkung ihrer Gemeinschaft beigetragen“ (Bruno Blau, Die Mischehe im Nazireich, in: Judaica 4 (48), S.46-57, hier S.46).
8 Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, 4-6 (1926), Die Mischehe in Deutschland, S.129.
9 Vgl. Noakes, Nazi Policy, S.291, und Ophir, Hamburger Juden, S.89ff.
10 Vgl. R. E. May, Die Entwicklung der jüdischen Mischehen und ihre Wirkung auf die jüdische Gemeinschaft, in: Lorenz, Juden, Bd. I, Dok. 15, S.63.
11 Vgl. Lorenz, Juden, S.LIV-LVII und Meiring, Mischehe, S.84.
12 Vgl. zum Hamburger Modell der Gemeinde- bzw. Kultuszugehörigkeit Ina Lorenz, Das „Hamburger System“ als Organisationsmodell einer jüdischen Großgemeinde. Konzeption und Wirklichkeit, in: Robert Jütte / Abraham P. Kustermann (Hrsg.), Jüdische Gemeinden und Organisationsformen von der Antike bis zur Gegenwart, Wien / Köln / Weimar 1996, S.221-255.
13 Die Volkszählung von 1939 weist 921 „Glaubensjüdinnen“ unter den „deutschblütigen“ Ehefrauen aus (vgl. Statistik des Deutschen Reichs, Band 552,4, Volkszählung. Die Bevölkerung des Deutschen Reichs nach den Ergebnissen der Volkszählung 1939, Heft 4, Die Juden und jüdischen Mischlinge im Deutschen Reich, Berlin 1944, S.4/61). Aus den in der Nachkriegszeit in Hamburg eingereichten Anträgen zur nachträglichen Eheanerkennung wird deutlich, daß ehemals christliche Ehefrauen von Juden, die aus Polen oder (seltener) Ungarn oder Rumänien stammten, häufiger als andere Frauen zur jüdischen Religion übertraten.
14 Vgl. Lorenz, Juden, S.LXI.
15 Ebd., S.5 ff.
16 Die „Proselytentaufen“ der Kirchengemeinden Hoheluft, Eppendorf, Harvestehude, Eimsbüttel und West-Eimsbüttel, die zum Großteil Juden betrafen, stiegen von 1 (1.1.-1.3.1932) auf 9 (1.1-31.3.1933), 18 (1.4.-30.6.1933) an und sanken dann auf 14 (1.10.-31.3.1934), 4 (Mai 1934), 2 (Oktober 1934), keine (Dezember 1934). Archiv der Nordelbischen Landeskirche (ANLK), BX e s 2.7 3, Proselytentaufe und Übertritte 1932–1934.
17 Archiv des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden (AIGJ), Archiv der Jüdischen Gemeinden, Beiakte zu C 6 (Mischehen), Vorlage Löffler an Lippmann v. 10.3.41, Bl. 4-7.
18 Vgl. Lexikon des Judentums, Chefredakteur J.F. Oppenheimer, Gütersloh 1967, S.514.
19 Vgl. Ursula Büttner, Die Not der Juden teilen, Hamburg 1988, S.14.
20 Statistik des Deutschen Reichs, Band 552,4, S.4/62f.
21 Vgl. Herbert A. Strauß, Jewish Emigration from Germany. Nazi Policies and Jewish Responses (I), in: Leo Baeck Yearbook XXV, 1980, S.313-358, hier: S.317. Hilberg nennt für 1939 im Reichs- und Protektoratsgebiet 30.000 Mischehen und immer noch 27.744 am 31.12.1942, vgl. Hilberg, Vernichtung, S.177.
22 Weitere Ergebnisse der Volks-, Berufs- und Betriebszählung vom 17. Mai 1939 in der Hansestadt Hamburg, in: Aus Hamburgs Verwaltung und Wirtschaft (Sondernummer 5), herausgegeben vom Statistischen Amt der Hansestadt Hamburg, Hamburg, 1.8.1941, S.20.
23 Vgl. Lippmann, Geschichte, S.41.
24 Ebd., S.74.
25 Lippmann gibt diese Zahl für „Ende 1941“ an (vgl. Lippmann, Geschichte S.76); für November 1941 hatte er 1.036 Mischehen und 198 Juden aus aufgelösten Mischehen, aus denen Kinder hervorgegangen waren, aufgeführt (vgl. ebd., S.74).
26 Die Zahl von 1.262 enthält sowohl Personen, die in „privilegierter“ wie in „nichtprivilegierter“ Mischehe lebten. Die Bezirksstelle Nordwestdeutschland der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland (RVJD), die die „Zahl der Juden am 31. Dezember 1942“ ermittelte, wies darauf hin, daß „ständig neue Personen als Juden erfaßt“ würden, während eine kleinere Zahl als Nichtjuden aus der Kartei der Reichsvereinigung ausschied (vgl. Der juedische Religionsverband Hamburg im Jahre 1942. Die Liquidation der juedischen Stiftungen und Vereine in Hamburg, in: Lippmann, Geschichte, S.119). An anderer Stelle vermerkt Lippmann, daß zum 31.12.1942 in „nichtprivilegierter“ Mischehe 250, in „privilegierter“ 911 und 171 Personen jüdischer Herkunft aus aufgelösten Mischehen lebten (vgl. ebd., S.93).
27 Archiv Forschungsstelle für Zeitgeschichte (ehemals Forschungsstelle für die Geschichte des Nationalsozialismus in Hamburg), FZH, 6262, Bericht über die Jüdische Gemeinde in Hamburg, undatiert (Sommer 1945), S.1 und S.3. Die New Yorker Zeitung „Aufbau“ veröffentlichte Listen der Juden, die in Hamburg überlebt hatten. Vgl. Aufbau v. 20.7.1945 (Liste der Männer) und 27.7.1945 (Liste der Frauen).
28 Dieser Hinweis, später abgedruckt im Ministerial-Blatt des Reichs- u. Preußischen Ministeriums des Innern, Ausgabe 25 v. 23.6.1937, findet sich in den Überlieferungen etlicher Behörden, so beispielsweise in StaHH, 352-3, Gesundheitsbehörde, II V 7 und ebd., 361-2 VI, Oberschulbehörde VI, Lag. 1887.
29 Vgl. Cornelia Essner, Die Alchemie des Rassenbegriffs und die „Nürnberger Gesetze“, in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung 4, herausgegeben von Wolfgang Benz, Frankfurt 1995, S.201-223, hier: S.207.
30 Vgl. Peter Weingart / Jürgen Kroll / Kurt Bayertz, Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland, Frankfurt 1992, S.499f.; vgl. auch Adam, Judenpolitik, Kapitel I / A, Düsseldorf 1979, S.19-38.
31 Vgl. Lösener, Als Rassereferent im Reichsministerium des Innern, in: Dokument: Das Reichsministerium des Innern und die Judengesetzgebung, in: VfZ 9 (1961), S.261-313.
32 Vgl. Lothar Gruchmann, „Blutschutzgesetz“ und Justiz, in: VfZ 31 (1983), S.418-442, hier: S.429.
33 Ebd.
34 Vgl. Essner, Rassenbegriff, S.206.
35 Achim Gercke, Grundsätzliches zur Mischlingsfrage, in: Nationalsozialistische Monatshefte, 38 (Mai 1933), S.197-202, hier: S.199.
36 Otmar Freiherr von Verschuer, „Was kann der Historiker, der Genealoge und der Statistiker zur Erforschung des biologischen Problems der Judenfrage beitragen? in: Forschungen zur Judenfrage Bd. 2, Sitzungsberichte der zweiten Arbeitstagung der Forschungsabteilung Judenfrage des Reichsinstituts für Geschichte des neuen Deutschlands v. 12. bis 14. Mai 1937, Hamburg 1937, S.216-222, hier: S.219.
37 Vgl. Alexander Paul, Jüdisch-deutsche Blutsmischung. Eine sozialbiologische Untersuchung (Veröffentl. aus dem Gebiete des Volksgesundheitsdienstes, Heft 470), Berlin 1940.
38 Ebd., S.9.
39 Vgl. ebd., S.21.
40 Seine Ausführungen zur erbgesundheitlichen Belastung sind pseudowissenschaftlich bis absurd. Sein Schichtenmodell, in dem er Begriffe wie „Kaufmannssippe“ oder ähnliches verwendet, verrät auch terminologisch, daß er überzeugter Nationalsozialist war. Trotz dieser Vorbehalte und Einschränkungen verfügte Paul jedoch über so detailliertes Untersuchungsmaterial, daß seine schichtenspezifischen Untersuchungen aussagekräftig sind. Heutige Soziologen würden – mit anderer Terminologie und anderer Feindifferenzierung – zu sehr ähnlichen Ergebnissen bezogen auf die soziale Schichtung kommen.
41 Paul, Blutsmischung, S.35.
42 Ebd., S.42.
43 Ebd., S.65.
44 Ebd., S.75.
45 Ebd., S.83.
46 Ebd., S.94.
47 Vgl. Dora Weigert, Die jüdische Bevölkerung in Hamburg, in: Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, Heft 5-7 (1919), S.66-112, hier: S.85.
48 Vgl. Büttner, Not, S.12f.
49 Ebd., S.7-71.
50 Vgl. Noakes, Nazi Policy, S.299.
51 Vgl. Büttner, Not, S.13f.
52 Die nationalsozialistischen Maßnahmen zur ökonomischen Existenzvernichtung der Juden in Hamburg sind Gegenstand einer Untersuchung von Frank Bajohr, „Arisierung“ in Hamburg. Die Verdrängung der jüdischen Unternehmer 1933–45, Hamburg 1997. Zu den Folgeverordnungen und Ausweitungen des „Arierparagraphen“ finden sich div. Unterlagen in der Akte StaHH, 131-10, Senatskanzlei I, Personalabteilung I, 1934 Ma 27.
53 Beispielsweise stieg die Zahl der Anträge im Hamburger Staatsarchiv von durchschnittlich 400 monatlich in der Zeit vor 1933 auf 1.782 im April 1934 an. Vgl. Das Staatsarchiv und die Personenforschung, herausgegeben vom Hamburgischen Staatsamt, (Reihe Arbeit der hamburgischen Verwaltung in Einzeldarstellungen Heft 3), Hamburg 1935, S.9f.
54 Gruchmann, Blutschutzgesetz, S.421.
55 RGBL I, 1938, S.414-415.
56 BAP, R 18, Reichsministerium des Innern, 343-345, Geheimer Schnellbrief des Ministerpräsidenten Generalfeldmarschall Göring, Beauftragter für den Vierjahresplan, an den RMdI u.a. v. 28.12.1938. Dieses „Angebot“ war nicht neu: Bereits 1937 hatte beispielsweise der Präsident der Reichskulturkammer die angeschlossenen Kammern darauf hingewiesen, daß „Personen, die bis in die letzte Zeit hinein mit Juden verheiratet gewesen sind und deren Ehe rechtskräftig geschieden ist, (…) den übrigen Kammermitgliedern gleichzustellen (sind), wenn einwandfrei der Beweis erbracht ist, daß diese Ehescheidung nicht nur formularer Natur war.“ Allerdings sollten gleichzeitig eingehende Auskünfte über die politische Zuverlässigkeit dieser Personen eingeholt werden. (BAP, R 56 I, Reichskulturkammer, V/51/4 (124), Präsident der Reichskulturkammer an die Herren Präsidenten der Einzelkammern v. 31.8.1937).
57 RGBl. I, 1941, S.547, Polizeiverordnung über die Kennzeichnung der Juden vom 1. September 1941 §3; Hilberg weist darauf hin, daß auch Juden, die mit einem „Mischling zweiten Grades“ verheiratet waren, zu den „privilegierten“ Ehen gezählt wurden (vgl. Hilberg, Vernichtung, Bd. 2, S.436-449, hier: S.445f.). „Privilegierte“ Mischehen konnten nur durch eigene, nicht durch adoptierte Kinder entstehen (StaHH, 522-1, Jüdische Gemeinden, Abl. 1993, Ordner 20, RVJD Berlin an dies. in Hamburg v. 7.5.40). Die „Privilegierung“ blieb nach „Führerentscheid“ auch bestehen, wenn der einzige Sohn im Krieg gefallen war (BAP, R 22, Reichsjustizministerium, 455, Reichsminister und Chef der Reichskanzlei, Lammers, an RMdI v. 4.3.1941).
58 StaHH, 314-15, Devisen- und Vermögensstelle, OFP 10, Allgemeiner Erlaß Nr. 23/40 des Reichswirtschaftsministers an die Herren Oberfinanzpräsidenten u. Devisenstellen vom 9.2.1940, S.1.
59 StaHH, 314-15, Oberfinanzdirektion, Devisen- und Vermögensverwertungsstelle, Bl. 66-73 und Bl. 74-80,Vermerk Devisenstelle / Oberfinanzpräsident v. 30.11.1939 betr.: Fragen bezogen auf Erlaß und Form von Sicherungsanordnungen, die in Berlin zu besprechen waren, Bl. 66; sowie Vermerk über die erfolgte Besprechung v. 7.12.1939.
60 Vgl. Noakes, Nazi Policy, S.331.
61 Vgl. Präsident der Reichsanstalt für Arbeitsverwaltung und Arbeitslosenversicherung an die Herren Präsidenten der Landesarbeitsämter u.a. v. 20.12.1938, abgedruckt in: Dieter Maier, Arbeitseinsatz und Deportation. Die Mitwirkung der Arbeitsverwaltung bei der nationalsozialistischen Judenverfolgung in den Jahren 1938–1945, Berlin 1994, S.30f. Vgl. auch Paul Sauer, Dokumente. Über die Verfolgung der jüdischen Bürger in Baden-Württemberg durch das nationalsozialistische Regime 1933–1945, Bd. 2, Stuttgart 1966, S.374.
62 Vgl. Büttner, Not, S.45
63 Senatskanzlei Hamburg, Senat der Hansestadt Hamburg, Aufbau und Rechtstellung, 343.00-3, Bd. 1, Hans Martin Corten, „Bericht über die Organisationen der Juden in Hamburg vor und nach dem Waffenstillstand“, undatierter Bericht (vermutlich Winter 1945), S.3: „Sämtliche in Deutschland verbliebenen Juden galten von da ab (Juni 1943, B.M.) als Mitglieder der RVJD“, Bl. 12ff.
64 Ebd., S.2f.
65 Vgl. AIGJ, 14.-001.1, Max Plaut, S.1f.
66 Vgl. dazu Konrad Kwiet, Nach dem Pogrom: Stufen der Ausgrenzung, in: Benz (Hrsg.), Juden, S.545-659.
67 Vgl. Büttner, Not, S.44.
68 Meiring ordnet die 103 von ihr untersuchten Ehen vier Idealtypen zu: Der jüdischen, der jüdisch-christlichen, der glaubenslosen und der christlichen Mischehe. Sie führt die jeweilige Ausprägung auf die Religionszugehörigkeit der Ehepartner, ihr Verhältnis zur Religion bzw. Ethnizität, die Rolle des Elternhauses, den sozialen Status bzw. den des Partners zurück. Vgl. Meiring, Mischehe, S.129-138.
69 StaHH, 241-2, Justizverwaltung, Personalakten B 3761, H.E. an Landesjustizverwaltung (LJV) v. 26.5.1933.
70 Ebd., LJV an H.E. v. 30.5.1933.
71 Allerdings zerbrach seine Ehe unter dieser Belastung, 1937 sprach das Landgericht Hamburg in seiner Abwesenheit die Scheidung aus. 1942 gelang ihm die Flucht vor den deutschen Truppen in die USA, wo er sich bis 1957 als Versicherungsmakler, Photograph und Spediteur durchschlug. Im Sommer 1957 kehrte er nach Hamburg zurück und beantragte die Wiederzulassung zum Landgericht und Oberlandesgericht. Doch dauerhaft mochte er nicht in Hamburg leben. In den 1960er Jahren verlegte er seinen ständigen Wohnsitz nach Paris und nahm einen französischen Namen an. (StaHH, 241-2, Justizbehörde, Personalakten B 3761, Lebenslauf H.E., Wiederzulassung am OLG v. 6.9.1957, Eintrag in die Liste der beim Landgericht zugelassenen Rechtsanwälte vom 20.9.1957 und Wohnsitz- wie Namenswechsel in H.E. an Justizbehörde v. 8.2.1972).
72 Ebd., H.G. an LJV v. 26.4.1933.
73 Ebd., Dr. Th. C. an Vorstand der Anwaltskammer v. 22.4.1933.
74 Ebd., LJV an H.G. v. 2.5.1933.
75 Ebd., Th. Burmeister an LJV v. 30.5.1933.
76 Ebd., Amtsgerichtspräsident an OLG-Präsident v. 22.8.1945.
77 StaHH, 113-5, Staatsverwaltung, B II 17, P.K. an Reichsstatthalter (über das Hamburgische Staatsamt) v. 26.5.1937.
78 Ebd., P.K. an Göring v. 18.6.1937; P.K. an Frick v. 30.8.1937; RFSS an Reichsstatthalter v. 14.3.1938; Staatsamt an RFSS vom 6.5.1938; RFSS an Reichsstatthalter v. 10.6.1938.
79 Zur Problematik der nicht eindeutig geregelten Möglichkeiten der Eigentumsübertragung innerhalb der Familie siehe auch Teil III, Kapitel III, S.209ff. dieser Arbeit; zur Berliner Praxis bei der Übereignung von Grundstücken vgl. Karl-Heinz Metzger / Monika Schmidt / Herbert Whe / Martina Wiemers, Kommunalverwaltung unterm Hakenkreuz. Berlin-Wilmersdorf 1933–1945, Berlin 1995, S.211-214.
80 Die aus der „Irisch-Presbyterianischen Missionsgesellschaft“ hervorgegangene Kirchengemeinde hatte Hamburg Mitte des 19. Jahrhunderts als günstigen Standort gewählt, um durchreisende jüdische Auswanderer zu missionieren und zu taufen. Folglich befanden sich unter den Gemeindemitgliedern wie auch unter den Angestellten eine Reihe von „Judenchristen“. Die Jerusalem-Gemeinde unterstützte getaufte Juden bis zur zwangsweisen Schließung 1938/39. Sie bot darüber hinaus einen schützenden Ort, an dem die Getauften ihre jüdische Herkunft nicht verleugnen mußten. Vgl. Röhm / Thierfelder, Juden-Christen-Deutsche, Bd. 1, S.303-310; auch: Beate Meyer, Exkurs: Jerusalem-Kirche, Jerusalem-Krankenhaus, Paulus-Bund, in: Sybille Baumbach / Susanne Lohmeyer / Astrid Louven / Beate Meyer / Sielke Salomon / Dagmar Wienrich, „Wo Wurzeln waren …“. Juden in Hamburg-Eimsbüttel 1933 bis 1945, Hamburg 1993, S.179-185.
81 FZH / WdE, 013, Interview mit Margarethe Moser, geführt von Beate Meyer am 4.2.1991, Transkript S.9f. Wegen gleicher Anfangsbuchstaben der Nachnamen wird die Interviewerin in den zitierten Interviewausschnitten mit I (=Interviewerin) benannt.
82 Ebd., S.19.
83 Ebd., S.10.
84 Ebd., S.8.
85 Ebd., S.13.
86 Ebd., S.12.
87 Ebd., S.17.
88 Siehe zu dieser Verhaftungsaktion der Gestapo in diesem Teil, Kapitel III, S.57ff.
89 Name geändert.
90 Privatbesitz, Gregor Eder (Name geändert), „Erinnerungen aus dem Leben von G.E.“, ungedrucktes Ms., verfaßt 1935.
91 Privatbesitz, Brief E. Eder an seinen emigrierten Sohn Robert vom 14.2.1939, S.5.
92 Ebd., Brief E. Eder, S.6f.
93 Ebd., S.10.
94 Dies erwies sich später, als „jüdischer Wohnraum“ zur Einquartierung von Mischehepaaren herangezogen wurde, als sehr vorausblickend: Eders Haus wurde von der Liste verfügbaren Wohnraums gestrichen. Vgl. StaHH, 522-1, Jüdische Gemeinden, Abl. 1993, Ordner 12.
95 Privatbesitz, Bericht Ernst Eder, „angefangen am 12. Dezember 1944“ über die Ereignisse der Jahre 1941–1945, geschrieben für seinen emigrierten Sohn, ungedrucktes Ms.
96 Ebd., S.10f.
97 Ebd., S.11.
98 Ebd., S.14.
99 Ebd., S.15.
100 StaHH, 522-1, Jüdische Gemeinden, Abl. 1993, Ordner 36, Liste der RVJD v. 11.9.1943. Vermutlich hatte seine Ehefrau die Rückstellung erreicht, ohne ihn zu informieren, denn der Vorsitzende der RVJD, Max Plaut, schickte ihr (!) am 15.10.1943 nicht näher bezeichnete Papiere zurück. Ebd., Ordner 12.
101 Privatbesitz, Bericht Ernst Eder, S.19.
102 Ebd., S.27.
103 Ebd., S.30.
104 Ebd., S.31.
105 Tatsächlich stand auch sein Name auf der Liste der zum „auswärtigen Arbeitseinsatz“ zu „Evakuierenden“, wurde dann aber gestrichen. Ernst Eder wurde als „freigestellt“ notiert. StaHH, 522-1, Jüdische Gemeinden, Abl. 1993, Ordner 12.
106 Diese Befürchtung äußerten auch die Repräsentanten der RVJD gegenüber den Mischehen, die Flüchtlinge aufnahmen.
107 Privatbesitz, Bericht Ernst Eder, S.32.
108 Dies kann allerdings auch daher rühren, daß der Bericht für seinen Sohn verfaßt war.
109 Ebd., S.44.
110 Ebd., S.45.
111 Ebd.
112 FZH / WdE, 109, Interview mit Martha Kadisch (Name geändert), geführt von Beate Meyer am 15.7.1991, Transkript, S.3.
113 Ebd., S.6.
114 Ebd., S.13.
115 Ebd., S.9, E. Kadisch (Name geändert) an Handelskammer Hamburg v. 11.3.1939, betr. Handelsregister-Nr. A 39 185, wörtlich verlesen von Beate Meyer.
116 Ebd., S.11.
117 Ebd., S.9. Gemeint sind mit den „Sachen im Fleet“ Kleidungsstücke, die während der Pogromnacht aus den Innenstadt-Modehäusern Hirschfeld und Robinsohn entwendet und in das Fleet geworfen wurden.
118 Ebd., S.14.
119 Ebd., S.13.
120 Ebd., S.13f.
121 Ebd., S.8.
122 Ebd., S.17.
123 Ebd., S.16.
124 Ebd., S.6-8.
125 Der Sohn starb 1987 an seinem „schwachen Herzen“.
126 Ebd., S.6.
127 Vgl. Ute Benz, Verführung und Verführbarkeit. NS-Ideologie und kindliche Disposition zur Radikalität, in: Ute und Wolfgang Benz (Hrsg.), Sozialisation und Traumatisierung. Kinder in der Zeit des Nationalsozialismus, Frankfurt 1992, S.25-39, hier: S.27.
128 Vgl. Hilberg, Vernichtung, S.436. Besprechungsprotokoll der Wannsee-Konferenz vom 20.1.1942, angefertigt von Adolf Eichmann nach Instruktionen Reinhard Heydrichs, abgedruckt in: Kurt Pätzold / Erika Schwarz, Tagesordnung: Judenmord. Die Wannsee-Konferenz am 30. Januar 1942, Berlin 1992, S.102-112, hier: S.108f. Siehe auch Teil II, Kapitel I, S.96ff. dieser Arbeit.
129 Vgl. Besprechungsprotokoll, in: Pätzold / Schwarz, Judenmord, S.110.
130 Vgl. ebd., S.111.
131 Vgl. Adam, Judenpolitik, S.324.
132 Vgl. Niederschrift „Besprechung über die Endlösung der Judenfrage“ am 6. März 1942 im Dezernat IV B 4 des RSHA, in: Pätzold / Schwarz, Judenmord, S.116-119, hier: S.118.
133 Vgl. Staatssekretär im RJM Franz Schlegelberger an Teilnehmer der Wannsee-Konferenz v. 5.4.1942, in: ebd., S.126f.
134 Ebd.
135 Vgl. Adam, Judenpolitik, S.325.
136 Vgl. Hilberg, Vernichtung, S.449.
137 BAP, R 22, Reichsjustizministerium, 460, Schnellbrief RMdI, Frick, an RMJ v. 20.3.1943; auch: Akten der Partei-Kanzlei der NSDAP, hrsg. v. Institut für Zeitgeschichte, Teil 1 und 2, 1983–1992 (Mikrofiches), Verfilmungs-Nr. 036740. Auch die Reichskanzlei ging von einer noch ausstehenden Regelung der Zwangsscheidungen aus, wenn sie vermerkte, daß die Frage des Erbrechts soweit es die „deutschblütige“ Ehefrau beträfe, dort geregelt werden müsse, denn im Falle einer Zwangsscheidung würde sie zunächst ihr gesetzliches Erbrecht verlieren. Es gab folgende Möglichkeiten der Regelung: Entweder verfiel das Vermögen wie bei anderen Juden dem Reich oder man könnte eine Vererbungsmöglichkeit an „Deutschblütige“ schaffen (z.B. die Ehefrau) oder aber das Erbrecht der Kinder aufrechterhalten. BAP, R 43 II, Reichskanzlei II, 1508a, Bl. 107-109, Vermerk vom 8.(?)4.1943, hier: Bl. 108.
138 BAP, R 18, Reichsministerium des Innern, 5519, Generalbevollmächtigter für die Reichsverwaltung, Frick, an Chef der Reichskanzlei v. 19.5.1943, S.3.
139 Vgl. Adam, Judenpolitik, S.329f.
140 Ebd., S.330.
141 Vgl. Hilberg, Vernichtung, S.449.
142 Die Forschungsliteratur zur Reichsvertretung und der späteren Reichsvereinigung der Juden in Deutschland ist ausgesprochen karg. Die bisher umfassendste Arbeit, aus dem Hebräischen übersetzt, spart zudem die letzte Phase der RVJD zwischen Sommer 1943 und Mai 1945 weitgehend aus: Esriel Hildesheimer, Jüdische Selbstverwaltung unter dem NS-Regime, Tübingen 1994; angekündigt ist eine Dokumenten-Edition, von der jüngst der erste Band erschienen ist, der die Geschichte der Reichsvertretung bis zum Übergang zur Reichsvereinigung umfaßt: Deutsches Judentum unter dem Nationalsozialismus. Band 1: Dokumente zur Geschichte der Reichsvertretung der deutschen Juden 1933–1939, herausgegeben von Otto Dov Kulka (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Institutes 54), Tübingen 1997; siehe auch Günter Plum, Deutsche Juden oder Juden in Deutschland?, in: Benz (Hrsg.), Juden, S.49-74. Zum Aufgabengebiet der Hamburger RVJD vgl. Ina Lorenz, Das Leben der Hamburger Juden im Zeichen der „Endlösung“ 1942–1945, in: Arno Herzig / Ina Lorenz (Hrsg.), Verdrängung und Vernichtung der Juden unter dem Nationalsozialismus, Hamburg 1992, S.207-247; Ina Lorenz arbeitet derzeit an einer umfassenden Dokumentation zur Situation der Hamburger Juden und ihrer Organisationen während der NS-Zeit; siehe auch Leo Lippmann, Mein Leben und meine amtliche Tätigkeit, herausgegeben von Werner Jochmann, Hamburg 1964, S.669-702.
143 Vgl. Hildesheimer, Jüdische Selbstverwaltung, S.233f.
144 Wolfgang Benz, Überleben im Untergrund, in: Benz (Hrsg.), Juden, S.660-700, S.691.
145 Der Jüdische Religionsverband wurde der RVJD am 1.8.1942 verwaltungsmäßig und am 21.11.1942 auch in rechtlicher Hinsicht eingegliedert. Damit existierte kein jüdischer Kultusverband mehr (vgl. Lippmann, Geschichte, S.88). Die RVJD wurde formal am 10.6.1943 aufgelöst, am 3.8.1943 stellte der Reichsfinanzminister jedoch klar, daß die Vereinigung weiterbestehe. In Hamburg wurden die Konten auf Max Heinemann übertragen und Hans Martin Corten zum Vertrauensmann der Rest-RVJD ernannt (vgl. Lorenz, Leben der Hamburger Juden, S.222f.)
146 Dr. Max Plaut, geb. 1901, war Vorsitzender des Jüdischen Religionsverbands von Groß-Hamburg von 1938 bis 1943 und der RVJD von 1939 bis 1943. Er konnte aufgrund einer Sonderregelung zusammen mit seiner Mutter 1944 nach Palästina emigrieren und kehrte nach dem Krieg nach Deutschland zurück. Eine Biographie Plauts steht bis heute aus, was um so bedauerlicher ist, als Plaut einerseits Kontinuität innerhalb der jüdischen Gemeinschaft verkörperte, in seinen Funktionen zentrale Entscheidungen für diese treffen mußte und gleichzeitig der Gestapo direkt unterstellt war und deren Befehle ausführen mußte.
147 RGBl. I, 1939, S.864.
148 Vgl. Kwiet, Nach dem Pogrom, S.631ff.; für Hamburg – mit Ausnahme der Häuser, die für die Mischehen reserviert waren – siehe Angela Schwarz, Von den Wohnstiften zu den „Judenhäusern“, in: Angelika Ebbinghaus / Karsten Linne (Hrsg.), Kein abgeschlossenes Kapitel: Hamburg im „Dritten Reich“, Hamburg 1997, S.232-247. Für die Stadt Hannover: Marlis Buchholz, Die hannoverschen Judenhäuser. Zur Situation der Juden in der Zeit der Ghettoisierung und Verfolgung 1941 bis 1945, Hildesheim 1987, über die Funktion des Gesetzes über die Mietverhältnisse siehe besonders die Seiten 8-16.
149 Es handelte sich um die ehemaligen Stifte Bornstr. 12, Dillstr. 15, Rutschbahn 25a, Heinrich-Barth-Str. 8 und Grindelallee 21/23.
150 Vgl. zur Wohnraumzerstörung Ursula Büttner, „Gomorrha“: Hamburg im Bombenkrieg, Hamburg 1993, S.25ff.
151 StaHH, 522-1, Jüdische Gemeinden, Abl. 1993, Ordner 26, Max Plaut, Ergebnis der Besprechung v. 4.10.1943.
152 Ebd.
153 Ebd., Gestapo an RVJD (Corten) v. 22.9.43, Vermerk Max Plaut v. 22.9.1943, Betr.: Wohnraumumsiedelung von Juden innerhalb Hamburgs.
154 Das Haus Dillstr.15 war mit 32 „Partien“ belegt, die 52 Personen umfaßten. Das Haus Bornstr. 22 beherbergte 45 „Partien“, zu denen 64 Personen gehörten. Eine undatierte Belegungsliste weist für Herbst 1943 in 125 Wohnungen von Mischehepaaren insgesamt 554 Bewohnerinnen und Bewohner aus (ebd). Eine Wohnraumbelegungsliste vom 24.11.1944, auf der 8 Wohnungen verzeichnet waren, enthält die Namen von 78 Personen (ebd., Ordner 36).
155 StaHH, 522-1, Jüdische Gemeinden, Ordner 12, RVJD, Plaut, an G.S.v. 18.11.1943.
156 Ebd., Bericht Heimann Goldstein v. 25.9.1943.
157 Ebd., RVJD, Vertrauensmann, Heinemann, an K. und K.v.H. v. 9.2.1944.
158 Die RVJD wies diejenigen, die gegen ihre Entscheidungen opponierten und andere Stellen anrufen wollten, darauf hin, daß sie dieses Recht nicht mehr besaßen. Vgl. ebd., RVJD, Corten, an O.v.H. v. 25.1.1944.
159 So ein im Briefwechsel der RVJD Berlin mit der Bezirksstelle Nordwestdeutschland, aufgeführter Fall. Ebd., Ordner 16, RVJD Berlin an dies. Nordwestdeutschland v. 9.9.1943 und RVJD Hamburg an dies. Berlin v. 21.9.1943.
160 Ebd., Ordner 12, RVJD, Corten, an F.R. vom 18.1.1944.
161 Ebd., Ordner 36 und 20, Bericht RVJD vom 11.8.1943 sowie Bekanntmachung 10/43.
162 Ebd., Ordner 36, Vermerk Max Plaut vom 25.10.1943.
163 Ein früher Nachkriegsbericht spricht von 200 Juden, die „verschwanden“. FZH, 6262, Bericht über die Jüdische Gemeinde in Hamburg.
164 Ebd., Ordner 36, div. Meldungen der RVJD v. 25.1.1944. So weist beispielsweise die Gestapokarteikarte von M.M. die Informationen auf: „1943 Haus zerstört, lt. Gestapo 14.2.1944 nicht zu ermitteln.“ Aber: 17.5.1945 „uns von Tochter A.L. gemeldet, daß Frau M. in S.bei Bienenbüttel lebt. Wohnt seit 9.11.1943 unter dem Namen Frau B.W.“. Ebd., Ordner 41.
165 Ebd., Ordner 16, Briefwechsel zwischen RVJD Berlin und Hamburg, RVJD Berlin bedankt sich am 22.7.1944 in Hamburg bei Corten für die Zusendung von 900 ausgefüllten Fragebögen, die nicht nur Informationen über den Status und Stand der Mischehen enthalten, sondern auch über die Zahl der Kinder und ob diese „Geltungsjuden“ oder „Mischlinge“ sind.
166 StaHH, 522-1, Jüdische Gemeinden, Abl. 1993, Ordner 26, Vermerk RVJD Betr.: Freimachung jüdischen Wohnraums, v. 22.3.1944.
167 Ebd., Ordner 12, M.M. an RVJD, Plaut, vom 30.9.1943.
168 Senatskanzlei Hamburg, Senat der Hansestadt Hamburg, Aufbau und Rechtstellung, 343.00-3, Bd. 1, Bl. 12ff., Bericht Corten, S.5. Vgl. dazu auch Lorenz, Leben, S.216.
169 StaHH, 522-1, Jüdische Gemeinden, Abl. 1993, Ordner 12, RVJD (Heinemann) an div. vom 28.2.1945. Siehe auch Ordner 23, diverse Einsprüche und Schreiben RVJD (Heinemann) an K.L. v. 23.2.1945.
170 Ebd., Ordner 13, Vermerk Max Heinemann vom 24.5.1945, Betr.: Jüdischen Wohnraum in Hamburg.
171 Gestapomann und Kriminalsekretär Hans Stephan, geb. 1.5.1902, erlernte von 1918 bis 1921 den Beruf des Bankbeamten, in dem er bis 1924 arbeitete. Er bewarb sich – nach einem Jahr Erwerbslosigkeit – bei einer Im- und Exportfirma, 1926 dann als Büroangestellter bei der Gewerbepolizei. Von dort wurde er am 23.5.1933 zur Staatspolizei versetzt, wo er am 9.11.1936 Beamter wurde. Er stieg vom Kriminalassistenten 1942 zum Kriminalsekretär auf und war als solcher bis zur Auflösung der Staatspolizei tätig. Am 1.5.1933 trat er in die NSDAP ein (Mitglieds-Nr. 3002669) und war Mitglied der SS. Angeblich leitete die NSDAP 1939 ein Ausschlußverfahren wegen „Interesselosigkeit“ gegen ihn ein, das jedoch nicht weiter verfolgt wurde. In der SS erhielt er nach der Übernahme den Rang eines Hauptscharführers und nach seiner Beförderung den eines Sturm-Scharführers. Außerdem gehörte er der NSV an und war als Luftschutzwart tätig. Vom 13.5.1945 bis zum 17.6.1948 war er interniert. (BA, Bestand BDC, NSDAP-Mitgliedskarte und SS / RuS-Akte Stephan sowie eigene Angaben des Hans Stephan, ASLGH, Prozeß gegen Willibald Schallert, Verfahrens-Nr. (50) 35/50, 14 Ks 56/50, Vernehmung des Kriminalamtes vom 4.8.1948).
172 Alle nicht anders belegten Angaben aus: StaHH, 522-1, Jüdische Gemeinden, Abl. 1993, Ordner 13, Vermerk Max Heinemann vom 24.5.1945, Betr.: Jüdischen Wohnraum in Hamburg.
173 Vgl. zum Zwangsarbeitseinsatz Teil III, Kapitel III, S.237ff. dieser Arbeit.
174 Vgl. Franz W. Seidler, Die Organisation Todt, Koblenz 1987, S.131 ff.
175 Von den insgesamt 1.088 „Dienstverpflichteten“ waren 820 „Mischlinge ersten Grades“, 197 „jüdisch Versippte“, 59 Vorbestrafte und 12 „Zigeuner“ (StaHH, 131-5, Senatskanzlei – Verwaltungsbeschwerden, 237, Hansestadt Hamburg, Finanzbehörde, Haftentschädi- gungsstelle – 19 – an Senat der Hansestadt Hamburg, Senatskommission für Verwaltungsbeschwerden v. 8.11.1950).
176 Besitz VVN / BdA Hamburg, Antrag W. Sch. auf Ausstellung eines Ausweises für politisch, rassisch und religiös durch den Nazismus Verfolgte beim Komitee ehemaliger politischer Gefangener v. 8.4.1946. Ich danke dem VVN / BdA für Kopien dieser Unterlagen.
177 Ebd., Antrag A.W. auf Ausstellung eines Ausweises v. 15.4.1946.
178 Ebd., Antrag Dr. E.S.auf Ausstellung eines Ausweises v. 23.4.1946.
179 Ebd., Antrag M.B. auf Ausstellung eines Ausweises v. 23.4.1946.
180 Grundlage war der Erlaß vom 19.1.1945 – IV A 4 b – 3066/44; ausgenommen von dem Befehl waren Nichtarbeitsfähige, Eltern gefallener Söhne, solche Personen bei denen Unruhe entstehen würde und Juden (gemeint: Jüdinnen), deren Ehepartner im öffentlichen Dienst sind (vgl. Dokument 13, Schreiben des Leiters der Geheimen Staatspolizei, Staatspolizeistelle Kiel an Landräte des Bezirks, abgedruckt in: Gerhard Paul, Staatlicher Terror und gesellschaftliche Verrohung, Hamburg 1996, S.328).
181 StaHH, 522-1, Jüdische Gemeinden, Abl. 1993, Ordner 19, Bekanntmachung v. 15.2.1945.
182 Ebd., Liste RVJD, Heinemann, o.Datum.
183 Vgl. Hamburger jüdische Opfer, S.XIX; vgl. zu dieser Deportation auch Lorenz, Leben, S.238.
184 Wolf Gruner, Der geschlossene Arbeitseinsatz deutscher Juden. Zur Zwangsarbeit als Element der Verfolgung 1938–1943, Berlin 1997, S.317f.
185 Zitiert nach ebd., S.316.
186 Vgl. auch Gernot Jochheim, Frauenprotest in der Rosenstraße, Berlin 1993.
187 Kwiet, Pogrom, S.594.
188 Vgl. Nathan Stoltzfus, Resistance of the Heart, New York / London 1996, S.261.
189 Vgl. Gruner, Arbeitseinsatz, S.319f.
190 Vgl. Christof Dipper, Schwierigkeiten mit der Resistenz, in: Geschichte und Gesellschaft 22 (1996), S.409-416.
191 Vgl. ebd., S.410ff.
192 Tagebucheintrag v. 11.3.1943, Die Tagebücher von Josef Goebbels, herausgegeben von Elke Fröhlich, München / New Providence / London / Paris 1993, Teil II, Bd. 7, S.528.
193 Archiv der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Hamburg (ASLGH), Urteil des Landgerichts Hamburg (50) 35/50 14 Ks 56/50, S.8-11.
194 Vgl. dazu Hildesheimer, Jüdische Selbstverwaltung, S.232f. und Lorenz, Leben, S.222f.
195 Schallert argumentierte im Prozeß, er habe eine Liste der ehrenamtlichen Mitarbeiter des Jüdischen Religionsverbandes, auf der 12 oder 13 Namen gestanden hätten, lediglich weitergeleitet, ohne den Zweck der Meldung erkannt zu haben. ASLGH, Urteil, S.4.
196 Dies bestätigte der Meister (Ebd., Kriminalamt, Spez.Abt., Vernehmungsprotokoll H.B. vom 28.10.1949).
197 Ebd., Verfahren gegen Willibald Schallert, Vernehmung Rudolf Hamburger v. 21.10.1948.
198 Vgl. Dipper, Schwierigkeiten, S.411.
199 Vgl. Urteil gegen Georg Albert Dengler, 2a Ks 1/49, abgedruckt in: Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945–1966, Bd. XXII, von Irene Sage-Grande, Adelheid L. Rüter-Ehlermann, H.H. Fuchs, C.F. Rüter, Amsterdam 1981, S.658-682, hier: S.660.
200 FZH, 35363, Fuhlsbüttel, Häftlingslisten, Zu- u. Abgangslisten KL Fuhlsbüttel v. 31.12.1943 bis 8.5.1943 (danach existieren keine Listen mehr).
201 So findet sich in den Akten beispielsweise eine Karte der Ehefrau an ihren Mann in Auschwitz-Birkenau, die an den Jüdischen Religionsverband mit der Bemerkung zurückging, daß Nachrichten über Fliegerangriffe nicht ins Lager übermittelt werden dürften. StaHH, 522-1, Jüdische Gemeinden, Abl. 1993, Ordner 12, M. Plaut an B. Hirschfeld vom 6.9.43.
202 FZH / WdE, 008, Interview mit Hans Hirschfeld, geführt von Beate Meyer am 9.8.1990, vgl. Transkript, S.29. Bei der Transkription wurden leichte sprachliche Glättungen vorgenommen.
203 Ebd., S.28f.
204 Ebd., S.30f.
205 FZH / WdE, 052, Interview mit Dennis Berend, geführt von Beate Meyer am 25.5.1993, Transkript S.21. Bei der Transkription wurden leichte sprachliche Glättungen vorgenommen.
206 Nach den entsprechenden Erlassen hätte er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Soldat sein dürfen. Vgl. Teil III, Kapitel III dieser Arbeit.
207 FZH / WdE, 052, Transkript Berend, S.22.
208 Siehe dazu auch die Auswertung des lebensgeschichtlichen Interviews mit Dennis Berend im Teil IV, Kapitel II dieser Arbeit.
209 Transkript Moser, S.24.
210 StaHH, 522-1, Jüdische Gemeinden, Abl. 1993, Ordner 12, Plaut an M. Moser v. 23.12.1943.
211 Diese Angaben dieses Porträts beruhen – wenn nicht anders angegeben – auf der umfangreichen Ermittlungsakte und der Anklageschrift des Oberstaatsanwalts im Archiv der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Hamburg (ASLGH, Verfahren gegen Willibald Schallert, Anklageschrift 14 Js 278/48 und Urteil, (50) 35/50, 14 Ks 56/50).
212 Ebd., Urteil, S.2, und ebd., Anklageschrift des Oberstaatsanwalts beim Landgericht Hamburg.
213 Ebd., Anlage v. 16.1.1948.
214 Ebd., Vernehmungsprotokoll (Spec. Dep.) von Willibald Schallert v. 16.12.1947.
215 BA, Bestand BDC, SA-Akte Willibald Schallert.
216 ASLGH, Verfahren gegen Willibald Schallert, 14 Js 278/48, Kriminalpolizei Hamburg, Abt. Öffentliche Sicherheit, Vernehmungsprotokoll Willibald Schallert vom 22.6.1945 (gemeint: 1947).
217 Ebd., Kriminalamt, Spez. Abt., Vernehmungsprotokoll von Schallerts Mitarbeiter F.S. vom 11.9.1948.
218 Ebd., Anklageschrift des Oberstaatsanwalts beim Landgericht Hamburg, 14 Js 278/48 v. 18.3.1950, S.2.
219 Ebd., Urteil des Landgerichts Hamburg (50) 35/50 14 Ks 56/50, S.3.
220 BA, Bestand BDC, SA-Akte Willibald Schallert.
221 ASLGH, Verfahren gegen Willibald Schallert, 14 Js 278/48, Kriminalpolizei Hamburg, Abt. Öffentliche Sicherheit, Vernehmungsprotokoll Willibald Schallert v. 22.6.1945.
222 Lt. Bekanntmachung 2/1943 forderte die RVJD alle nicht oder nicht im vollen Arbeitseinsatz stehenden Jüdinnen und Juden auf, sich zu melden. StaHH, 522-1, Jüdische Gemeinden, Abl. 1993, Ordner 20.
223 ASLGH, Verfahren gegen Willibald Schallert, 14 Js 278/48, Spec. Dep. I/1, Vernehmungsprotokoll G.Sch. v. 29.1.48.
224 StaHH, 522-1, Jüdische Gemeinden, Abl. 1993, Ordner 26, RVJD an Arbeitsamt v. 14.2.1944.
225 Ebd., Ordner 19, vgl. Schriftwechsel dazu zwischen Arbeitsamt, RVJD und div. Firmen.
226 ASLGH, Verfahren gegen Willibald Schallert, 14 Js 278/48, Kriminalamt Spez. Abt. Vernehmungsprotokoll von Schallerts Mitarbeiter F.S.v. 11.9.1948.
227 StaHH, 522-1, Jüdische Gemeinden, Abl. 1993, Ordner 19, Bekanntmachung v. 15.2.1945.
228 ASLGH, Urteil des Landgerichts Hamburg (50) 35/50 14 Ks 56/50, S.4.
229 Ebd., A. B.-W. an Polizei Hamburg, Fahndungskdo. P.S.v. 10.10.1943 und Vernehmungsprotokoll ders. v. 12.10.1949. Der Befragte war als in „privilegierter“ Mischehe Lebender zur Ablieferung nicht verpflichtet, vgl. Bekanntmachung Nr. 40 v. 17.6.1942 der RVJD, StaHH, 522-1, Jüdische Gemeinden, Abl. 1993, Ordner 20.
230 Dies bestritt er im Prinzip auch den Ermittlungsbehörden gegenüber nicht, er wollte die Zuwendungen allerdings als kleine Gaben gewertet wissen, die man ihm aufgedrängt hatte, oder die er zu Recht bekommen hatte. Vgl. ASLGH, Kriminalabt., Vernehmungsprotokoll W. Schallert o.D., S.1-6.
231 FZH, 6262, Gesprächsnotizen Unterredung Dr. Schottelius (damaliger Mitarbeiter der FZH) mit Max Plaut v. 11.7.1953, S.2.
232 Ebd., Spec. Dep., Vernehmungsprotokoll K.R. v. 29.1.1948.
233 Diese Argumentation kehrt in etlichen Vernehmungen wieder, beispielsweise ebd., Kriminalamt Spez. Abt. Vernehmungsprotokoll A.M. v. 3.9.1948; auch Max Plaut wies in einem Nachkriegs-Interview darauf hin, daß Schallert diese Machtposition nicht nur innehatte, sondern dies auch gern gegenüber den Abhängigen kundtat. Vgl. AIGJ, Plaut, 14.002, Interview Max Plaut, 3. Kass., Transkript S.2.
234 ASLGH, Verfahren gegen Willibald Schallert, 14 Js 278/48, Kriminalabt. II / D, Vernehmungsprotokoll mit der Denunziantin H.M. vom 19.7.1949. Diese Frau wurde übrigens ebenso wenig belangt wie der Handwerksmeister, der Rudolf Hamburger denunziert hatte.
235 Ebd., Kriminalamt Spez. Abt. Vernehmungsprotokoll G.S.v. 17.7.1948.
236 StaHH, 522-1, Jüdische Gemeinden, Abl. 1993, Ordner 12, A. I. an die RVJD, Corten, vom 19.8.1944.
237 So wußte beispielsweise ein zur regelmäßigen Meldung Verpflichteter nicht mehr, ob er freiwillig oder auf Anordnung bei Schallert erschienen war. ASLGH, Verfahren gegen Willibald Schallert, 14 Js 278/48, Kriminalamt, Spez. Abt. Vernehmungsprotokoll H.E. v. 15.7.1948.
238 Ebd., Urteil des Landgerichts Hamburg (50) 35/50 14 Ks 56/50, S.2.
239 Dies geht aus div. Vernehmungsprotokollen hervor, wurde aber vor Gericht nicht als Bestechung verhandelt, sondern zumeist mangels Beweises eingestellt, ebd., Verfügung des Oberstaatsanwaltes beim Landgericht vom 9. März 1950.
240 Ebd., Urteil des Landgerichts Hamburg (50) 35/50 14 Ks 56/50, S.2.
241 Ebd., Verfügung Oberstaatsanwalt v. 11.2.1948.
242 Der Leiter des „Judenreferats“ Claus Göttsche, hatte am 12.5.1945 Selbstmord begangen; Walter Mecklenburg suizidierte sich am 8.3.1947 in Dänemark, Walter Wohlers war zu diesem Zeitpunkt vermißt.
243 ASLGH, Verfahren gegen Willibald Schallert, 14 Js 278/48, Vermerk Spez. Abt. vom 26.10. 1948.
244 Ebd., Urteil des Landgerichts Hamburg (50) 35/50 14 Ks 56/50, S.3-11.
245 Ebd., Verfahren gegen Willibald Schallert, 14 Js 278/48, Kriminalamt, Spez. Abt., Vernehmungsprotokoll Willibald Schallert vom 29.7. 1948.
246 Ebd., Urteil des Landgerichts Hamburg (50) 35/50 14 Ks 56/50, S.11-16.
247 Lt. Auskunft aus dem Melderegister der Stadt Schenefeld an die Verfasserin v. 28.8.1996.
248 Vgl. Hans Wrobel, Die Anfechtung der Rassenmischehe, in: Kritische Justiz 16 (1983), S.349-374, hier: S.354ff. Einen groben Überblick gibt auch Ingo Müller, Furchtbare Juristen, München 1987, S.97-105. Die bereits zitierte rechtshistorische Arbeit von Marius Hetzel, Anfechtung, geht der Anfechtungspraxis erstmals auf breiterer empirischer Basis nach.
249 Vgl. Wrobel, Anfechtung, S.364.
250 Ebd., S.365. Das Reichsgericht als oberste Berufungsinstanz verhielt sich entsprechend vorsichtig: Es erkannte den Bedeutungsirrtum grundsätzlich an, forderte aber Nachweise dafür, die kaum zu erbringen waren. Auch in der Frage der Fristen sah es 1935 mit Inkrafttreten der Nürnberger Gesetze den Zeitraum für beendet an, in dem jemand seine Mischehe anfechten konnte. Im übrigen hatte es Freislers Wink verstanden und verzichtete darauf, über die Grenzen hinauszugehen, die die Gesetzgebung des Staates zogen (vgl. Auflösung bestehender Mischehen, in: Blutschutz- und Ehegesundheitsgesetz, dargestellt, medizinisch und juristisch erläutert von Arthur Gütt, Herbert Linden und Franz Maßfeller, München 1936, S.208-210, hier: S.210, und Wrobel, Anfechtung, S.367f.).
251 Hetzel, Anfechtung, S.201.
252 RGBl I 1938, S.807.
253 Zu diesem Zeitpunkt war Frank „Reichskommissar für die Gleichschaltung der Justiz in den Ländern und die Erneuerung der Rechtsordnung“.
254 Zitiert nach: Dirk Blasius, Ehescheidung in Deutschland 1794–1945, Göttingen 1987, S.195.
255 Blasius, Ehescheidung, S.196; vgl. auch Bernd Rüthers, Die unbegrenzte Auslegung, Heidelberg 1988, S.407.
256 Vgl. Blasius, Ehescheidung, S.198.
257 Zu den Auseinandersetzungen ebd., S.200f.
258 Vgl. ebd., S.206
259 Gemeint waren damit Geisteskrankheiten, leichtere geistige Störungen wie „Hysterie“ sowie ansteckende und „ekelerregende“ Krankheiten.
260 Neu waren auch mögliche Unterhaltsregelungen bei Scheidung aus beiderseitigem Verschulden oder wegen Zerrüttung und die Entkoppelung des Sorgerechts für Kinder vom Schuldprinzip (vgl. Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, 8 (1938), Das neue Eherecht, S.251-255, hier: S.258).
261 Vgl. Rüthers, Auslegung, S.402.
262 Zitiert nach ebd., S.417.
263 Ebd., S.406f.
264 Ebd., S.410.
265 Vgl. Blasius, Ehescheidung, S.211.
266 BAP, R 22, Reichsjustizministerium, 460 (347), RJM an RMdI v. 31.8.1944.
267 Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD), Generalkommissar für Verwaltung und Justiz 25/43 150 g, Auswärtiges Amt an die Missionen, Berufskonsulate, Dienststellen und Vertreter des Auswärtigen Amtes in Europa v. 18.12.1942.
268 BAP, R 22 Reichsjustizministerium, 460 (329, 330), Oberlandesgerichtspräsident Kattowitz an die Herren Landgerichtspräsidenten vom 15.2.1943.
269 Ebd.
270 Ebd., (332), RJM an den Kommandierenden General u. Befehlshaber in Serbien, Militärverwaltung v. 20.8.1943.
271 Akten der Partei-Kanzlei, Verfilmungs-Nr. 030274-80, RJM an StdF, RMdI, Reichsführer SS v. 7.2.1941.
272 Akten der Partei-Kanzlei, Verfilmungs-Nr. 030363-73, 030329-35, RJM an StdF, RMdI und Reichsführer SS v. 5.3.1941 und NSDAP, StdF an RJM v. 30.3.1941, in beiden: Entwurf „Verordnung über deutsch-polnische Mischehen“.
273 Vgl. beispielsweise Werner Johe, Die gleichgeschaltete Justiz, Frankfurt 1967.
274 Vgl. Hetzel, Anfechtung, S.202f.
275 Vgl. Reginald A. Puerschel, Trügerische Normalität. Zur Rechtsprechung der Landgerichte Hamburg und Altona in Ehe- und Familiensachen 1933–1939, in: Justizbehörde Hamburg (Hrsg.), „Für Führer, Volk und Vaterland“. Hamburger Justiz im Nationalsozialismus, Hamburg 1992, S.382-431.
276 Puerschel nennt die Aktenzeichen von 32 Scheidungsfällen.
277 Vgl. Puerschel, Normalität, S.414ff.
278 Puerschel, Normalität, S.383; vgl. auch S.390.
279 Zur Zeit meiner Archivrecherchen waren nach Aussagen der zuständigen Mitarbeiter die Urteile der Zeit 1933–1936 vollständig kassiert, von 1937 existierte ein kleiner Restbestand. Die Urteile von 1938 bis 1945 hingegen waren so weit komplett vorhanden, wie sie nicht während des Krieges verlorengegangen oder verbrannt waren. Von den noch erhaltenen Urteilen der Jahre 1937 bis 1945 habe ich jedes 15. Urteil eingesehen sowie alle, die im Register mit den Zwangsnamen „Israel“ und „Sara“ versehen waren und solche, bei denen eine Partei mit ausländischem Wohnsitz eingetragen war. Von ca. 6.000 eingesehenen Entscheidungen waren 119 Mischehescheidungen (plus 15 Scheidungen der Ehen, bei denen ein Partner „Mischling“ war). Zu diesen 119 Urteilen aus dem Archiv des Landgerichts Hamburg (ALGH) kommen 11 Entscheidungen hinzu, die ebenfalls aus diesem Zeitraum stammen, und dem Quellenbestand Eheanerkennungsgesetz der Justizbehörde (AJH) entnommen sind, so daß die folgende Analyse auf der Quellengrundlage von 130 Urteilen fußt. Dies sind nicht alle Urteile aus diesem Zeitraum, die Mischehen betreffen, aber doch ein großer Teil. Manche Akten sind aufgrund von Ausbombungen der Gerichtsgebäude oder aus anderen kriegsbedingten Gründen verlorengegangen. Vor der Einführung der Zwangsvornamen „Israel“ und „Sara“ war aus Registereintragungen und Urteilen nicht immer ersichtlich, daß es sich um die Scheidung einer Mischehe handelte. In den Aktenbeständen des Amtes für Wiedergutmachung und der Notgemeinschaft der durch die Nürnberger Gesetze Betroffenen, archiviert in der Forschungsstelle für Zeitgeschichte, fand ich Hinweise auf weitere Scheidungsfälle in diesen Jahren, die aber nicht in diese Analyse einbezogen wurden.
280 Ob der statistische Einbruch im Jahr 1940 auf den Kriegsbeginn im September 1939 zurückzuführen ist oder lediglich darauf, daß ich in den Registern dieses Jahres – immerhin vor der Verpflichtung, Zusatznamen zu führen, in diesem Jahr weniger Urteile gefunden habe, muß hier offen bleiben.
281 Vgl. Büttner, Not, S.298.
282 Ein Vergleich der Hamburger Scheidungsziffern mit denen des Deutschen Reiches zeigte für die Jahre 1933–1938, daß diese in Hamburg generell fast drei Mal so hoch wie im übrigen Reichsgebiet lagen. 1938 kamen auf 10.000 Hamburger Ehen 2.822 Scheidungen, mithin eine Quote von 18,7, während diese im Deutschen Reich lediglich bei 7,2 lag (vgl. Puerschel, Normalität, hier: S.391). Die Erklärung dafür liegt in den allgemeinen großstädtischen Lebensverhältnissen und der zunehmenden Entkonfessionalisierung.
283 Während insgesamt im Deutschen Reich jährlich auf 10.000 bestehende Ehen rd. 28 Scheidungen kamen, so waren es in Hamburg 130 plus X (die Zahl der zwischen 1933 und 1938 ausgesprochenen sowie der unbekannten der Jahre 1938 bis 1945) Scheidungen auf ca. 1.000 bestehende Mischehen, allerdings verteilt auf zwölf Jahre.
284 Festgestellt durch Abgleich mit den Gedenkbüchern. In einigen Fällen waren „Verschollene“ amtlich für tot erklärt worden. Dies geht aus den Unterlagen zum Eheanerkennungsgesetz im Archiv der Justizverwaltung Hamburg hervor. Die genannte Zahl der Ermordeten ist eine Mindestzahl, von einigen weiteren Geschiedenen ist zu vermuten, daß sie deportiert worden sind, wahrscheinlich nach Auschwitz. Sie sind aber nicht in den Gedenkbüchern erfaßt. Vgl. Hamburger Jüdische Opfer des Nationalsozialismus und Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933–1945, bearbeitet vom Bundesarchiv, Koblenz, und dem Internationalen Suchdienst, Arolsen, Koblenz 1986.
285 Bei Scheidungsurteilen als Quelle ist – wie bei allen Gerichtsakten – besondere Vorsicht geboten. Zum einen wurden die Begründungen für eine Scheidungsklage vom scheidungswilligen Ehegatten immer in Absprache mit dem Anwalt getroffen, der wiederum wußte, welcher Argumentation die Richter derzeit folgten. Die angeführten Scheidungsgründe müssen also nicht den tatsächlichen entsprechen. Hatte der Anwalt bereits gefiltert, so tat dies der Richter in seinem Urteil ein zweites Mal, indem er diese Gründe nochmals zusammenfaßte. Das bedeutet, daß Scheidungsurteile nur einen sehr minimalen Einblick in die Zerrüttung einer Ehe geben können. Dennoch scheinen durch alle juristischen Filter oft echte Konflikte, Versuche gütlicher Regelungen oder politischer Opportunismus hindurch. Leider sind die Protokolle der Vorladungen und Zeugenvernehmungen, die weitere Aufschlüsse geben könnten, in der Regel kassiert worden. Da ich für diese Untersuchung insgesamt hunderte von Einzelfällen aus den regionalen Aktenbeständen des Landgerichts Hamburg (ALGH), der Justizbehörde Hamburg (AJH), des Amtes für Wiedergutmachung (A.f.W.) und der Forschungsstelle für Zeitgeschichte, hier der Bestand Notgemeinschaft (NG) der durch die Nürnberger Gesetze Betroffenen (FZH 18-12.1. und 2.2.) herangezogen habe, werde ich in den Fußnoten, um eine unnötige Aufblähung des Anmerkungsapparates zu vermeiden, lediglich das Archiv und die Aktensignatur angeben. In der Regel ergibt sich der Sachverhalt aus dem ersten Schriftstück der Akte. Bei ALGH existierte aus dieser ohnehin meist nur noch ist das Scheidungsurteil, Signaturen bzw. Seitenzahlen beziehen sich immer auf das Urteil. Bei AJH geht es um den Antrag nach dem Eheanerkennungsgesetz, bei A.f.W. um die Rubrik „Schilderung der Verfolgung“ im Wiedergutmachungsantrag und FHZ, 18-1, um die briefliche Schilderung der Verfolgung. Wird aus Schriftstücken zitiert, so werden selbst-verständlich die einzelnen Dokumente mit Blattnummer (soweit vorhanden), Verfasser, Adressat und Datum angegeben.
286 ALGH, 4 R 345/37.
287 Ebd., 6 R 185/37, S.2.
288 Ebd., 4 R 260/37.
289 Ebd., 11b R 313/39, Protokoll nichtöffentlicher Sitzung v. 28.11.1939, S.1.
290 Ebd., 4 R 7/39, S.3, ähnlich gelagert: ebd., 2 R 56/41.
291 Ebd., 5 R 238/39.<
292 Vgl. Hans Robinsohn, Justiz als politische Verfolgung. Die Rechtsprechung in „Rasseschandefällen“ beim Landgericht Hamburg 1936–1943, Stuttgart 1977. Robinsohn kommt zum Ergebnis, daß die Stadt Hamburg (verglichen mit Frankfurt und Köln) den höchsten Verfolgungskoeffizienten aufwies und schloß daraus, daß die „Verfolgungspraxis in Hamburg die weitaus schärfste war“ (S.21). Aus einer Tabelle (S.18) wird deutlich, daß der Großteil der Ermittlungen in den Jahren 1937–1939 durchgeführt wurde, 1940 auf die Hälfte absank und 1941 nur noch die Hälfte des Vorjahres betrug.
293 ALGH, 11a R 401/39, S.2.
294 Ebd., 6 U 420/37, S.5 und 7.
295 So ALGH, 11a R 61/40, 5a R 131/41, 11 R 5/39.
296 Ebd., 11b R 286/41, S.3f.
297 Ebd., S.4.
298 Es gibt keine Hinweise darauf, daß ein Schuldspruch des „deutschblütigen“ Ehepartners den jüdischen vor der Deportation schützte.
299 In anderen Fällen war beispielsweise der Aufenthaltsort eines 1944 Geschiedenen seit seiner Verhaftung 1940 unbekannt (ALGH, 16a R 20/44). Ein Ehemann trennte sich nach 24jähriger Ehe von seiner jüdischen Frau, die in einem „Judenhaus“ lebte (Ebd., 7 R 40/39). Manchmal führte die Emigration des jüdischen Ehepartners die notwendige dreijährige Trennung herbei, die Voraussetzung für die Heranziehung des §55 war (Ebd., 16b R 46/42, 15a R 81/44).
300 Ebd., 6 R 215/38.
301 Ein aus „rassischer Abneigung“ verweigerter Geschlechtsverkehr des „deutschblütigen“ Ehemannes (vgl. etwa ebd., 5 R 364/38) galt ebenso als Verstoß gegen seine Pflichten wie unbeherrschtes Verhalten des jüdischen Ehemannes, der durch „die Schmälerung seiner Erwerbsaussichten infolge der Rassengesetzgebung verstimmt sei.“ (ebd., 6 R 194/38). Das Gericht ging in diesem Fall sogar noch weiter und mahnte den jüdischen Ehemann, die Mischehe erlege seiner Frau schon genug Opfer auf. Schlechte Behandlung durch ihn hätte sie nicht noch obendrein verdient.
302 Ebd., 15a R 102/41, S.3f., ähnlich auch 12b R 217/40 oder 8a R 173/39, S.3 oder 3b R 245/41.
303 Vgl. zur Juni-Aktion der Kriminalpolizei: Wolfgang Ayaß, „Ein Gebot der nationalen Arbeitsdisziplin“. Die Aktion „Arbeitsscheu Reich“ 1938, in: Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik 6, Feinderklärung und Prävention, Berlin 1988, S.43-74. In Hamburg wurden insgesamt 700 Männer festgenommen, davon waren nach den Einlieferungslisten des KZs Sachsenhausen weniger als 10% Juden. Vgl. Ayaß, Gebot, S.59.
304 So ALGH, 7 R 40/39, 5b R 41/40, 7 R 40/39, 3 R 94/39, 5b R 41/40.
305 Ebd., 4 R 28/42.
306 Ebd., 8 R 462/42. In einem anderen Fall ging das Gericht noch weiter und vermutete, das „Fehlverhalten“ des Mannes werde vermutlich vom Polizeigefängnis in ein Konzentrationslager führen. Ebd., 2 R 382/42, S.2.
307 Ein einziger „Ausreißer“ findet sich 1941: Ebd., 3b R 245/41.
308 Ebd., 4b R 223/39.
309 Ebd., 11 R 447/38.
310 Ebd., 10 R 147/39.
311 Ebd., 2a R 229/39.
312 Wie bei ebd., 9b R 234/39 und 6b R 5/40.
313 Nur in einem dieser Fälle war vom ausdrücklichen Wunsch des Ehemannes nach Rückkehr der Frau, der sie nicht Folge leistete, die Rede. Vgl. ebd., 3a R 12/40.
314 Ebd., 15a R 221/41, S.3.
315 Beispielsweise ebd., 15a R 1/42.
316 Ebd., 16a R 104/40; 15a R 1/42; 6 R 132/38; 15a R 43/42, 15a R 99/42, 15a R 131/40.
317 Ebd., 5 a R 35/42.
318 Ebd., 15a R 224/41, S.3.
319 Ebd., 12 R 354/38.
320 Das im nächsten Schritt angerufene Oberlandesgericht schied die Ehe zu Lasten des jüdischen Mannes. Dessen passives Verhalten habe als Vernachlässigung der Klägerin die Ehe zerrüttet, was durch Emigrationsabsichten noch verstärkt würde (ebd., 4 U 443/38); ähnlich gelagert: ebd., 10b R 159/39 (abgewiesene Aufhebungsklage) und ebd., 6 U 136/1940 (Urteil des OLG: Scheidung wegen Zerrüttung).
321 Ebd., 6 R 243/38, S.2 und 5f.
322 Ebd., 12 R 177/38, S.5.
323 Ebd., 5 U 82/1942, 3 b R 234/1941, S.5f.
324 Ebd., 11b R 267/42, S.4. In diesem Fall konnte die jüdische Ehefrau nachweisen, daß sie eine geradezu mustergültige deutsche Hausfrau und Mutter gewesen war, was das Gericht zu grundsätzlichen Erwägungen über die Rechte der jüdischen Ehefrau veranlaßte: „Nun ist zwar auch einer Jüdin die Berufung darauf, daß das Verlangen des Mannes auf Aufhebung der Ehe mit Rücksicht auf die bisherige Gestaltung des ehelichen Lebens sittlich nicht gerechtfertigt sei, nicht schlechthin verschlossen. Bei einer Aufhebung wegen Judentums ist jedoch insoweit ein strenger Maßstab anzulegen. Die gute Führung der Beklagten als Frau und Mutter während der langen Ehe, kann für sich allein nicht dazu führen, die Aufhebung zu versagen.“ Ebd., S.5.
325 Ebd., 11b R 141/41.
326 Ebd., 4 R 152/42, S.2.
327 „Das Reichsgericht hat zu der Rechtsfrage des Fristablaufs allerdings – soweit dem Gericht bekannt ist – noch keine Stellung genommen, obwohl eine einheitliche Rechtssprechung insoweit wünschenswert wäre.“, so in ebd., 11b R 267/42, S.4.
328 Protokoll der Lenkungsbesprechung der Landgerichtsdirektoren am 20. Mai 1942: Landgerichtsdirektor, Landgericht HH, Zivilkammer 5 an Landgerichtspräsidenten Hamburg vom 21.5.1942 (abgedruckt in: Helge Grabitz, In vorauseilendem Gehorsam … Die Hamburger Justiz im „Führer-Staat“, in: Justizbehörde Hamburg (Hrsg.), „Für Führer…“, S.21-73, hier: S.57f.). Im Protokoll einer entsprechenden Besprechung der Hamburger Amtsrichter v. 16.6.1942 wurde bekräftigt, daß die neue Anfechtungsfrist auf die Zeit nach dem Herbst 1941 (Judenstern / Evakuierungen) gelegt werde und Unterhaltsforderungen der jüdischen Ehefrauen, deren Ehe angefochten worden sei, abzulehnen wären (vgl. Puerschel, Normalität, S.413).
329 Auf div. Urteilen finden sich Vermerke wie „Nachschau“, oder Hinweise, daß sie zur Vorlage beim Landgerichtspräsidenten gewesen waren, z.B. ALGH, 16a R 20/44, 16a R 203/43, 2 R 244/42.
330 Ebd., 2 R 244/42, S.5.
331 Ebd., 11a R 275/43.
332 Ebd., 15a R 94/43, 8 R 112/43, 11b R 162/43, 15b R 82/43.
333 In diesem Sinne: Ebd., 3b R 251/1943; 3b R 130/43; 3a R 46/43; 11b R 163/43, 6 R 83/43 u.a.
334 Während in früheren Klagen oft Aufhebung und hilfsweise Zerrüttung, für die die angegebenen Gründe in der Regel ausreichten, beantragt wurden, hatte sich das Verhältnis 1943 umgedreht: Wenn die aufgelisteten Gründe für den Tatbestand der Zerrüttung nicht reichten, genügten sie für die Aufhebung nun allemal. Vgl. z.B. ebd., 2 R 131/43.
335 Im April 1942 verfügte Roland Freisler, daß die Strafvollstreckung gegen Juden, die „evakuiert“ werden sollten, ausgesetzt würde. Beträfen die Deportationsdaten Untersuchungshäftlinge, so sei der Haftbefehl auszusetzen, falls nicht die Todesstrafe zu erwarten sei. Vgl. BAP, R 22, Reichsjustizministerium, 1238, 1, Dr. Freisler an den Herrn Oberreichsanwalt, die Herren OLG-Präsidenten, die Herren Generalstaatsanwälte u.a. v. 16.4.1942.
336 Vgl. Blutschutz- und Ehegesundheitsgesetz, dargestellt, medizinisch und juristisch erläutert von Gütt / Linden / Maßfeller, S.207f.
337 LGH, 7 R 333/44.
338 Ebd., 8 R 54/44, S.1. „Von Juden“ ist handschriftlich, also offensichtlich später, eingefügt.
339 Geht hervor aus StaHH, 522-1, Jüdische Gemeinden, Abl. 1993, Ordner 12, RVJD, Corten, an Gemeindeverwaltung Hamburg, Hauptwirtschaftsamt v. 20.9.1944.
340 Vgl. Die Sondereinheiten in der früheren deutschen Wehrmacht, bearbeitet im Personenstandsarchiv II des Landes Nordrhein-Westfalen (22c) Kornelimünster vom 14.11.1952, S.49, Verfügung OKW. v. 20.1.1940.
341 StaHH, 522-1, Jüdische Gemeinden, Abl. 1993, Ordner 12, Schriftwechsel RA Dr. Haas mit RVJD (Heinemann) um die Krankenhauskostenübernahme; Haas an Heinemann vom 12.6.1944 sowie Heinemann an Haas vom 24.7.1944, ders. an dens. v. 14.7.1944.
342 ALGH, 11 R 261/1944.
343 MBliV Nr. 40 v. 6.10.1943, RdErl. d. RMdI: Eheschließung von Beamten (RGBl. I 1943, S.120), Abs. 1 u. 3.
344 ALGH, 1 R 79/41.
345 Der Fall ist ausführlich dargestellt und kommentiert von Hans-Christian Lassen, Fall 17. Kriegswirtschaftsverbrechen – 1940, in: Justizbehörde Hamburg (Hrsg.), „Von Gewohnheitsverbrechern, Volksschädlingen und Asozialen…“. Hamburger Strafurteile im Nationalsozialismus, Hamburg 1995, S.208-229; Lassen weist in seiner Zusammenfassung darauf hin, daß in der Regel Anklagen wegen Kriegswirtschaftsverbrechen nicht zu Todesurteilen führten und hier die Lebensmittel dem Verbrauch gar nicht entzogen wurden. „Das Urteil mobilisiert mit fast jedem Satz antijüdische Vorurteile und wird von einem geradezu fanatischen Haß auf den Angeklagten getragen“, ebd., S.229.
346 BGBl. 1950, S.226.
347 Vgl. Ausblick, S.359 dieser Arbeit.
348 Die einzige jüdische Antragstellerin war eine Emigrantin, die eine Scheidung annullieren wollte. Ihr Antrag wurde abgelehnt, weil sie eine offene Ehe geführt hatte, die in den Augen der urteilenden Landesjustizbehörde nicht als „echtes Eheband“ zu werten war (vgl. AJH, 346 – 1f 3/1, Bl. 65-68). Da Hamburg Rechtsstandort für Emigranten war, die keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland mehr nachweisen konnten, gibt der Aktenbestand der LJV einen repräsentativen Einblick in die Praxis geschiedener Mischehen. In den wenigen Fällen, in denen sich die Paare nach dem Krieg wieder zusammentaten, waren die Ehefrauen nach Kriegsende in das Emigrationsland gekommen. Zumeist war dann die rentenrechtliche Versorgung der Ehefrau Grund für das Eheanerkennungsverfahren.
349 Vier Scheidungen lagen vor dem Jahr 1941; fünf im Jahr 1941, fünf im Jahr 1942 und acht im Jahr 1943.
350 In diesem Fall konnte der Anwalt nachweisen, daß der Verbandsvorsitzende der ambulanten Blumenhändler ein radikaler Antisemit war, der auch andere in Mischehe lebende Frauen unter Druck gesetzt hatte.
351 AJH, 3460/1/24 E-1, Vermerk LJV v. 13.1.1966, Bl. 100f.
352 Ebd., Vermerk LJV v. 27.10.1966, Bl. 125f.
353 Ebd., 346 E 1f 1/11, 346 E 1h 3/3, 346 E 1f 1/1, 346 E 1i 1/2, 346 E 1h 3/3.
354 Ebd., 346 E – 1f 2/10, RA Herbert Pardo an Landesverwaltungsgericht Hamburg v. 13.12. 1952, S.1f. Bl. 40f.
355 Wiedergabe der Position der LJV im Urteil des Landesverwaltungsgerichts Hamburg Az IIa VG 2800/52 v. 11.2.1953, S.12 (AJH, 346 E 1b 2/10, Bl. 49).
356 Ebd., 346 E 1f 1/11, RA Walter Klass an LJV v. 27.4.1946, zitiert in: Vermerk LJV 2.12.1955, Bl. 9.
357 Ebd., 346 E 1f 4/1, Vernehmung des ehemaligen Rechtsanwaltes der Ehefrau, RA R.W. Müller vor dem Landesverwaltungsgericht vom 22.5.1953, S.3.
358 Ebd., 346 E 1h 3/3, 12.XI.(ß)1951, Bl. 10, Max Plaut an Frau Sch. (o.D.); Plaut selbst berichtete in einem Interview, daß er viel „unangenehme Arbeit“ in der Nachkriegszeit gehabt hatte, um dieser und anderen Frauen bei Behörden zu ihrem Recht zu verhelfen, weil man „unerklärlicherweise (…) immer alles negativ ausgelegt hat – zu Unrecht, vollkommen zu Unrecht.“ (AIGJ, 14.-001.2., Max Plaut, Interview mit Christel Rieke, 1973, Transkript, S.8f.).
359 Kriminalsekretär Walter Wohlers, geb. am 5.5.1902, war vor seinem Eintritt in den Polizeidienst Landwirt. Am 10.7.1924 begann er den Dienst bei der Schutzpolizei, wo er bis zum 31.8.1933 blieb. Von dort wechselte er am 1.9.1933 zur Landespolizei Hamburg. Hier war er bis zum 31.3.1935 tätig. Vom 1.4.1935 bis 14.5.1937 diente er bei der Wehrmacht. In die NSDAP war er am 1.5.1933 eingetreten (Mitgl.-Nr. 2707967) und war auch Mitglied der SS. Außerdem erwarb er das SA-Sportabzeichen. (BA, Bestand BDC, NSDAP-Mitgliederkartei, RuS-Fragebogen, RS-Nr. 6065010300).
360 AJH, 346 E 1 i/3/5, G.W. an LJV v. 5.8.1956, S.1f.
361 StaHH, 622-1, Nachlaß Max Plaut, RA G.H.J. Scholz an Plaut v. 4.12.1943.
362 Ebd., Plaut an RA G.H.J. Scholz v. 6.12.1943.
363 AJH, 346 E – 1 g/3/1, Bl. 14, Vermerk im Strafregister einer „deutschblütigen“ Ehefrau: „Durch Verfügung des Polizeipräsidenten in Hamburg vom 28.10.38 ist der (…) auf Grund des §5 der Verordnung vom 22.8.1938 der Aufenthalt im Reichsgebiet auf unbefristete Zeit verboten worden.“
364 Vgl. Hamburger jüdische Opfer, S.39.
365 AJH, 346 E – 1 g/3/1, Bl. 11, O.B. an Eigenunfallsversicherung Hamburg (Abschrift aus Wiedergutmachungsakte) v. 12.8.1948.
366 Die Jüdische Gemeinde bescheinigte ihr die Mitgliedschaft ab 1948. Vgl. AJH, 346 E – 1 g/3/1, Bl. 25, dies. an LJV v. 4.9.1956.
367 Ebd., 346 E – 1 g/3/1, Bl. 9, Vermerk LJV v. 17.5.1956.
368 Ebd., Anordnung LJV v. 17.11.1956.
369 Ebd., Ihre Anwälte an LJV v. 25.4.1956, S.2.
370 Er überlebte nicht und wurde am 8.8.1947 für tot erklärt. Ebd., Bl. 9, Vermerk LJV vom 12.9.1956.
371 Ebd., Bl. 11-13, Urteil des Sondergerichts bei dem Deutschen Gericht, 4 Kls. 93/43.
372 Ebd., Bl. 10, Ärztliches Gutachten (auszugsweise Abschrift) v. 31.3.1949.
373 Ebd., Bl. 16f., Anordnung LJV v. 10.10.1956.
374 Ebd., 346 – 1g/3/3, Bl. 8f. u. 17, Eidesstattliche Erklärung G.H. v. 2.6.1956; Amtsgerichtsrat Dr. U. an RA Dr. F.v.H. v. 17.10.1956.
375 Ebd., Bl. 9, Erklärung M.A. v. 17.7.1953.
376 Ebd., Bl. 16f., Erklärung L.F. v. 16.10.1956.
377 Ebd., Bl. 23f., Anordnung LJV v. 7.11.1956.
378 Beispielsweise im Falle der geschiedenen Ehefrau G.O., AJH, 346 E – 1f/3/6, Bl. 11f., Erklärung ders. v. 19.4.1956.
379 Nach dem §81 des Ehegesetzes war das „Wohl des Kindes“ Kriterium für das Sorgerecht. Minderjährige Kinder wurden einem allein oder überwiegend schuldig geschiedenen Ehepartner nur dann zugesprochen, wenn besondere Gründe dafür vorlagen. Meistens waren dies die Mütter, auch die jüdischen. Ein Versuch des RJM, Übereinstimmung über neue Regelungen zu erzielen, verlief offensichtlich im Sande. Während das Justiz- und das Innenministerium dafür plädierten, bei alleiniger oder überwiegender Schuld des jüdischen Ehepartners das Sorgerecht dem „deutschblütigen“ Teil zu übertragen, vertrat die NSDAP / StdF die Auffassung, daß „Mischlinge ersten Grades“ („Geltungsjuden“ selbstredend) grundsätzlich dem jüdischen Elternteil überlassen werden sollten. Allenfalls bei „Mischlingen zweiten Grades“ könnte ein deutscher Pfleger bestellt werden. Dahinter stand kaum verborgen die alte Absicht, die „Mischlinge“ den Juden zuzuschlagen. Ungeachtet dieser Diskussionen, von denen sie vermutlich nichts wußten, waren jüdische Frauen durch minderjährige Kinder – bis diese ein bestimmtes Alter erreichten, – zumindest bis Ende 1944 vor der Deportation geschützt. Vgl. zu den kurz referierten Positionen Schriftwechsel im BAP, R 22, Reichsjustizministerium, 450.
380 RIOD, Generalkommissar für Verwaltung und Justiz 25/43 150 h, Vermerk: „Am 30./31.3. 1944 sind in Amsterdam und anderwärts vom SD 300 bis 400 jüdische Personen verhaftet worden, die mit Nichtjuden verheiratet waren und aus dieser Mischehe Nachwuchs (noch lebende Kinder und Kindeskinder) besitzen, der im Sinne des Gesetzes nichtjüdisch ist.“
381 Vgl. Gisela Bock, Gleichheit und Differenz in der nationalsozialistischen Rassenpolitik, in: Geschichte und Gesellschaft 3 (1993), Göttingen 1993, S.277-310.
382 Ebd., S.308.
383 Zu diesem Ergebnis kommt auch Lekebusch nach einer Auswertung von Urteilen, die in rheinischen Städten gefällt wurden. Vgl. Lekebusch, Not und Verfolgung, S.40.
384 Stoltzfus, Widerstand, S.221.
385 Ebd., S.224f.
386 Ebd., S.327.
387 Vgl. Dipper, Schwierigkeiten, S.415.
388 Der Begriff ist dem Titel eines veröffentlichten Vortrages entnommen: Ursula Büttner, Bollwerk Familie. Die Rettung der Juden in „Mischehen“, in: Günther B. Ginzel (Hrsg.), Mut zur Menschlichkeit, Köln 1993, S.59-77.
389 Blau, Mischehe, S.57.