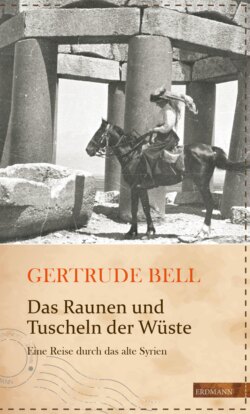Читать книгу Das Raunen und Tuscheln der Wüste - Bell Gertrude Lowthian - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I VON JERUSALEM NACH SALT
ОглавлениеWer in einem komplizierten sozialen Gefüge aufgewachsen ist, erlebt selten einen Moment solch überschwänglicher Freude wie am Beginn einer kühnen Reise. Die Pforte des ummauerten Gartens springt auf, die Kette am Eingang zum geschützten Raum wird heruntergelassen, unsicher blickt man nach rechts und links, wagt den Schritt über die Schwelle und da ist sie: die unermessliche Welt. Eine Welt des Abenteuers und der Wagnisse, verdunkelt von tobenden Stürmen, gleißend in grellem Sonnenlicht, in jeder Senke eines jeden Berges lauern offene Fragen und nicht zu stillende Zweifel. In diese Welt musst du allein eintreten, ohne die Freunde, die in Rosengärten wandeln, du musst den Purpur und das feine Leinen ablegen, die den Arm beim Kampf behindern, du bist ohne Dach, ohne Schutz, ohne Besitztümer. Statt der Stimme des klugen Beraters spricht die Stimme des Windes; das Peitschen des Regens und das Beißen des Frostes werden dir ein schärferer Ansporn sein als Lob und Tadel, die Erfordernisse des Augenblicks sprechen mit einer Autorität, die allen wohlfeilen Weisheiten fehlt, die der Mensch nach Gutdünken annimmt oder verwirft. So also verlässt du die Abgeschiedenheit und kaum hast du den Pfad betreten, der das Rund der Erde umläuft, spürst du, wie der Held im Märchen, die Eisenringe zerspringen, die um dein Herz geschmiedet waren.
Der 5. Februar begann stürmisch. Der Westwind fegte vom Mittelmeer herein, raste über die Ebene, wo die Kanaaniter die widerspenstigen Bergbewohner Judäas bekriegt hatten, übersprang die Hürde des Gebirges, das die Könige von Assyrien und von Ägypten nicht überwinden konnten. Jerusalem rief er die Kunde vom kommenden Regen zu, raste an den unfruchtbaren Osthängen hinab, übersprang leichtfüßig das tiefe Bett des Jordans, und verschwand über den Hügeln von Moab in die Wüste. Die Meute der Stürme jagte ihm nach, ein kläffendes Rudel, übermütig ostwärts drängend.
Niemand, in dem das Leben pulsierte, konnte an einem solchen Tag im Hause bleiben, ich aber hatte gar keine Wahl. In der grauen Winterdämmerung waren die Maultiere losgezogen, auf ihrem Rücken trugen sie meine gesamte weltliche Habe – zwei Zelte, eine Feldküche und Vorräte für einen Monat, fotographische Utensilien, einige Bücher und vor allem einen Satz guter Landkarten, das alles war von so geringem Luxus, dass selbst der genügsamste Reisende kaum weniger haben dürfte. Die Maultiere und die drei Maultiertreiber hatte ich aus Beirut mitgebracht, sie waren mir lieb genug, um sie auf die weitere Reise mitzunehmen. Die Männer stammten aus dem Libanon. Zwei, Vater und Sohn, beide Christen, kamen aus einem Dorf oberhalb von Beirut. Der Vater war ein alter, zahnloser Mann, er saß rittlings über den Maultierkisten, murmelte unablässig vor sich hin, Segnungen und fromme Sprüche, dazu Beteuerungen der Ergebenheit gegen seine gnädigste Frau Auftraggeber, womit seine Anstrengungen, zum Wohle aller beizutragen, erschöpft waren. Der Greis hieß Ibrahim, sein Sohn Habib war ein junger Mann, zweiundzwanzig oder dreiundzwanzig Jahre alt, dunkel, aufrecht und breitschultrig, mit einem Profil, um das ihn jeder Grieche beneidet hätte, und einem furchtlosen Blick unter schwarzen Brauen. Der Dritte war Druse, ein großer, schlaksiger Mann, unverbesserlich träge, auf seine bescheidene Weise ein Spitzbube, der es allerdings verstand, meinen gerechten Zorn über gestohlenen Zucker und fehlende Piaster mit einem flehenden Blick zu entwaffnen, die Augen weit geöffnet und glänzend wie Hundeaugen. Er war gierig und recht stumpfsinnig, Fehler, die bei einer Ernährung aus trockenem Brot, Reis und ranziger Butter vermutlich kaum vermeidbar sind; als ich ihn zwischen seine Erzfeinde steckte, verrichtete er lustlos seine Arbeit, trottete hinter seinem Maultier und seinem Esel her, und wirkte dabei genau so unbeteiligt und abwesend wie schon in den Straßen von Beirut. Sein Name war Muhammed. Der letzte Mann der Karawane war Mikhail, der Koch, ein Christ aus Jerusalem, dem seine Religion nicht sehr schwer auf der Seele lag. Er war mit Mr. Mark Sykes gereist, der ihm folgende Beurteilung gegeben hatte: »Er versteht wenig vom Kochen, es sei denn, er hat dazugelernt, seit er zu mir kam, aber es scheint ihn niemals einen Deut zu interessieren, ob er lebt oder getötet wird.« Als ich Mikhail das übersetzte, überfiel ihn ein kaum unterdrückter Lachanfall, ich engagierte ihn auf der Stelle. Das war ein recht unzulänglicher Grund, aber nicht schlechter als die meisten anderen. Im Rahmen seiner Fähigkeiten diente er mir gut, er war ein kleiner Mann, empfindlich und stolz, immer bereit, einer möglichen Beleidigung zuvor zu kommen, mit einer großen Vorstellungsgabe, die sich in den drei Monaten unserer Bekanntschaft nie erschöpfte. Seine Anstellung bei Mr. Sykes endete, nachdem sie auf dem Vansee zusammen in Seenot geraten waren. In den Jahren seither hatte Mikhail manches andere gelernt, er machte sich aber leider nie die Mühe, mir die Geschichte dieses Abenteuers zu erzählen, als ich einmal darauf anspielte, nickte er allerdings und sagte: »Wir waren dem Tod so nah wie der Bettler der Armut. Aber wie Eure Exzellenz wissen, kann man nur einmal sterben«, während er mich andererseits ständig mit Berichten über Touristen bombardierte, die erklärt hatten, dass sie ohne seine Kochkünste Syrien weder bereisen konnten noch wollten. Er hatte eine unheilvolle Schwäche für Arak, und nachdem ich von Schmeicheleien bis zur Jagdpeitsche alles versucht hatte, um das zu unterbinden, trennte ich mich an der kilikischen Küste abrupt von ihm, durchaus mit einem Bedauern, das nicht seinen zähen Ragouts und kalten Pfannkuchen galt.
Ich wollte die verlassene Straße nach Jericho unbedingt allein entlang reiten, wie ich es früher getan hatte, wenn ich in die Wüste aufbrach. Aber Mikhail meinte, das sei mit meiner Würde unvereinbar, und ich wusste, dass selbst sein ständiges Plappern der Straße ihre Einsamkeit nicht würde nehmen können. Um neun Uhr saßen wir im Sattel, umrundeten ernst Jerusalems Mauern, ritten in das Tal von Getsemani hinunter, am Garten Getsemani vorbei und zum Ölberg hinauf. Hier rastete ich, um auf die befestigte Stadt zu schauen, keine Vertrautheit kann den Glanz dieses Anblicks schmälern. Sie lag unter einem tiefen Himmel, grau in grauer und steiniger Landschaft, doch von der Hoffnung und dem unstillbaren Sehnen vieler Pilgergenerationen erleuchtet. Das menschliche Streben, das blinde Tasten des gefesselten Geistes nach einem Ort, wo alle Bedürfnisse gestillt werden, wo die Seele Frieden findet – das ist es, was diese Stadt wie ein Heiligenschein umgibt; und dieser Heiligenschein ist teils brillant, teils erbärmlich, von Tränen glänzend und von vielen Enttäuschungen matt. Der Westwind drehte mein Pferd, schicke es im Galopp über den Kamm des Berges, zur Straße hinunter, die sich durch Judäas Wildnis schlängelt.
Am Fuße des ersten Abstiegs liegt eine Quelle, die Araber nennen sie Ain esh Shems, Sonnenbrunnen, die Christen haben sie Apostelbrunnen getauft. Wer im Winter dort vorbeikommt, wird fast immer russische Bauern sehen, die auf ihrem beschwerlichen Weg den Jordan hinauf hier rasten. Jahr für Jahr strömen sie zu Zehntausenden ins Heilige Land, überwiegend alte Männer und Frauen, die ein Leben lang geknausert und gespart haben, bis sie etwa dreißig englische Pfund zusammen hatten, die sie nach Jerusalem führen würden. Von den entlegensten Ecken des russischen Reiches gehen sie zu Fuß an das Schwarze Meer und reisen von dort als Deckpassagiere auf schmutzigen russischen Kähnen. Ich bin mit 300 von ihnen von Smyrna nach Jaffa gereist und war der einzige Passagier mit Kabine. Es war mitten im Winter, stürmisch und kalt für alle, die an Deck schliefen, auch wenn sie Schaffellmäntel und gefütterte Stulpenstiefel trugen. Aus Gründen der Sparsamkeit hatten meine Mitreisenden ihren Proviant mitgebracht, einen Laib Brot, ein paar Oliven, eine rohe Zwiebel, daraus bestand ihr tägliches Mahl. Morgens und abends versammelten sie sich zum Gebet vor einer Ikone, die an der Kombüse hing, der Klang ihrer Litanei stieg, zusammen mit dem Stampfen der Schraube und dem Klatschen der Gischt, gen Himmel. Die Pilger erreichen Jerusalem vor Weihnachten und bleiben bis nach Ostern, um ihre Kerzen am heiligen Feuer entzünden zu können, das am Morgen der Auferstehung aus dem Heiligen Grab hervorbricht. Sie wandern zu Fuß an alle heiligen Stätten und übernachten in großen Herbergen, die die russische Regierung für sie erbaut hat. Viele sterben an Unterkühlung, Erschöpfung oder wegen des ungewohnten Klimas; aber in Palästina zu sterben, ist die größte Gnade, die der Himmlische Vater ihnen gewähren kann, denn dann ruhen ihre Gebeine friedlich im Heiligen Land und ihre Seele fliegt direkt ins Paradies. Man begegnet diesen sehr einfachen Reisenden auf jeder Landstraße, geduldig trotten sie unter brennender Sonne und eisigen Winterregen, bekleidet mit Pelzen aus ihrer Heimat, in der Hand einen Stab aus Rohr vom Jordanufer. Sie fügen dieser Landschaft, die so voll schwermütiger Poesie ist, einen grellen Klang von Pathos hinzu. Ich habe in Jerusalem eine Geschichte gehört, die das Wesen dieser Pilger besser beschreiben kann als seitenlange Schilderungen. Ein Einbrecher war auf frischer Tat ertappt und nach Sibirien geschickt worden, wo er viele Jahre Sträfling war. Als seine Zeit vorüber war, kehrte er geläutert zu seiner alten Mutter zurück und sie reisten zusammen ins Heilige Land, damit er für seine Sünden Buße tun konnte. Nun muss man wissen, dass sich zur Pilgerzeit das Gesindel aus Syrien in Jerusalem einfindet, um sie in ihrer Einfalt zu betrügen und zu Almosen zu nötigen. Einer dieser Vagabunden bettelte den russischen Büßer an, aber der hatte selbst nichts. Der Syrer, zornig über die Weigerung, schlug den andern zu Boden und verletzte ihn so schwer, dass er drei Monate im Spital bleiben musste. Als er genesen war, kam der russische Konsul zu ihm und sagte: »Wir haben den Kerl, der dich fast getötet hat; vor deiner Abreise musst du gegen ihn aussagen.« Aber der Pilger antwortete: »Nein, lasst ihn gehen. Auch ich bin ein Verbrecher.«
Hinter der Quelle war die Straße leer, und obwohl ich sie gut kannte, berührte mich ihre unglaubliche Trostlosigkeit auch dieses Mal wieder. Kein Leben, keine Blumen, die nackten Stängel der letztjährigen Disteln, die kahlen Berge, die steinige Straße. Und doch hat Judäas Wildnis den Feuereifer der Menschen geschürt. Von dort kamen grimmige Propheten, die einer Welt, die sie weder kannten noch verstanden, mit Untergang drohten; die Täler sind voll von Höhlen, in denen sie hausten; in einigen leben noch heute hungernde, abgemagerte Asketen, die an einer Art von Frömmigkeit festhalten, gegen die der gesunde Menschenverstand wenig auszurichten vermag. Vor Mittag erreichten wir die Karawanserei, auf halben Weg nach Jericho, der Legende nach ist dies der Ort, wo der Gute Samariter den Mann am Wegesrand fand. Ich ging hinein, um vor dem tobenden Wind geschützt zu essen. In der Gaststube saßen drei Deutsche, offenbar Handlungsreisende, schrieben Ansichtspostkarten und feilschten mit dem Herbergswirt um den Preis nachgemachter Beduinenmesser. Ich lauschte ihrem unsinnigen, vulgären Reden, es würde für viele Wochen das letzte Mal sein, dass ich eine europäische Sprache hörte, aber ich trauerte der Zivilisation nicht nach, die ich nun verließ. Östlich der Karawanserei fällt die Straße ab und überquert ein trockenes Flussbett, das Schauplatz vieler Tragödien war. Früher warteten dort, von der Uferböschung verborgen, Beduinen auf die vorüber ziehenden Pilger, um sie auszurauben und zu ermorden. Vor fünfzehn Jahren war die Straße von Jericho ebenso gesetzlos wie das Land jenseits des Jordans heute. In den letzten zehn Jahren hat sich der sichere Streifen um einige Meilen nach Osten erweitert. Endlich erreichten wir den Gipfel des letzten Hügels, vor uns lagen das Tal des Jordans und das Tote Meer, dahinter die dunstigen Moabiter Berge, das Grenzgebiet zur Wüste. Zu unseren Füßen lag Jericho, ein unromantisches Dorf mit baufälligen Hotels und Hütten, in denen die einzigen Araber hausen, die der Tourist je zu Gesicht bekommt, eine niedere Rasse, halb Araber, halb Negersklaven. Ich ließ mein Pferd bei den Maultiertreibern, die wir am Hang eingeholt hatten – »Möge es Gott gefallen, dass es Euch wohlergeht« – »Ehre sei Gott! Wenn es Eurer Exzellenz wohlergeht, sind wir zufrieden« – und ging den Hügel hinunter ins Dorf. Aber Jericho konnte an diesem ersten, wunderbaren Reisetag nicht unser Ziel sein. Ich wollte Touristen, Hotels und Ansichtskarten unbedingt hinter mir lassen. Zwei weitere Stunden und wir wären am Jordanufer, an der Holzbrücke, die vom Okzident hinüber führt in den Orient. Dort könnten wir an einem geschützten Platz lagern, an kleinen Lehmhügeln, in einem Dickicht aus Schilfrohr und Tamarisken. Ein kurzer Halt, um Futter für die Pferde und die Maulesel zu kaufen, dann ritten wir durch den schmalen Streifen Ackerland, der Jericho umgibt, in den Ghor, das Tal des Jordan.
Die Straße nach Jericho ist ausgesprochen karg, das Jordantal aber hat eine Unmenschlichkeit, die bösartig anmutet. Hätten die Propheten des Alten Testaments ihren Bannfluch so gegen das Jordantal geschleudert, wie sie Babylon oder Tyros verfluchten, es gäbe keinen besseren Beweis für ihre Prophezeiungen; aber sie schwiegen, und unsere Fantasie muss zu den flammenden Visionen von Sodom und Gomorra Zuflucht nehmen, zu den düsteren Legenden von Laster, die nicht nur durch unsere Kindheit spukten, sondern auch die Kindheit der semitischen Stämme heimsuchten. Auf diesem tiefsten Punkt der Erdoberfläche lastet eine schwere, stickige Atmosphäre, über uns stürmte der Wind in Gegenden, wo Menschen frische Luft atmeten, in diesem Tal aber war es so luft- und leblos wie am Grund des tiefen Meeres. Wir bahnten uns den Weg durch das niedrige Buschwerk des dornigen Sidrbaumes, der Christusdorn, dessen Zweige der Sage nach zur Dornenkrone geflochten wurden. Es gibt zwei Arten des Sidrbaums, die Araber nennen sie zakum und dom. Aus dem zakum gewinnen sie ein Heilöl, der dom trägt eine kleine, dem Holzapfel ähnliche Frucht, die zu einem einladenden Rotbraun reift. Sie ist die Frucht des Toten Meeres par excellence, sie ist schön anzusehen und hinterlässt auf den Lippen einen Geschmack sandiger Bitterkeit. Die Sidrs wurden weniger, bis sie schließlich ganz verschwanden, dann war vor uns nur noch eine ausgetrocknete Lehmfläche, auf der nichts Grünes mehr wuchs. Sie ist von gelber Farbe und hat giftig grau-weiße Salzflecken: das Auge begreift augenblicklich, fast unbewusst, ihre Lebensfeindlichkeit. Als wir dort entlang ritten, gerieten wir in einen schweren Regenguss. Die Maultiertreiber blickten ernst, selbst Mikhails Gesicht wurde lang, denn vor uns lagen die Erdharzgruben der Genesis, die Pferde und Maulesel nur bei absoluter Trockenheit durchqueren können. Der Regen war nach wenigen Minuten vorbei, doch das hatte genügt. Plötzlich hatte der harte Lehm die Konsistenz von Butter, die Pferde sanken bis zum Fesselgelenk ein, mein Hund Kurt wimmerte, wenn er die Pfoten aus dem gelben Leim zog. Dann kamen wir zu den Harzgruben, dem befremdlichsten Merkmal dieser unheimlichen Landschaft. Eine Viertelmeile westlich des Jordans – auf der Ostseite des Flusses ist dieser Streifen erheblich schmaler – löst sich die flache Ebene plötzlich in eine Reihe steiler, durch schmale Rinnsalen getrennte, Schlammbänke auf. Sie sind nicht hoch, dreißig, höchstens vierzig Fuß, aber die Kämme sind so scharf und die Seiten so steil, dass der Reisende beim Weg über sie hinweg und um sie herum äußerste Vorsicht walten lassen muss. Durch den Regen waren die Seiten glatt wie Glas, selbst zu Fuß war man ständig in Gefahr zu straucheln. Mein Pferd stürzte, als ich es führte; zum Glück geschah das zwischen zwei Hügeln, es konnte sich unter den erstaunlichsten Verrenkungen wieder aufrichten. Als ich meine Karawane aus den Harzgruben herauskommen sah, entfuhr mir ein rasches Dankgebet; hätte es weiter geregnet, wären wir stundenlang gefangen gewesen, denn wenn ein Reiter in eine dieser schlammigen Gruben hineinfällt, muss er dort warten, bis das Loch wieder trocken ist.
Am Flussufer war Leben. Der Boden war mit frischem Gras und gelben Tausendschön bedeckt, das rostfarbene Kleid der Tamariskensträucher ließ erste Anzeichen von Frühling erkennen. Ich trabte zu der großen Brücke mit dem seitlichen Gitterwerk und dem Balkendach, es ist das inspirierendste Bauwerk der Welt, denn es ist das Wüstentor. Und da lag auch der Platz, wie ich ihn in Erinnerung hatte, mit kurzem Gras bedeckt, von hohen Ufern geschützt und, dem Himmel sei Dank!, leer. Wir hatten uns wegen dieses Brückenkopfes Sorgen gemacht. Gerade zu jener Zeit zog die türkische Regierung alle verfügbaren Truppen zusammen, um den Aufstand im Jemen niederzuschlagen. Die südsyrischen Regimenter marschierten über diese Brücke in Richtung Amman, wo sie in Eisenbahnzüge verladen und mit der Hedschasbahn zur damaligen Endstation Maan bei Petra verfrachtet wurden. Von Maan aus mussten sie einen furchtbaren Marsch durch eine Sandwüste zurücklegen, bis zur Spitze des Golfes von Akabah. Hunderte von Männern und tausende Kamele starben, ehe sie dort ankamen, auf der ganzen Strecke (sagen die Araber) gibt es nur drei Brunnen, einer davon liegt etwa zwei Meilen abseits der Straße, wer das Land nicht kennt, wird ihn nicht finden.
Wir schlugen die Zelte auf, banden die Pferde an und entzündeten aus Tamarisken- und Weidenzweigen ein gewaltiges Freudenfeuer. Die Nacht war bewölkt und völlig still, in den Hügeln regnete es, bei uns nicht – die jährliche Niederschlagsmenge im Jordangraben beträgt wenige Zentimeter. Ganz allein waren wir allerdings doch nicht. Die türkische Regierung erhebt nämlich von allen, die die Brücke überqueren, eine kleine Gebühr, daher ist dort ein Wächter stationiert. Er lebt in einem Lehmhüttchen am Brückentor, ein oder zwei zerlumpte Araber aus dem Ghor teilen seine Einsamkeit. Einer war ein grauhaariger Neger, der Holz für unser Feuer sammelte und zum Dank den Abend mit uns verbringen durfte. Er war ein fröhlicher Geselle, dieser Mabuk, und tanzte vergnügt ums Lagerfeuer, ganz unbeschwert von der Tatsache, dass kein zweiter Mensch auf Gottes weiter Erde so missgestaltet sein konnte wie er. Er erzählte uns von den Soldaten, dass sie in Lumpen zur Brücke kamen, dass ihnen die Stiefel von den Füßen fielen, und das am ersten Tag des Marsches! Außerdem waren sie halb verhungert, diese armen Kerle. Am Morgen war ein Tabur (900 Mann) durchgekommen, wir hatten die Redifs, die türkische Miliz, gerade verpasst – für morgen wurden weitere erwartet. »Maschaallah!«, sagte Mikhail, »Eure Exzellenz sind vom Glück begünstigt. Erst entkommt ihr den Schlammgruben, dann den Redifs.« »Gott sei gepriesen«, murmelte Mabuk. Von diesem Tag an galt als ausgemacht, dass ich unter einem glücklichen Stern reiste. Von Mabuk hörten wir den ersten Wüstenklatsch. Unentwegt sprach er von Abdullah Ibn Rasheed, dem jungen Führer der Schammar, dem sein mächtiger Onkel als unbequemes Erbe Land in Zentralarabien hinterlassen hat. Zwei Jahre lang hatte ich nichts mehr aus Nejd gehört; wie stand es um Ibn Saud, dem Herrscher von Riyadh, Ibn Rasheeds Rivalen? Was war mit dem Krieg, den sie gegeneinander führten? Mabuk hatte viele Gerüchte gehört; Männer hatten gesagt, dass Ibn Rasheed in großer Not sei, vielleicht, wer weiß?, waren die Redifs auf dem Weg nach Nejd und nicht nach Jemen. Und hatten wir schon gehört, dass die Ajarmeh den Scheich der Sukhur ermordet hatten, und dass, sobald der Stamm von den Weiden im Osten zurückkehre … Es waren die uralten Geschichten von Blutrache und Kamelraub, das Raunen und Tuscheln der Wüste – ich hätte vor Freude weinen können, das alles wieder zu hören. An meinem Lagerfeuer herrschte an jenem Abend ein Babel arabischer Sprachen, Mikhail sprach die vulgäre, gänzlich würdelose Sprache Jerusalems, Habib, atemberaubend schnell, einen Dialekt des Libanons, Muhammed das gedehnte, langsame und monotone Beirutisch, und der Neger sprach etwas, das der virilen, schönen Sprache der Beduinen ähnelte. Auch die Männer staunten über die Unterschiede in ihrer Sprache, einmal wandten sie sich zu mir und fragten, welche die richtige sei. Ich konnte nur antworten, »Das weiß Gott allein!, denn Er ist allwissend!«, was mit Lachen quittiert wurde. Ich gestehe allerdings, dass ich mich dabei nicht ganz wohl fühlte.
Der nächste Tag begann windstill und grau. Grundsätzlich sollten zwischen meinem Aufwachen und dem Aufbruch der Maulesel anderthalb Stunden liegen, manchmal brachen wir zehn Minuten früher auf, manchmal, leider!, etwas später. Ich verbrachte die Zeit im Gespräch mit dem Brückenwächter, der aus Jerusalem stammte. Meinen mitfühlenden Ohren vertraute er seine Sorgen an, die üblen Tricks, mit denen die osmanische Regierung ihn zu betrügen pflege, und die furchtbare Last der Existenz in der Hitze des Sommers. Und der Lohn!, wenig mehr als nichts! Seine Einnahmen waren allerdings höher, als er einzuräumen bereit war, denn später entdeckte ich, dass er mir für jedes meiner sieben Tiere nicht zwei, sondern drei Piaster berechnet hatte. Es ist einfach, mit Orientalen im besten Einvernehmen zu sein, und wenn ihre Freundschaft einen Preis hat, ist er meist sehr niedrig. Also überschritten wir den Rubikon für drei Piaster pro Kopf und nahmen die nördliche Straße nach Salt. Die südliche führte nach Madeba in Moab, die mittlere nach Heshban, wo Sultan ibn Ali id Diab ul Adwan lebt, Scheich aller Belka-Araber und ein wahrer Schurke. Die Ostseite des Jordangrabens ist erheblich fruchtbarer als die Westseite. Von den schönen Hängen des Ajlun fließt genug Wasser, um die Ebene in einen Garten zu verwandeln, aber es gibt keine Wasserspeicher und die Araber der Adwan-Stämme begnügen sich damit, ein wenig Getreide anzubauen. Noch blühte nichts, Ende März aber verwandelt sich der östliche Ghor in einen bunten, wunderbaren Blütenteppich. Wegen der Gluthitze in diesem Tal ist nach einem Monat alles vorbei, die Pflanzen haben nur diesen einen Monat, um zu knospen, zu erblühen und ihre Samen auszustreuen.
Ein zerlumpter Araber zeigte uns den Weg. Er war hier, weil er sich den Redifs hatte anschließen wollen, ein wohlhabender Einwohner von Salt hatte ihm fünfzig Liras gegeben, damit er als sein Ersatzmann einzieht. Aber an der Brücke musste er feststellen, dass er zu spät kam, sein Regiment war vor zwei Tagen vorbei gezogen. Das tat ihm leid, er wäre gern in den Krieg marschiert (außerdem würde er vermutlich die fünfzig Liras zurückgegeben müssen), aber seine Tochter werde sich freuen, sagte er. Sie habe geweint, als er fort ging. Er blieb stehen und zog einen seiner Lederschlappen aus dem Schlamm.
»Im nächsten Jahr, wenn es Gott gefällt«, sagte er, als er mich wieder eingeholt hatte, »fahre ich nach Amerika.«
Erstaunt betrachtete ich die halbnackte Gestalt. Die Schuhe fielen ihm von den bloßen Füßen, das zerrissene Gewand glitt von der Schulter, er trug die Kopfbedeckung der Wüste, ein mit einem Kamelhaarseil befestigtes Tuch.
»Sprichst du Englisch?«, fragte ich.
»Nein«, antwortete er ruhig, »aber in einem Jahr habe ich das Geld für die Reise zusammen, denn bei Gott, hier ist kein Fortkommen!«
Ich fragte ihn, was er in den Vereinigten Staaten tun wolle.
»Kaufen und verkaufen«, sagte er; »und wenn ich 200 Liras gespart habe, komme ich zurück.«
Diese Geschichte hört man überall in Syrien. Jahr für Jahr brechen Hunderte auf, und wohin sie auch kommen, überall finden sie Landsleute, die ihnen helfen. Sie bieten auf der Straße billige Waren an, schlafen unter Brücken, ernähren sich von einer Kost, die niemand aus freien Stücken zu sich nehmen würde. Sobald sie um die 200 Liras haben, kehren sie in die Heimat zurück, damit sind sie in den Augen ihres Dorfes reiche Männer. Östlich des Jordans wandern nicht so viele aus, aber einmal hielt ich in den Hauranbergen einen Drusen an, um ihn nach dem Weg zu fragen, und er antwortet mir in reinstem Yankee-Englisch. Ich hielt mein Pferd an, während er mir seine Geschichte erzählte, am Ende fragte ich ihn, ob er zurückgehen werde. Er stand knietief in Schlamm und Schneematsch, sah auf die Steinhütten seines Dorfs: »Und ob!« antwortete er, und als ich mich abwandte, rief er mir ein fröhliches »So long!« nach.
Nach einem zweistündigen Ritt erreichten wir die Berge und nahmen den Weg durch ein enges, gewundenes Tal, das mein Freund, nach dem gleichnamigen Stamm, Wadi el Hassaniyyeh nannte. Es war voller Anemonen, weißem Ginster (die Araber nennen ihn Rattam), Zyklamen, Traubenhyazinthen und wilden Mandelbäumen. Für Pflanzen ohne Nutzen, so schön sie sein mögen, hat das Arabische keine Namen; sie sind alle hashish, Gras; andererseits benennt und unterscheidet ihre Sprache noch das kleinste Pflänzchen, sofern es von Nutzen ist. Der Weg, wenig mehr als ein Ziegenpfad, stieg langsam an. Unmittelbar bevor wir in den Nebel eintauchten, der den Berggipfel einhüllte, sahen wir unter uns im Süden das Tote Meer, es lag unter dem grauen Himmel wie eine riesige Milchglasscheibe. Um vier Uhr nachmittags erreichten wir bei typischem Bergwetter mit nassem, dahinjagendem Nebel Salt. Der Boden rund um das Dorf war sumpfig, hier war der Regen gefallen, der in der Nacht über uns hinweggezogen war. Ich zögerte, das Lager aufzuschlagen, weil ich auf eine trockenere Unterkunft hoffte. Als erstes suchte ich das Haus von Habib Effendi Faris, denn ich war nach Salt gekommen, um ihn zu besuchen, auch wenn ich ihn nicht kannte. Für die Fortführung meiner Reise war ich völlig von seiner Unterstützung abhängig und hoffte sie wegen folgender Verbindung zu bekommen: Er war mit der Tochter eines aus Haifa gebürtigen Predigers verheiratet, Abu Namrud, und dieser würdige alte Mann war ein enger Freund von mir. Seine Familie stammt aus Urfa am Euphrat, aber er hatte lange in Salt gelebt und kannte die Wüste. Er sollte mich Grammatik lehren, aber den überwiegenden Teil der Unterrichtsstunden verbrachte ich damit, seinen Geschichten über die Araber zu lauschen – und über seinen Sohn Namrud. Dieser arbeitete mit Habib Faris zusammen, einen Namen, den jeder Araber der Belka-Hochebene kannte.
»Solltet Ihr jemals in die Wüste wollen«, hatte Abu Namrud gesagt, »geht zu meinem Sohn.« Also ging ich zu Namrud.
Man musste nicht viel herumfragen, um zu erfahren, wo Habib Faris’ Haus lag. Ich wurde herzlich empfangen, Habib war nicht da und Namrud fort (verließ mein Glück mich?) Aber ob ich nicht hereinkommen und mich ausruhen wolle? Das Haus war klein, die Kinder zahlreich; während ich mich noch fragte, ob die schlammige Erde vielleicht doch das bessere Bett sei, kam ein prachtvoller, alter Mann, ganz arabisch gekleidet, griff die Zügel meines Pferdes, und erklärte, dass niemand anders als er mich bewirten werde. Dann führte er mich fort. Ich ließ mein Pferd an der Karawanserei, erklomm eine lange, schlammige Treppe und stand schließlich in einem gepflasterten Innenhof. Yusef Efendi eilte voran und öffnete die Tür zu seinem Gastzimmer. Fußboden und Diwan waren mit dicken Teppichen bedeckt, in den Fenstern war Glas (auch wenn viele Scheiben zerbrochen waren), an der Wand stand eine europäische Chiffoniere: Das war mehr, als ich erhofft hatte. Binnen Minuten hatte ich mich eingerichtet, trank Yusefs Kaffee und aß meinen eigenen Kuchen.
Yusef Effendi Sukkar (Friede sei mit ihm!) ist Christ und einer der reichsten Männer Salts. Er ist wortkarg, aber als Gastgeber sucht er seinesgleichen. Er servierte mir ein hervorragendes Mahl, und als ich gegessen hatte, bekam Mikhail die Reste. Mein Gastgeber hatte für mein körperliches Wohl gesorgt, aber meine Ängste hinsichtlich meiner Weiterreise konnte oder wollte er mir nicht nehmen. Zum Glück kamen just in diesem Augenblick Habib Faris und seine Schwägerin Paulina, eine alte Bekannte, sowie einige weitere Würdenträger. Alle wollten sich unbedingt ›die Ehre geben‹, weil sie auf einen Abend mit Gesprächen hofften. (»Bei Gott dem Herrn! Die Ehre ist ganz die Meine!«) Wir setzten uns und tranken den bitteren schwarzen Kaffee der Araber, der jeden Nektar übertrifft. Die Tasse wird mit einem »Geruhet anzunehmen« gereicht, man gibt sie, geleert, mit einem gemurmelten »Mögest du leben!« zurück. Während man nippt, ruft jemand, »Auf doppelte Gesundheit!«, worauf man »Auf Euer Herz!« entgegnet. Als die Tassen ein- oder zweimal herumgegangen und alle erforderlichen Höflichkeitsformeln gesprochen waren, machte ich mich daran, meine Aufgabe für diesen Abend zu lösen. Wie konnte ich ins Drusengebirge kommen? Die Regierung würde mir vermutlich die Erlaubnis verweigern und in Amman, am Anfang der Wüstenstraße, gab es einen Militärposten. In Bosra kannte man mich, ich war ihnen vor fünf Jahre durch die Finger geschlüpft, ein zweites Mal würde mir das wohl kaum gelingen. Habib Faris dachte nach, schließlich schmiedeten wir beide einen Plan. Ich sollte am nächsten Tag nach Tneib, seinem Ackerland am Rand der Wüste, reiten; dort würde ich Namrud antreffen, er würde einen der großen Stämme benachrichtigen. Von ihnen eskortiert käme ich sicher durch die Berge. Yusef hatte zwei kleine Söhne, sie lauschten mit großen Augen, am Ende des Gesprächs brachte mir einer der beiden eine ausgerissene Zeitungsseite mit einer Landkarte von Amerika. Daraufhin zeigte ich ihnen meine Landkarten, erzählte ihnen, wie groß und wie schön die Welt sei, bis sich um zehn Uhr die Gesellschaft auflöste. Yusef begann, die Decken für mein Bett auszubreiten, erst da sah ich meine Gastgeberin. Sie war eine Frau von außergewöhnlicher Schönheit, groß und blass, das Gesicht ein perfektes Oval, die großen Augen wie Sterne. Sie trug ein arabisches Gewand, schmal und dunkelblau, das sich beim Gehen um ihre nackten Fesseln fing, ein tiefblauer Baumwollschleier war mit einem roten Band um ihre Stirn gebunden und fiel ihr über den Rücken, fast bis zum Boden. Wie es bei den Beduinenfrauen Sitte ist, waren ihr mit Indigo auf Wangen und Hals feine Muster tätowiert. Sie brachte Wasser und goss es über meine Hände, bewegte sich lautlos durch den Raum, eine dunkle und würdevolle Gestalt, als sie alle Aufgaben erledigt hatte, verschwand sie so still wie sie gekommen war. Ich sah sie nie wieder, und ich dachte an die Zeilen des Dichters, den man in Mekka in Haft gehalten hatte: »Sie trat ein und grüßte mich, dann erhob sie sich, um Abschied zu nehmen, und als sie meinen Blicken entschwand, folgte ihr meine Seele.« Niemand sieht Yusefs Ehefrau. Er mag Christ sein, doch seine Ehefrau hält er in größerer Abgeschiedenheit als jede Muslima. Vielleicht, wer weiß, tut er gut daran.
Der Regen schlug gegen die Fenster, ich legte mich auf die Decken und hörte Mikhail sagen: »Maschaallah! Eure Exzellenz sind vom Glück begünstigt.«