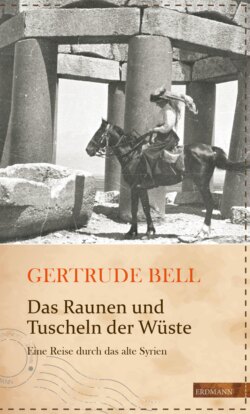Читать книгу Das Raunen und Tuscheln der Wüste - Bell Gertrude Lowthian - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II VON SALT NACH TNEIB
ОглавлениеSalt ist eine wohlhabende Gemeinde mit über 10.000 Seelen, die Hälfte Christen. Es liegt in einem reichen, für seine Trauben und Aprikosen berühmten Landstrich, seine Gärten wurden schon im vierzehnten Jahrhundert vom arabischen Geographen Abul Fida erwähnt und gepriesen. Auf einem Hügel über den dicht gedrängten Hausdächern liegt die Ruine einer Festung, ich weiß nichts Näheres über sie. Die Bewohner halten ihre Stadt für sehr alt; die Christen behaupten, Salt sei eine der ersten Glaubensgemeinden gewesen, der Legende nach soll sogar Christus selbst hier das Evangelium gepredigt haben. Die Äste der Aprikosenbäume waren noch kahl, und doch spürte ich, als ich durch das Tal ritt, eine Atmosphäre freundlichen Wohlstands. Begleitet wurde ich von Habib Faris, der auf seinem Pferd mit mir geritten war, um sicherzugehen, dass ich den richtigen Weg fand. Er selbst besaß einige dieser Aprikosenhaine und Weinberge, und er, der angenehme Mann, lächelte erfreut, als ich sie lobte. Wer hätte an einem solchen Morgen nicht gelächelt? Die Sonne schien, am Boden glitzerte Reif, die Luft hatte jene perlende Transparenz, die klare Wintertage nach einem Regenschauer haben können. Ich sage das nicht nur, weil mich ein allgemeines Gefühl von Wohlwollen beschwingte: die Christen von Salt und Madeba sind intelligente und fleißige Menschen, die Lob verdienen. Seit meinem letzten Besuch waren fünf Jahre vergangen, in denen sie die Grenze des kultivierten Landes um die Breite eines zweistündigen Ritts nach Osten verschoben haben. Dies bewies die Qualität des Bodens so unwiderlegbar, dass der Sultan, als die Hedschasbahn eröffnet wurde, einen großen Landstrich im Süden für sich beanspruchte, der bis Maan reichte. Er will ihn in eine Chiflik verwandeln, eine königliche Farm. Das wird ihn und seine Pächter reich machen, denn er mag ein mittelmäßiger Herrscher sein, aber er ist ein guter Landwirt.
Eine halbe Stunde hinter Salt verließ Habib mich und übergab mich der Fürsorge seines Knechts Yusef, ein kräftiger Mann, der neben mir her lief, die Holzkeule über der Schulter (die Araber nennen sie Gunwa). Wir kamen durch breite Täler, baumlos, unbewohnt, fast unbewirtschaftet, die die Belka-Ebene umgeben, und passierten den Eingang zum Wadi Sir, der, immer durch Eichenwälder, bis ins Jordantal führt. Auch hier auf den Höhen würden Bäume wachsen, wenn die Köhler sie nur stehen ließen, wir kamen durch einige Eichen- und Schwarzdornwäldchen, aber ich würde an der herrlichen Landschaft östlich des Jordans nichts ändern wollen. Ein oder zwei Generationen später wird hier Getreide stehen, überall sind Dörfer, das Wasser des Wadi Sir dreht Mühlräder, vielleicht gibt es bald sogar Straßen. Dann werde ich – gelobet sei Gott! – nicht mehr hier sein, um das zu sehen. So lange ich lebe, wird das Hochland jene wunderbare Landschaft bleiben, die Omar Chajjam besingt: »Ein schmales Band gesäten Grüns, trennt Wüste hier von Ackerland.« Es wird menschenleer sein, vereinzelte Schäfer ausgenommen, die mit einer langläufigen Flinte ihre Herde bewachen. Und wenn mir, selten genug, ein Reiter begegnet, der in diesen Bergen unterwegs ist, und wenn ich ihn frage, woher er kommt, wird er weiter antworten: »Möge deine Welt weit sein! Ich komme von den Arabern.«
Dorthin waren wir unterwegs: zu den Arabern. In der Wüste gibt es keine Beduinen, alle Zeltbewohner sind ’Arab (mit leichtem Rollen des Gutturalanlauts), und es gibt auch keine Zelte, sondern Häuser – wenn eine genauere Bezeichnung nötig ist, sagen sie ›Fellhaus‹, normalerweise aber nur ›Haus‹, und übergehen damit souverän jede andere Bedeutung als eines Daches aus schwarzem Ziegenfell. Auch wer zwischen Mauern lebt, kann in gewisser Weise ’Arab sein. Die Männer von Salt gehören zu den Stämmen der Belka-Ebene, das sind die Abadeh, die Da’ja, die Beni Hasan und einige andere, die zusammen die große Gruppe der Adwan bilden. Zwei mächtige Gruppen machen sich hier die Herrschaft über die syrische Wüste streitig, die Beni Sakhr und die Anazeh. Zwischen den Sukhur und den Belka herrscht traditionell eine, allerdings durch bedauerliche Zwischenfälle getrübte, Freundschaft. Das mag der Grund sein, warum man in dieser Gegend sagt, die Anazeh seien den Beni Sakhr zwar zahlenmäßig überlegen, aber bei weitem nicht so mutig wie sie. Mit einem der Söhne des Talal ul Faiz, Herrscher der Beni Sakhr, bin ich sehr flüchtig bekannt. Ich habe ihn vor fünf Jahren hier in dieser Ebene kennengelernt, das war aber einen Monat später als jetzt, um diese Zeit zieht sein Stamm von den heißen östlichen Weidegebieten zum Jordan. Damals ritt ich in Begleitung eines tscherkessischen Saptieh von Madeba nach Mschatta, die Deutschen hatten die reliefgeschmückte Fassade dieses wunderbaren Bauwerks noch nicht abgenommen. Überall auf der Ebene sah man Herden und die schwarzen Zelte der Sukhur, als wir hindurch ritten, preschten drei Reiter heran, mit finsteren Mienen, bis an die Zähne bewaffnet, bedrohlich anzusehen. Sie wollten uns aufhalten und riefen uns von weitem einen Gruß zu, doch als sie den Soldaten sahen, machten sie kehrt und ritten langsam zurück. Der Tscherkesse lachte. »Das war Scheich Faiz«, sagte er, »Talals Sohn. Wie Schafe, wallah! wenn sie einen von uns sehen, sind sie wie Schafe!« Die Anazeh kenne ich nicht, weil ihre üblichen Winterorte näher am Euphrat liegen, aber bei aller Achtung vor den Sukhur glaube ich doch, dass ihre Rivalen die wahren Aristokraten der Wüste sind. Ihr Herrscherhaus, die Beni Shaala, trägt den stolzesten Namen, ihre Pferde sind die besten in ganz Arabien. Selbst die Schammar, Ibn Rasheeds Volk, wollen sie haben, um ihre Zucht zu verbessern.
Aus den tief eingeschnittenen, den Ghor überragenden Bergen kamen wir in eine flache Hügellandschaft, die von kleinen antiken Ruinenstätten geradezu übersät war. Eine lag am Eingang des Wadi Sir. Eine Viertelstunde, bevor wir dorthin kamen, waren wir auf viele Fundamente samt einem großen Wasserbecken gestoßen, das die Araber Birket Umm el ’Amud (Becken der Mutter der Säule) nennen. Yusef sagte, der Name leite sich von einer Säule ab, die früher einmal mitten im Wasser gestanden habe; ein Araber habe darauf geschossen und sie zerbrochen, die Bruchstücke lägen am Boden des Beckens. Der Siedlungshügel von Amereh oder Tell, um ihn mit dem heimischen Namen zu bezeichnen, ist ruinenbedeckt, etwas weiter, in Yadudeh, sahen wir am Rand des Wasserbeckens steinerne Grabmale und Sarkophage. Überall in diesem Grenzland der Wüste finden sich solche Zeugnisse einer bevölkerungsreichen Vergangenheit, Dörfer aus dem fünften und sechsten Jahrhundert, als Madeba eine reiche, blühende christliche Stadt war, einige dürften noch älter sein, vielleicht vorrömisch.
In Yadudeh, dem Ort mit den Grabmalen, wohnte ein Christ aus Salt, er war der größte Kornproduzent der Gegend und lebte in einem sehr einfachen Haus am Gipfel des Tells. Auch er war einer dieser energischen neuen Männer, die darum kämpfen, die Grenzen des kultivierten Landes immer weiter hinauszuschieben. Hier verließen wir die bergige Landschaft und kamen an den Rand einer endlosen, mit spärlichem Grün bewachsenen Ebene. Hier und da gab es einen kegeligen Tell oder einen niedrigen Höhenzug – und dann wieder Ebene. Sie ist beruhigend anzusehen, nie monoton, in den Zauber des winterlichen Sonnenuntergangs gehüllt, weich gerundete Senken fangen den Nebel, weich schwellende Hügel das Licht, über allem ist die Himmelskuppel, die Wüste und Meer gleichermaßen überwölbt. Das erste Hügelchen war Tneib. Wir kamen nach neun Stunden an, es war 17 Uhr 30, die Sonne ging gerade unter, wir schlugen am Südhang die Zelte auf. Der ganze Abhang war ruinenübersät, niedrige Mauern aus grob behauenen, ohne Mörtel gelegten Steinen, in den Fels gehauene Zisternen, einige mit Sicherheit nicht für Wasser, sondern Getreide bestimmt, wofür sie auch jetzt benutzt wurden, und ein offenes, mit Erde aufgefülltes Wasserbecken. Namrud war unterwegs, um einen benachbarten Bauern zu besuchen, aber einer seiner Männer brach auf, um ihn von meiner Ankunft zu informieren. Um zehn Uhr kehrte Namrud bei eisigem Sternenschein zurück, mehrfach beteuerte er seine Freude und versicherte, dass meine Wünsche sehr einfach zu erfüllen seien. So schlief ich von der kalten Stille der Wüste umhüllt ein, und wachte am folgenden Morgen in einer glitzernden Welt voll Sonnenschein und angenehmen Aussichten wieder auf.
Als erstes musste zu den Arabern geschickt werden. Nach einigen Überlegungen entschieden wir uns für die Da’ja, ein Stamm der Belka-Hochebene. Sie waren uns am nächsten und vermutlich auch am ehesten von Nutzen, also schickten wir einen Boten zu ihren Zelten. Den Morgen verbrachten wir damit, den Hügel zu erkunden und eine großen Menge Kupfermünzen zu begutachten, die unter Namruds Pflug aufgetaucht waren. Sie waren alle römisch, eine mit dem schwachen Konterfei Konstantins, einige älter, keine stammte aus der jüngeren byzantinischen Periode oder der Zeit der Kreuzzüge; diesen Münzen nach zu urteilen, war Tneib seit den Zeiten der arabischen Invasion verlassen. Namrud hatte die Nekropolis entdeckt, aber in den Gräbern war nichts zu finden, sie waren vermutlich schon vor Jahrhunderten geplündert worden. Sie waren in den Fels gehauen und ähnelten Zisternen. Dicht über dem Erdboden waren zwei massive Steinsäulen, dazwischen ein schmaler Durchgang, an den Seitenwänden einige unregelmäßige Vorsprünge, Stufen für jene, die hinabsteigen müssen, im unteren Raum Nischen, eine über der anderen, die wie Regale an den Wänden entlang laufen – so sahen sie aus. In der Nähe des Südhangs waren Grundmauern eines Bauwerks, das eine Kirche gewesen sein könnte. Ein mageres Ergebnis für einen ganzen langen Tag, darum ritten wir in der goldenen Nachmittagssonne zwei Stunden nach Norden in ein breites, von flachen Hängen gesäumtes Tal. Seine Ränder waren mit Ruinen gesäumt, nach Osten hin standen einige Mauerfundamente in der Mitte des Tals – Namrud nannte den Ort Kuseir es Sahl, das Schlösschen der Ebene. Unser Ziel waren Gebäude am westlichen Ende, Khureibat es Suq. Das erste, zu dem wir kamen, war klein (41 mal 39 Fuß und 8 Zoll, die größte Ausdehnung in Ost-West-Richtung) und halb im Boden versunken. Zwei Sarkophage davor ließen vermuten, dass es ehemals ein Mausoleum war. In der Westwand war ein Rundbogentor, der Bogen von einem flachen Relief verziert. In Höhe des Bogens verjüngten sich die Mauern um die Breite eines kleinen Rücksprungs, zwei Steinlagen höher umlief eine geschweifte Kranzleiste das Gebäude. Einige hundert Meter westlich des Kasr oder Schlosses (die Araber nennen die meisten Ruinen Schloss oder Kloster) stand die Ruine eines Tempels. Er war im Laufe der Zeit offenbar für andere Zwecke benutzt worden als für den, für den er ursprünglich gebaut worden war, denn die beiden Reihen von sieben Säulen waren von Mauerresten umgeben und am westlichen Ende der Kolonnaden gab es unerklärliche Querwände. Dahinter scheint ein doppelter Hof gelegen zu haben, noch weiter westlich lag ein ganzer Komplex zerfallener Grundmauern. Das Tor ging nach Osten, die Pfeiler trugen feine Steinmeißelungen: ein Band, eine Palmette, ein zweites glattes Band, ein Torus mit Weinranke, Perlschnur, Eierstab, auf der oberen Zierleiste schließlich eine zweite Palmette. Das Ganze erinnerte stark an Arbeiten in Palmyra – mit den Reliefs der Fassade von Mschatta konnte das allerdings nicht konkurrieren, auch war der Gesamteindruck nüchterner und den klassischen Vorbildern enger verwandt als es dort der Fall ist. Nördlich des Tempels, etwas erhoben, erwies sich eine weitere Ruine als ein zweites Mausoleum. Ein längliches Rechteck, aus großen Steinen sorgfältig und ohne Mörtel erbaut. Eine Treppe an der Südostseite führte in eine Art Vorraum hinab, er lag aufgrund des abfallenden Hügels an der Ostseite mit dem Erdboden auf gleicher Höhe. An der Außenwand des Vorraums standen Säulenstümpfe, vermutlich Überreste einer kleinen Kolonnade, die die Ostfassade schmückte. Längs der noch vorhandenen Mauern standen sechs Sarkophage, je zwei nach Norden, Süden und Westen. Unter den Säulenschäften lief beiderseits der Treppe ein Fries, er bestand aus einem kühnen Torus zwischen zwei Leisten, dieses Motiv zierte auch das Innere der Sarkophage. Die Stützmauer auf der Südseite zeigte zwei Vorsprünge, im Übrigen war das Bauwerk ganz schlicht, einige der im Gras liegenden Fragmente trugen allerdings ein fließendes Weinrankenmuster. Dieses Mausoleum erinnerte an eine in Nordsyrien verbreitet Art des Pyramidengrabs; ich kann mich nicht erinnern, so weit südlich schon einmal eines gesehen zu haben. Vielleicht ähnelte es einmal jenem wunderbaren Grabmonument mit säulenbestandener Vorhalle, das eines der Höhepunkte von Dana-Süd ist, die Weinranken-Fragmente waren vielleicht Teil des Gebälks.
Als ich kurz vor Sonnenuntergang zu meinen Zelten zurückkam, erfuhr ich, dass der Junge, den wir am Morgen losgeschickt hatten, auf dem Weg getrödelt hatte und, erschrocken über die vorgerückte Stunde, unverrichteter Dinge umgekehrt war. Das war ärgerlich genug, aber nichts im Vergleich dazu, wie sich das Wetter am folgenden Tag aufführte. Beim Erwachen stellte ich fest, dass die Ebene völlig in Nebel und Regen verschwunden war. Der Wind fegte uns den ganzen Tag von Süden entgegen, Sturm zerrte an unseren Zelten. Am Abend kam Namrud mit der Neuigkeit, dass Gäste in seine Höhle eingefallen seien. Ein oder zwei Meilen entfernt von uns standen Zelte der Sukhur, (der überwiegende Teil des Stammes befand sich noch weit im Osten, wo die Winter milder sind), und der heftige Regen war den männlichen Bewohnern zu viel geworden. Sie waren auf ihre Pferde gestiegen und nach Tneib geritten, Frauen und Kinder hatten sie allein zurückgelassen, sie mussten zusehen, wie sie durch die Nacht kamen. Ein wenig Gesellschaft nach diesem langen, nassen Tag schien verlockend, also schloss ich mich ihnen an.
Namruds Höhle läuft tief in den Berg hinein, so tief, dass sie möglicherweise bis in die Mitte des Tneib-Berges reicht. Der erste große Raum ist offenbar eine natürliche Höhle, nur die niedrigen Schlafplätze und die Futtertröge für das Vieh sind in den Fels gehauen. Ebenfalls in den Fels gehauen ist eine Öffnung, die in einen kleineren Raum führt, hinter dem, wie man mir versicherte, weitere liegen. Ich habe sie nicht in Augenschein genommen, die heiße, stickige Luft und die dichten Fliegenschwärme hielten mich von weiteren Erkundungen ab. Das wilde und ursprüngliche Bild, das die Höhle an jenem Abend bot, hätte selbst das abenteuerlustigste Gemüt zufrieden gestellt. In der Mitte der Höhle saßen zehn, zwölf Männer in regennassen, gestreiften Gewändern und roten Lederstiefeln um ein Reisigfeuer, in dessen Glut drei Kaffeetöpfe standen, unverzichtbar für jede Wüsten-Geselligkeit. Hinter ihnen kochte eine Frau Reis auf einem helleren Feuer, das ein Flackern auf die hintere Höhlenwand warf und Namruds Vieh beschien, das aus den Felskrippen gehäckseltes Stroh fraß. Man räumte mir im Kreis einen nahezu schlammfreien Platz ein und reichte mir eine Tasse Kaffee, dann ging das Gespräch weiter, es dauert so lange, wie ein Mann braucht, um fünf Mal seine arabische Pfeife zu rauchen. Es ging vor allem um die Missetaten der Regierung, denn der Arm des Gesetzes, besser gesagt: die gepanzerte Faust einer unfähigen Regierung, ist für die Wüstenränder eine ständige Bedrohung. Die war in diesem Jahr noch größer geworden, weil die Erfordernisse des Krieges zu einigen furchtbaren Maßnahmen geführt hatten.
Ohne Aussicht auf eine Entschädigung finanzieller oder sonstiger Art waren entlang der Grenzen Kamele und Pferde in großer Zahl requiriert worden. Die Araber hatten all ihre verbliebenen Tiere versammelt und fünf oder sechs Tagesreisen weit nach Osten getrieben, wohin die Soldaten nicht vorzudringen wagten, Namrud war dem Beispiel gefolgt und hatte nur das Vieh behalten, das er zum Pflügen brauchte. Ein Gast nach dem anderen ergriff das Wort, ihr hartes, gutturales Arabisch hallte von den Höhlenwänden wider. Bei Gott und Mohammed, seinem Propheten, ließen wir Verwünschungen auf die tscherkessische Kavallerie niederprasseln, auf dass die kräftigen Reiter in ihren Sätteln taumeln mögen! Hin und wieder neigte sich ein turbanumwickelter Kopf, dem die schwarzen, verfilzten Locken unter dem gestreiften Tuch um die Augen hingen, nach einem glimmenden Zweiglein für seine Pfeife, eine Hand streckte sich nach den Kaffeetassen, das Kochfeuer flammte unter frisch aufgelegtem Reisig auf, die plötzliche Helligkeit ließ die Fliegen summen und das Vieh unruhig werden. Namrud war nicht sehr erfreut darüber, dass sein gerade gesammeltes Feuerholz so rasch abnahm und seine Kaffeebohnen händeweise in den Mörser wanderten. (»Wallah! sie essen wenig, wenn es vom eigenen geht, aber viel, wenn sie Gäste sind, sie und ihre Pferde. Dabei ist das Korn in diesem Jahr knapp.«) Aber zwischen Jordan und Euphrat ist das Wort ›Gast‹ heilig, und Namrud wusste sehr wohl, dass er seine Stellung und seine Sicherheit weitgehend einer Gastfreundlichkeit verdankte, die er allen Besuchern gewährte, so ungelegen sie sein mochten. Ich trug meinen Teil zur Geselligkeit bei, indem ich ein Kistchen Zigaretten verteilte. Als ich aufbrach, war zwischen den Männern der Beni Sakhr und mir ein gegenseitiges Wohlwollen entstanden.
Der folgende Tag war kaum vielversprechender als der vorherige. Die Maultiertreiber waren entschieden dagegen, die schützenden Höhlen zu verlassen und ihre Tiere in der offenen Wüste einem solchen Regen auszusetzen. Also willigte ich widerwillig ein, die Abreise zu verschieben, schickte sie nach Madeba, drei Stunden entfernt, um Hafer für die Pferde zu kaufen, schärfte ihnen aber ein, keinesfalls zu sagen, woher sie kamen. Am Nachmittag klarte es etwas auf, und ich ritt Richtung Süden nach Kastal, einem befestigten römischen Lager, das auf einem Hügel liegt.
Diese Art Fort war an den Ostgrenzen des Reichs nicht ungewöhnlich, die Ghassanids bauten es auf die gleiche Weise nach, als sie die syrische Wüste besiedelten; es wird ja vermutet, dass Mschatta nur ein besonders schönes Beispiel für diesen Gebäudetypus ist. Kastal hat eine starke Befestigungsmauer, die nur von einem Tor im Osten sowie an den Ecken und Seiten von runden Bastionen durchbrochen ist. Im Inneren bilden parallellaufende Gewölbekammern einen Hof, der ganze Grundriss entspricht, leicht abgewandelt, dem von Kala’et el Beida in der Safa, aber auch der modernen Karawansereien.1 Im Norden liegt ein einzelnes Gebäude, vermutlich das Prätorium, die Wohnung des Festungskommandanten. Es besteht aus einer riesigen Gewölbekammer, die auf einen ummauerten Hof geht, an der Südwestecke steht ein Rundturm mit einer Wendeltreppe im Inneren. Das Turmäußere ist mit einem Fries geschmückt, der oben Laubwerk, unten gekehlte Triglyphen und dazwischen schmale leere Metopen zeigt. Die Mauerarbeit ist ungewöhnlich gut, die Wände sehr dick; angesichts solcher Verteidigungsanlagen, die es noch im letzten Winkel des Reiches gab, konnten die Einwohner Roms ruhig schlafen.
Als ich vor fünf Jahren nach Kastal kam, war es unbewohnt, das Land rundum aber nicht bestellt. Jetzt waren Fellachenfamilien in die zerfallenen Gewölbe eingezogen, und auf den ebenen Flächen unterhalb der Festung spross Getreide. Solche Veränderungen wärmen fraglos das Herz des Menschenfreundes, das des Archäologen lassen sie eisig erschauern. Nichts vernichtet so gründlich wie die Pflugschar, nichts zerstört so schnell wie der Bauer, der behauene Steine für seine Hütte sucht. Als weiteres Anzeichen der nahenden Zivilisation fielen mir zwei halb verhungerte Soldaten auf, Wächter der nahen Haltestelle der Hedschasbahn, die man, nach den wenigen Meilen davon entfernt im Osten liegenden Ruinen, mit dem Namen Mschatta geadelt hatte. Der Grund ihres Besuches war das magere Huhn, das einer der beiden in Händen hielt. Er hatte es den noch dünneren Gefährten im Festungshof entrissen, nach den Umständen fragt man besser nicht, Hunger kennt kein Gesetz. Mir war nicht daran gelegen, dass meine Anwesenheit in dieser Grenzregion den Behörden in Amman zu Ohren kam, daher brach ich recht rasch auf und ritt ostwärts nach Jiza weiter (oder Ziza, wie manche es nennen).
Die Regengüsse hatten die Wasserläufe der Wüste gefüllt, sie sind selten so tief und reißend wie der, den wir an jenem Nachmittag durchqueren mussten. Der Regen hatte auch das große römische Wasserbecken von Jiza bis zum Rand gefüllt, die Sukhur würden dort den ganzen kommenden Sommer Wasser vorfinden. Hier gab es viel mehr Ruinen als in Kastal, die Fundamente erstreckten sich über ein großes Areal, das muss eine große Stadt gewesen sein. Vielleicht war Kastal die Festung, die sie schützte, immerhin teilen Festung und Stadt den Namen Ziza, der in der Notitia erwähnt wird: »Equites Dalmatici Illyriciana Ziza«.
Es gibt hier auch ein sarazenisches Kal’ah, eine Festung, die Soktan, ein Scheich der Sukhur, wie Namrud berichtete, wiederherstellte und mit einer für die Wüste ganz unbekannten Pracht ausstatten ließ. Dann war sie allerdings an den Sultan gegangen, weil sie auf dem Land steht, das er sich für seinen Landsitz ausgesucht hatte. Seither verfällt sie. Die Hänge dahinter sind voller Fundamente, darunter eine Moschee, deren Mihrab auch noch weit im Süden zu erkennen war. Zu Ibrahim Pashas Zeiten war Jiza ägyptische Garnison, es waren im Wesentlichen seine Soldaten, die die Zerstörung der antiken Bauten vollends übernahmen. Bevor sie kamen, berichteten die Araber, waren viele Gebäude, darunter christliche Kirchen, noch vollständig erhalten. Auf dem Rückweg folgten wir dem Eisenbahndamm und sprachen über die möglichen Vorteile, die dem Land aus der Eisenbahnlinie erwachsen könnten. Namrud äußerte Zweifel. Beamten und Soldaten misstraute er samt und sonders. Tatsächlich hatte er guten Grund, diese offiziellen Räuber zu fürchten. Deren Raubgier konnte er nicht durch seine Gastfreundschaft mildern, die Araber hingegen hatte er sich auf vielfache Weise zu sehr verpflichtet, als dass sie ihm ernstlich hätten schaden wollen. Im Jahr zuvor hatte er einige Wagenladungen Getreide mit der Bahn nach Damaskus geschickt. Ja, ein solcher Transport war einfacher und auch schneller als mit Kamelen, sofern die Waren ankamen; für gewöhnlich aber waren die Säcke bei ihrer Ankunft in der Stadt so viel leichter als beim Aufladen, dass jeder Gewinn dahin war. Vielleicht würde das ja einmal besser werden – wenn auch die Lampen, Polster und all die anderen Einrichtungsgegenstände der Wüsten-Bahn, von den nackten Bänken abgesehen, an dem Platz blieben, für den sie angefertigt und gekauft worden waren.
Wir sprachen auch über Aberglauben und Ängste, die das Herz des Nachts befallen. Es gibt Orte, sagte er, die jeder Araber nach Einbruch der Dunkelheit meide – verhexte Brunnen, denen sich kein Durstiger zu nähern wagt, Ruinen, wo kein Müder Schutz suchen würde, Senken, die für den allein Reisenden kein guter Lagerplatz sind. Was fürchteten sie? Jinneh! Nun, wer wusste schon zu sagen, was der Mensch fürchtet? Er selbst hatte einmal einen Araber fast zu Tode erschreckt, als er im schwachen Licht der Morgendämmerung völlig nackt vor ihm aus einem Tümpel stieg. Der Mann rannte zu seinen Zelten und schwor, einen Jinn gesehen zu haben, man dürfe die Tiere nicht zum Wasser hinunter lassen, denn dort hause er. Daran hielt er fest, bis Namrud kam, lachte und die Geschichte aufklärte.
Wir kehrten nicht direkt ins Lager zurück. Für diesen Abend hatte mich Scheich Nahar von den Beni Sakhr zum Abendessen eingeladen, das war der Scheich, der am Vorabend in Namruds Höhle gewesen war; wir besprachen das lange und entschieden schließlich, dass es mich nicht kompromittieren würde, die Einladung anzunehmen.
»Grundsätzlich gesprochen«, erläuterte Namrud, »solltet Ihr aber immer nur die Zelte bedeutender Scheiche besuchen. Sonst fallt Ihr Leuten in die Hände, die Euch nur wegen Eurer Gastgeschenke einladen. Nahar – nun ja, er ist ein ehrlicher Mann, wenn auch ein Meskin …«, diese Bezeichnung deckt alle Formen leiser Verachtung ab, ob ehrbare Armut, Schwachsinn oder erste Anzeichen einer gewissen Lasterhaftigkeit.
Der Meskin empfing mich würdevoll wie ein Fürst und geleitete mich zu dem Ehrenplatz auf dem zerschlissenen Teppich, er lag zwischen dem viereckigen Loch im Boden, das als Kochstelle dient, und der Abtrennung zwischen Männer- und Frauenbereich. Wir hatten unsere Pferde an eines der langen Zelttaue gebunden, die diesen leichten Behausungen eine solch bewundernswerte Stabilität verleihen, der Blick schweifte von der Stelle, wo wir saßen, gen Osten über die weite Hügellandschaft – die sich in Wellen hob und senkte, als atme die Wüste in der hereinfallenden Nacht leise ein und aus. Die windabgewandte Seite eines arabischen Zeltes steht immer offen, damit Luft hereinkommt, dreht der Wind, nehmen die Frauen die Zeltwand herunter und bringen sie an anderer Stelle wieder an, so bekommt das Haus binnen weniger Augenblicke eine andere Blickrichtung und wendet sich vergnügt der besseren Aussicht zu. Es ist so klein, so zart und dabei so fest verankert, dass die Stürme ihm wenig anhaben können; das dichte Gewebe der Ziegenfell-Planen quillt bei Feuchtigkeit auf und wird dicht, erst bei Dauerregen mit Sturm sickern kalte Rinnsale in die Behausung.
Die Kaffeebohnen waren geröstet und gemahlen, die Kaffeetöpfe simmerten in der Glut, da kamen aus dem Osten drei Reiter und machten am offenen Zelt Halt. Es waren untersetzte, breitschultrige Männer, die Gesichtszüge auffallend unregelmäßig, die Zähne standen vor, sie froren und waren regendurchnässt. Man machte ihnen im Kreis um das Feuer Platz, sie streckten die Hände in die Wärme, die Unterhaltung wurde ohne Unterbrechung geführt, denn es waren nur Männer der Sherarat, die heruntergekommen waren, um in Moab Korn zu kaufen. Die Sherarats sind zwar einer der größten und mächtigsten Stämme und die berühmtesten Kamelzüchter, aber sie haben schlechtes Blut, kein Araber aus der Belka würde sich durch Heirat mit ihnen verbinden. Sie haben keine festen Weideplätze, selbst während der Sommerdürre ziehen sie durch die innere Wüste, dabei ist es ihnen gleichgültig, wenn sie mehrere Tage hintereinander kein Wasser haben. Das Gespräch an Nahars Feuer drehte sich um meine Reise. Ein Neger der Sukhur, ein gewaltiger Mann mit klugem Gesicht, wollte mich gern als Führer ins Drusengebirge begleiten, räumte aber ein, dass er umdrehen und fliehen müsse, sobald er das Gebiet dieser tapferen Bergbewohner erreicht habe, die Drusen und die Beni Sakhr lagen immer im Streit miteinander. Die Negersklaven der Sukhur werden von ihren Herren gut behandelt, denn die kennen ihren Wert, und sie genießen in der Wüste einen guten Ruf, weil etwas vom Glanz des großen Stammes, dem sie dienen, auch auf sie fällt. Ich war halb geneigt, sein Angebot zu akzeptieren, auch wenn das bedeutet hätte, dass ich mich beim ersten Drusendorf eventuell um einen toten Neger würde kümmern müssen, als meine Überlegungen durch die Ankunft eines weiteren Gastes unterbrochen wurden. Es war ein junger Mann, hoch gewachsen, mit schönem, zarten Gesicht, der Teint fast weiß, die langen Locken fast braun. Als er sich näherte, erhoben sich Nahar und die anderen Scheiche der Sukhur, um ihn zu begrüßen, bevor er das Zelt betrat, küsste ihn jeder auf beide Wangen. Auch Namrud stand auf und rief ihm entgegen:
»Alles gut? Gebe es Gott! Wer ist bei dir?«
Der junge Mann hob die Hand und sagte:
»Gott.«
Er war allein.
Ohne der übrigen Gesellschaft größere Beachtung zu schenken, musterte er kurz die drei Scheiche der Sherarat, die am Eingang saßen, wo sie Hammel und Joghurt aßen, sowie die fremde Frau am Feuer, dann ging er mit einer gemurmelten Begrüßung in den hinteren Bereich des Zeltes. Nahars Frage, ob er essen möchte, verneinte er. Der junge Mann war Gablan, er stammte aus der Herrscherfamilie der Da’ja und war ein Verwandter des regierenden Scheichs. Er hatte, wie ich später erfuhr, gehört, dass Namrud für einen Fremden einen Führer brauchte, Neuigkeiten reisen in der Wüste schnell, und war gekommen, um mich zum Zelt seines Onkels zu bringen. Keine fünf Minuten nach seiner Ankunft flüsterte Nahar Namrud etwas zu, daraufhin neigte dieser sich zu mir und sagte, da wir bereits gegessen hätten, sollten wir jetzt zusammen mit Gablan aufbrechen. Es überraschte mich, dass diese Abendgesellschaft ein so jähes Ende nehmen sollte, war aber klug genug, nicht zu widersprechen, und als wir über Namruds Felder und die Hügel von Tneib galoppierten, erfuhr ich den Grund. Die Da’ja und die Sherarat waren auf den Tod verfeindet. Gablan hatte mit einem Blick die Herkunft der anderen Gäste erkannt und sich schweigend in die Tiefen des Zeltes zurückgezogen. Er würde unter keinen Umständen vom selben Hammelgericht essen wie sie. Nahar erkannte (wer hätte das nicht?), wie heikel die Situation war, wusste aber nicht, wie die Männer der Sherarat sie deuteten. Und so hatte er uns, aus Angst vor einem Unglück, fortgeschickt. Am folgenden Morgen hatte sich die Atmosphäre (metaphorisch, nicht buchstäblich) geklärt, aufgrund des strömenden Regens saßen die Todfeinde den ganzen Tag in der Höhle, friedlich um Namruds Kaffeetopf versammelt.
Der dritte Regentag war mehr, als die menschliche Geduld ertragen konnte. Ich hatte bereits vergessen, was es hieß, nicht klamm zu sein, warme Füße und trockenes Bettzeug zu haben. Gablan war am Morgen eine Stunde lang bei mir, um zu erfahren, was ich von ihm erhoffte. Ich erklärte, dass ich mir nichts anderes wünschte, als dass er mich durch die Wüste führen und zum Fuß der Berge bringen werde, ohne dass ich einen Militärposten zu Gesicht bekam. Gablan dachte einen Augenblick lang nach.
»Verehrte Lady« sagte er dann, »glaubt Ihr, Ihr werdet mit Soldaten in Konflikt geraten? Denn dann nehme ich mein Gewehr mit.«
Ich antwortete, dass es nicht meine Absicht sei, der gesamten Kavallerie des Sultans den offenen Krieg zu erklären, sondern vielmehr hoffte, ein solches Zusammentreffen mit etwas Vorsicht vermeiden zu können. Aber Gablan war der Ansicht, eine Kugel beflügelte jedes Vorhaben und beschloss, das Gewehr aufjeden Fall mitzunehmen.
Da ich am Nachmittag nichts anderes zu tun hatte, sah ich zu, wie die Sherarat von Namrud Korn kauften. Sah man davon ab, dass ich gar nicht dorthin passte, und dass seither mehrere tausend Jahre vergangen waren, dann hätten diese Männer auch die Söhne Jakobs sein können, die nach Ägypten gekommen waren, um sich mit ihrem Bruder Joseph über das Gewicht eines Sacks Getreide zu zanken. Das Getreide lagerte in einer trockenen, in den Fels gehauenen Zisterne, aus der es, wie Wasser, in goldgelb gefüllten Eimern heraufgezogen wurde. Zur besseren Konservierung wurde es mit der Spreu aufbewahrt, daher musste es als erstes am Beckenrand gesiebt werden, was nicht ohne wortreiche und zornige Diskussionen ablief. Nicht einmal die Kamele waren still, sobald die Araber sie mit den vollen Säcken beluden, beteiligten sie sich mit Grunzen und Blöken am Streit. Die Scheiche der Sukhur und der Sherarat saßen im Nieselregen auf Steinen, murmelten, »Gott! Gott!«, riefen »Er ist gnädig und barmherzig!« Nicht selten wurde gesiebtes in ungesiebtes Korn zurück geschüttet, dann entstand eine Szene wie die folgende:
Namrud: »O nein! O nein! Unglückseliger Knabe! Möge dein Haus zu Staub zerfallen! Möge das Unglück dich heimsuchen!«
Beni Sakhr: »Beim Angesichte aller Propheten Gottes! Gelobt sei sein Name!«
Sherarat (in gedämpftem Chor): »Bei Gott! und bei Mohammed, seinem Propheten! Friede sei mit ihm!«
Eine barfüßige, in Schaffelle gehüllte Person: »Kalt, o je so kalt! Wallah! Regen und kalt!«
Namrud: »Schweige, Bruder! steig ins Becken hinunter und zieh das Getreide hoch. Dort ist es warm.«
Beni Sakhr: »Gelobet sei Gott der Allmächtige!«
Chor der Kamele: »B-b-b-b-b-b-dd-Gru-u-u-u-nzzz.«
Kameltreiber: »Seid still, Verfluchte! möget ihr im Schlamm stürzen! Möge Gottes Zorn auf euch herabregnen!«
Sukhur (alle zusammen): »Gott! Gott! Beim Lichte seines Angesichts!«
In der Abenddämmerung ging ich zum Zelt meiner Leute. Dort fand ich Namrud vor, er zischte Mordpläne in das Feuer, auf dem mein Abendessen köchelte.
»Als ich noch jung war«, sagte er (das war nicht lange her), »konnte man den Ghor nicht in Frieden durchqueren. Aber ich hatte ein Pferd – Wallah! was konnte das Pferd laufen! Es brachte mich zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang von Mezerib nach Salt, immer im gleichen Schritt. Und ich war mit den Ghawarny (den Bewohnern des Ghor) gut bekannt. Einmal musste ich im Sommer nach Jerusalem – ich hatte keine Wahl! Ich musste also reiten. Der Jordan war niedrig, ich ging durch eine Furt, damals gab es noch keine Brücken. Als ich am anderen Ufer war, hörte ich Schreie und das Pfeifen von Kugeln. Ich versteckte mich über eine Stunde lang in den Tamariskenbüschen, erst als der Mond tief stand, ritt ich leise weiter. Aber da, wo die Erdharzgruben anfangen, scheute mein Pferd, ich blickte zu Boden, auf dem Pfad lag ein Mann, nackt und von Messerstichen übersät. Er war sehr, sehr tot. Und wie ich so auf ihn hinab sehe, preschen sie aus den Erdharzgruben auf mich zu, zehn Reiter, und ich allein. Ich flüchte in das Dickicht und feure meine Pistole ab, zwei Mal, aber sie umringen mich, werfen mich vom Pferd, fesseln mich, dann setzen sie mich wieder aufs Pferd und führen mich fort. Und als sie an ihrem Rastplatz ankommen, beraten sie, ob sie mich jetzt töten sollen, und einer sagt: ›Wallah! machen wir ein Ende.‹ Er kommt näher und sieht mir ins Gesicht, es dämmerte schon. Und er sagt: ›Das ist Namrud!‹.
Er kannte mich, ich war ihm einmal zu Hilfe gekommen. Da banden sie mich los und ließen mich gehen, und ich ritt nach Jerusalem.«
Eine Geschichte folgte der anderen, die Maultiertreiber und ich lauschten mit atemloser Spannung.
»Die Araber haben gute Sitten und schlechte Sitten«, sagte Namrud, »aber es gibt viele gute. Wenn sie zum Beispiel eine Blutfehde beenden wollen, kommen die Feinde im Zelt dessen zusammen, dem Unrecht zugefügt wurde. Der Herr des Zeltes zieht sein Schwert, wendet sich nach Süden und malt einen Kreis in den Sand, dabei ruft er Gott an. Dann nimmt er einen Streifen von der Zeltwand und etwas Asche aus dem Herd, wirft alles in den Kreis und tippt sieben Mal mit seinem Schwert auf den Strich. Der Täter springt in den Kreis und ein Verwandter seines Feindes ruft laut: ›Ich nehme den Mord, den er begangen hat, auf mich!‹ So ist der Frieden wieder hergestellt.
Werte Dame! die Frauen haben viel Macht im Stamm, und die jungen Mädchen sind sehr geachtet. Wenn ein junges Mädchen sagt: ›Ich will den und den zum Gatten‹, dann muss er sie heiraten, sonst fiele Schande auf sie. Und wenn er schon vier Ehefrauen hat, muss er sich von einer trennen und statt ihrer das Mädchen heiraten, das ihn erwählt hat. So ist es Sitte bei den Arabern.«
Dann sah er meinen drusischen Maultiertreiber an und sagte:
»Muhammad! Mich plagt eine Sorge. Die Zelte der Sukhur sind nah, und zwischen den Beni Sakhr und den Drusen hat es noch nie Frieden gegeben. Wenn sie von dir wüssten, würden sie dich töten, sie würden dich nicht nur töten, sie würden dich bei lebendigem Leibe verbrennen. Weder die Lady noch ich könnten dich schützen.«
Das warf ein düsteres Licht auf den Charakter meines Freundes Nahar, der mir als Zeichen der Gastfreundschaft einst ein Tuch geschenkt hatte. Die kleine Schar am Feuer schaute erschrocken, aber Mikhail war der Lage gewachsen.
»Das soll Eure Exzellenz nicht bekümmern«, sagte er und servierte ein Gemüsegericht. »Bis wir das Djebel el-Druz erreicht haben, ist er Christ, und so lange heißt er nicht Muhammad, sondern Tarif, denn das ist ein Name, wie ihn die Christen tragen.«
So hatten wir den verblüfften Muhammad bekehrt und getauft, noch bevor die Rippchen aus der Pfanne auf den Teller kamen.
1Brünnow und Domaszewski haben in Bd. II ihres großartigen Werkes »Die Provincia Arabia« bewundernswerte Grundrisse und Fotographien der Festung veröffentlicht. Als ich Kastal besuchte, war dieser Band noch nicht erschienen.