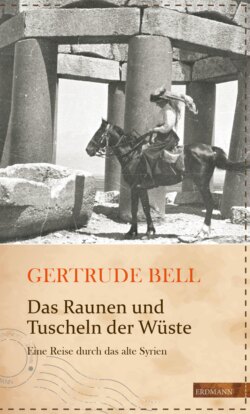Читать книгу Das Raunen und Tuscheln der Wüste - Bell Gertrude Lowthian - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EINLEITUNG
Оглавление»Engländerinnen sind sonderbar.
Es gibt auf der Welt vermutlich
keine größeren Sklaven der Konventionalität als sie,
aber wenn sie mit ihr brechen, dann ganz und gar.«
The New York Times (in einem Artikel über Gertrude Bell)
Gertrude Bell, heißt es, sei eine für ihre Zeit überaus ungewöhnliche Frau gewesen. Das ist nicht ganz zutreffend: Gertrude Bell war ein überaus ungewöhnlicher Mensch – und das wäre sie auch heute noch.
Sie war aus dem Stoff, aus dem man im Europa des 19. Jahrhunderts Abenteurer und Forscher machte: hochintelligent, wissensdurstig, draufgängerisch, furchtlos, zielbewusst, ehrgeizig, energisch, selbstsicher und sehr wohlhabend. Außerdem, und das ist nicht gering zu schätzen, hatte sie eine eiserne Kondition. Aber sie war eben auch eine Frau. Das machte ihre Zeitgenossen im viktorianischen England ratlos und führte zu Bemerkungen wie der, sie sei »eine bemerkenswert kluge Frau mit dem Verstand eines Mannes«. Es ist nicht sicher, ob das als Kompliment gemeint war.
Als sie 1868 in eine der reichsten und fortschrittlichsten Familien Englands hineingeboren wurde, schien ihr Lebensweg als höhere Tochter vorgezeichnet: Eine nicht allzu anspruchsvolle Schulbildung, eine standesgemäße Heirat, dann Kinder, Wohltätigkeitsveranstaltungen, Enkel. Bald aber zeigte sich, dass Gertrude kein fügsames Mädchen war, sondern wild, sportlich, kratzbürstig und sehr wissbegierig. Da ihre Eltern sehr modern dachten, durfte sie, gegen die damaligen Gepflogenheiten, mit fünfzehn Jahren das Mädchen vorbehaltene Queen’s College in London besuchen. In Briefen nach Hause beschwerte sie sich, dass sie nicht allein ins Museum gehen dürfe (»Wäre ich ein Junge, ginge ich jede Woche«), und ihre Zeit mit albernen Handarbeits- und Klavierstunden vertue, wo es doch so viel Wichtiges zu lesen und lernen gebe.
Sie wollte, wie sie ihrem Vater schrieb, »wenigstens eine Sache von Grund auf wissen und können. Dieses dilettantische Lernen bin ich leid. Ich möchte mich ganz in etwas vertiefen.« Und so begann sie als Siebzehnjährige in Oxford zu studieren, das Frauen in den Vorlesungen nur als Gasthörerinnen duldete und ihnen keine akademischen Grade verlieh. Dennoch schloss sie das Studium der Neueren Geschichte in zwei statt drei Jahren ab und das als erste Frau in Oxfords Geschichte mit der höchsten Auszeichnung. Sie sollte in ihrem Leben noch oft »die erste« oder »die einzige Frau« sein, schließlich wurde sie sogar zur mächtigsten Frau ihrer Zeit.
Es ist vielleicht verständlich, dass ein Ausnahmetalent wie sie andere Frauen »uninteressant« fand, und auf die »netten kleinen Ehefrauen« herabsah. Ab 1908 kämpfte sie aktiv gegen das Frauenwahlrecht, weil sie meinte, dass Frauen nicht politisch denken können, und die Suffragetten in der Wahl ihrer Kampfmittel vulgär fand. Der eigentliche Grund dieser Gegnerschaft war allerdings, dass sie den Standpunkt und die Privilegien ihrer eigenen Klasse vertrat: Damals durften in England nur reiche Männer wählen, darum hätte das Wahlrecht für Frauen auch allen besitzlosen Männern das Wahlrecht beschert.
Nach dem Examen in Oxford war es das Wichtigste für die Zwanzigjährige, einen standesgemäßen Ehemann zu finden. Doch all ihre Vorteile – sie hatte grüne Augen und rotblondes Haar, war elegant und lebhaft, konnte schwimmen, fechten, rudern, spielte Tennis und Hockey –, wogen einen gravierenden Makel nicht auf: Sie galt als »Oxfordy«, also zu gebildet und zu selbstbewusst, ja überheblich. Das verdarb sie so gründlich für den Heiratsmarkt, dass selbst ihre große Mitgift nichts auszurichten vermochte. Keiner hielt um ihre Hand an, es sollte nicht erstaunen, wenn sie möglichen Kandidaten deutlich gezeigt hätte, wie langweilig sie sie fand.
Unmittelbar nach dem Abschluss in Oxford reiste sie in Begleitung einer Verwandten nach Bukarest, wo ein Onkel Botschafter war, und besuchte von dort aus Konstantinopel. Reisen gefiel ihr offenbar sehr, denn kaum hatte sie drei Londoner Ballsaisons absolviert, ohne sich verlobt zu haben, fuhr sie 1893 nach Teheran, wohin der Onkel inzwischen versetzt worden war. Dort verliebte sie sich in den Diplomaten Henry Cadogan, doch ihre Eltern verboten die Heirat, weil der junge Adlige mittellos, hoch verschuldet und überdies spielsüchtig war. Gegen ihren Vater lehnte Gertrude Bell sich niemals auf, und sie gehorchte auch hier. Das Paar beschloss zu warten, bis Cadogan im diplomatischen Dienst aufgestiegen und eine akzeptable Partie geworden war. Doch kaum ein Jahr später starb er an den Folgen eines Unfalls.
Gertrude war sehr unglücklich nach London zurückgekehrt, aber Teheran hatte sie begeistert. Sie konnte schon so gut Persisch, dass sie die Gedichte des Dichters Hafiz ins Englische übersetzte, und sie schrieb ein Buch über Teheran, Persian Pictures, das 1894 zunächst anonym erschien.
In den folgenden Jahren lernte sie Deutsch und Französisch und beschäftigte sich intensiv mit Archäologie, sie lebte mehrere Monate in Berlin, 1897 und 1902/03 machte sie mehrmonatige Weltreisen, die erste mit ihrem Bruder Maurice, die zweite mit ihrem Bruder Hugo.
1899 begann sie die Erregung der Gefahr zu suchen. Sie wurde eine der bedeutendsten Alpinistinnen ihrer Zeit, die 2633 Meter hohe Gertrudspitze im Berner Oberland ist nach ihr benannt. Ihren ersten Berg, den 3.983 Meter hohen La Meije, bestieg sie in Unterwäsche, weil sie keine Hosen hatte und der bodenlange Wollrock sie zu sehr behinderte. 1901 harrte sie mit ihren beiden Bergführern in einem Schneesturm dreiundfünfzig Stunden angeseilt auf einem Felsvorsprung aus, im August 1904, kurz nach ihrem 36. Geburtstag, bestieg sie das Matterhorn. Danach kletterte sie nur noch gelegentlich.
1899 besuchte sie den deutschen Generalkonsul Friedrich Rosen und seine Frau Nina in Jerusalem. Sie kannte die beiden aus Teheran, wo sie Gertrude für die persische und arabische Kultur, die Wüste und den Orient begeistert hatten. Nun halfen sie ihr, als sie im März 1900 ihre ersten mehrtägigen Ausflüge in die Wüste unternahm – allein, nur von einigen Dienern begleitet. Auf dem Weg wurde sie zweimal von schwer bewaffneten Beduinen bedroht, was sie in ihrem Journal mit dem Satz kommentierte: »Glaube nicht, dass ich je so einen großartigen Tag erlebt habe.«
Sie war der Wüste, ihren Menschen, dem Orient und seiner Geschichte verfallen, und sie begann, Arabisch zu lernen. Vielleicht hatte sie erkannt, dass sich einer wohlhabenden, kühnen und unverheirateten Frau dort Möglichkeiten und Freiheiten boten, die in England undenkbar waren: In London gab es für Unverheiratete wie sie nur die Rolle der netten Tante ihrer Neffen und Nichten. Im Orient hingegen konnte sie so unabhängig und selbstbestimmt leben, wie sie es als Studentin erträumt hatte.
Sie sehnte sich nach einem sinnvollen Lebensinhalt, nach Neuem, nach Wissen und auch nach Gefahr. Wäre sie ein Mann gewesen, hätte sie im Orient forschen und zugleich in London eine Familie haben können, die auf sie wartete. Als Frau war ihr das verwehrt, und einen Beruf gab es für jemanden wie sie nicht. Das bedeutete auch, dass sie ein Leben lang von ihrem Vater finanziell abhängig war.
Bell eignete sich über viele Jahre jenes historische, geographische und archäologische Wissen an, das sie als Frau durch ein reguläres Studium nicht hatte erwerben können. Als sie im Januar 1905 zu ihrer ersten großen Expedition aufbrach, war sie eine ernst zu nehmende Archäologin und Ethnologin.
Auf dieser Reise, die sie in dem vorliegenden Buch beschreibt, durchquerte sie als erste Europäerin allein die syrische Wüste, begleitet von Maultiertreibern, einem Koch, einem oder mehreren Soldaten sowie einem einheimischen Führer. Fünf Monate lang ritt sie auf dem Pferd zu den byzantinischen und römischen Ruinenstätten des alten Syriens bis Konya in Kleinasien, an vielen Orten waren nur wenige Europäer (und nie eine Europäerin) gewesen. Die Reise durch das unwegsame, nicht kartographierte Gelände war nur möglich, weil Rosen sie überzeugt hatte, im Herrensattel zu reiten. Dabei trug sie weite Hosenröcke mit einer Art Schürze, die herabfiel, sobald sie vom Pferd stieg, und die »Hose« verdeckte.
Damals gehörte der gesamte Nahe Osten zum Osmanischen Reich, doch im Vielvölkerstaat gärte es überall. Darum wollten die Türken beispielsweise verhindern, dass Bell das Gebiet der kriegerischen und aufständischen Drusen durchquerte. Sie aber wollte das unbedingt und ignorierte die Anweisungen der osmanischen Verwaltungsbeamten, nicht einmal, nicht zweimal, sondern ständig.
An Bell fasziniert, wie mühelos sie vom Londoner Salon zu Beduinenzelten wechselte, wie offenbar selbstverständlich sie sich mit Scheichs und Bettlern gleichermaßen unterhalten konnte. Getrieben von einer umfassenden Neugier und einer tiefen Achtung vor der Würde des Menschen, begegnete sie jedem, den sie traf, vorbehaltlos und mit echtem Interesse. Furchtlos folgte sie der Einladung Fremder, sie in deren Haus zu begleiten, es scheint, als habe sie damit nur gute Erfahrungen gemacht. Wer sich pompös aufführte, konnte ihrer Verachtung sicher sein – in seiner Gegenwart aber blieb sie immer höflich, immer zuvorkommend, wahrte immer die Sitten.
Grund dafür war auch, dass sie die mächtigen Männer brauchte: Nach dem Gesetz der Wüste waren Frauen unantastbar, dennoch wurde sie auf ihren Reisen mehrfach überfallen und ausgeraubt. Ohne den Schutz der Scheiche, Stammesfürsten oder türkischen Beamten hätte sie sich nicht durch die gefährlichen Landstriche bewegen, manchmal nicht überleben können. Geschickt erwies sie allen ihre Ehrerbietung, Scheiche verschiedener Stämmen nahmen sie gastfreundlich und höflich auf und bewirteten sie. Diese Stämme waren oft auf den Tod verfeindet, doch ihr gelang es, sich aus diesen Rivalitäten völlig herauszuhalten. Sie trank mit allen starken Kaffee, rauchte mit allen schwarze Zigaretten (Bell war zeit ihres Lebens eine starke Raucherin), und war bald der einzige Außenseiter, der diese Stämme nicht nur auseinanderhalten konnte, sondern jeden Fürsten persönlich kannte und wusste, wer mit wem verfeindet, wer mit wem verbündet war. Und je mehr dieser Männer sie persönlich kannte, umso sicherer konnte sie sich bewegen.
Alle Reisen waren anstrengend und entbehrungsreich. Manchmal ritt sie auf einem Pferd oder Kamel zwölf Stunden durch Schneestürme, Wolkenbrüche, sengende Sonne und eisigen Gegenwind, durch Schlammlöcher, über Geröllwüsten, wacklige Brücken und in die Bergwand gehauene Pfade. Widrigkeiten wie Insekten, ungenießbares Wasser oder eintöniges Essen erwähnt sie nur beiläufig, Fragen der Körperhygiene gar nicht, aber man kann sich vorstellen, wie schwierig das in einer reinen Männergesellschaft gewesen sein muss.
Am Ende eines solchen Tages schrieb sie Briefe an ihre Eltern, 1.600 sind erhalten, des Weiteren detaillierte Journaleinträge, die Grundlage ihrer Bücher und wissenschaftlichen Aufsätze waren. Vor allem aber traf sie abends die örtlichen Würdenträger, sei es, dass sie sie in ihrem eigenen Lager empfing, sei es, dass sie sie in deren Zelten oder Häusern besuchte. Sie beschrieb die Begegnungen und Ereignisse ihrer Reisen geistreich, witzig, mitunter spitzzüngig, registrierte mit großer Aufmerksamkeit politische Stimmungen, Machtstrukturen, Allianzen. Und sie vergaß nichts.
Wie bei der Lektüre aller Abenteuerberichte, wundert man sich auch bei Bell darüber, dass sie darauf brannte, diese Härten und Entbehrungen zu wiederholen. Tatsächlich unternahm sie nach 1905 weitere Nahost-Expeditionen, jede ehrgeiziger und gefahrvoller, mit mehr Begleitern und Lasttieren als die vorherige. Seit der zweiten Expedition hatte sie zwei persönliche Zelte, eines zum Schreiben und Empfang der Gäste, das zweite mit ihrem Bett und einer Segeltuch-Wanne – »mein einziger Luxus«. Sie führte neben leinenen Reitröcken, Baumwollblusen und Pelzmänteln auch Abendkleider mit; zwischen Spitzenunterröcken versteckte sie die Gastgeschenke für wichtige Gastgeber: Ferngläser und Pistolen. Selbst bewirtete sie ihre Gäste an Klapptischen, die mit Damast, silbernen Kerzenständern, Kristallgläsern und einem Wedgwood Service gedeckt waren.
Das alles diente keineswegs nur ihrer Bequemlichkeit. Die Mächtigen der Wüste kannten nur Freund oder Feind, eine Frau wie Bell konnten sie nicht einschätzen. Sie sprach fließend Arabisch und brauchte nie einen Dolmetscher, war mit den Sitten des Landes vertraut. Eine große Karawane wie die ihre beeindruckte die Männer, denn sie signalisierte Bedeutung und Wohlstand. Bell trat auf wie eine Königin der Wüste. So wurde sie auch bald genannt: Khatun. Man ging besser vorsichtig mit ihr um, möglicherweise war sie eine mächtige Verbündete.
Sie stellte sich als Frau niemals dümmer als sie war, und kleidete sich immer elegant. Ihren Status als Engländerin nutzte sie strategisch. Einerseits weigerte sie sich, Zelte oder Häuser durch den Eingang der Frauen zu betreten, andererseits hatte sie Zugang zu den Frauengemächern, wo sie auch Klatsch und Informationen hörte, die die arabischen Männer niemals erzählt und europäische Männer niemals gehört hätten. Sie verschleierte sich grundsätzlich nicht, was mitunter zu Schwierigkeiten führte. 1920 schrieb sie aus Bagdad an ihre Mutter: »Bis vor Kurzem waren wir völlig von [den Schiiten] abgeschnitten, denn ihre Glaubenssätze verbieten es, eine unverschleierte Frau anzusehen, und meine Glaubenssätze erlauben es nicht, mich zu verschleiern ... Auch der Versuch, über die Frauen Freundschaft zu schließen, misslingt – wenn sie mich sehen dürften, würden sie sich vor mir verschleiern, als sei ich ein Mann. Wie Du siehst, bin ich für das eine Geschlecht zu weiblich und das andere zu männlich.«
Sie bestand darauf, von den Männern als Ebenbürtige behandelt zu werden, die meisten Araber lösten dieses Dilemma, indem sie Bell zum »Mann ehrenhalber« ernannten. Sie selbst erwähnt selten, dass sie sich als Frau in einer Gesellschaft bewegt, in der Frauen nahezu unsichtbar waren.
Als Frau fiel es ihr auch leichter, als arglose Archäologin aufzutreten, der Politik völlig egal war. Doch schon der Bericht ihrer ersten Expedition zeugt nicht nur von einem umfassenden und fundierten Wissen der Archäologie, Geographie und Geschichte des Nahen Ostens, sondern auch seiner politischen Spannungen und Allianzen. Der plaudernde Ton lässt ihre Texte weniger fundiert erscheinen, als sie es tatsächlich sind, denn ihr Beitrag zur Archäologie des Nahen Ostens ist beträchtlich. Dazu gehört auch, dass sie mit zwei mitgeführten Plattenkameras 7.000 Fotographien machte, die heute als Quelle bedeutsam sind, weil sie den damaligen Erhaltungszustand antiker Stätten dokumentieren.
1909 bereiste sie Mesopotamien (den späteren Irak), 1911 erneut Syrien. Die forderndste Expedition führte 1913/14 auf Kamelen in das sagenumwobene, gefürchtete Ha’il (im heutigen Saudi-Arabien). Zwanzig Jahre lang war kein Europäer mehr dort gewesen, nicht alle früheren Reisenden waren lebend zurückgekehrt. Die 2.500 Kilometer-Strecke durch die Wüste war so gefährlich, dass weder die Osmanen noch die Engländer bereit waren, sie zu schützen. Sie beschloss, auf eigene Gefahr zu reisen, entging dem Tod mehrmals nur knapp und kam auch an die Grenzen ihres Frauseins: »Es ist mühsam, Frau zu sein, wenn man in Arabien ist.« Diese tollkühne Expedition dauerte sechs Monate und war unter Archäologen und Ethnologen bald legendär.
Als sie im Mai 1914 körperlich völlig erschöpft nach England zurückkehrte, brachte sie kostbare Informationen über die Machtverhältnisse in Arabien mit. Dieses Wissen sowie ihre genaue Kenntnis der Clanstrukturen, die sie in den zehn Jahren ihres Reisens zusammengetragen hatte, sollten in den folgenden Jahren den gesamten Nahen Osten prägen.
Auf dieser Reise hatte sie neben dem normalen Journal ein Tagebuch für Richard Doughty-Wylie geführt. Sie war dem britischen Konsul und seiner Frau 1907 in Konya begegnet, doch erst 1912, bei einer erneuten Begegnung, verliebten sie sich ineinander. Sie wechselten leidenschaftliche Briefe, aber mit Rücksicht auf seine Karriere konnte oder wollte er sich nicht scheiden lassen.
Nach vier gemeinsam verbrachten Tagen Ende 1914 schrieb sie ihm: »Ich kann nicht schlafen, ich kann nicht schlafen. Es ist ein Uhr am Sonntagmorgen. Ich habe versucht zu schlafen, mit jeder Nacht wird es unmöglicher. Du, Du, Du stehst zwischen mir und jeder Ruhe; aber fern von Deinen Armen gibt es keine Ruhe. Du nennst mich Leben, Du nennst mich Feuer. Ich entflamme, und ich werde verzehrt.« Auch diese Liebe endete unglücklich. Doughty-Wylie fiel im April 1915 bei der Schlacht von Gallipoli. Bell war 46 Jahre alt. So weit bekannt, hatte sie weder mit ihm noch einem anderen Mann jemals eine sexuelle Beziehung.
Das Osmanische Reich war im Ersten Weltkrieg ein Verbündeter des Deutschen Kaiserreichs und somit ebenfalls Kriegsgegner Großbritanniens und Frankreichs. Diese beiden Staaten hatten starke Interessen in der Gegend, die Engländer wollten neben Syrien auch Mesopotamien – den späteren Irak – kontrollieren, um den Weg nach Indien frei zu halten und den Zugriff auf das persische Öl zu sichern, dessen künftige Bedeutung sie klarer einschätzten als die Franzosen. Es stellten sich zwei Fragen: War es möglich, die deutschen und türkischen Truppen in einen Aufstand der Araber gegen Konstantinopel zu verwickeln und so zu schwächen? Und was würde mit Arabien geschehen, falls das Osmanische Reich zusammenbrach?
England begann 1915 die Möglichkeiten eines arabischen Aufstands zu sondieren und aktiv zu unterstützen. Es dämmerte den Zuständigen schon bald, dass sie Bell als Beraterin brauchten, um die Araber gegen das Osmanische Reich zu einigen. Sie kannte alle wichtigen arabischen Stammesfürsten persönlich, stand mit allen gut. Sie hatte die entlegensten Wüstenregionen bereist, einige der Landkarten stammten von ihr.
1915 wurde sie im Rang eines Majors nach Kairo geschickt, der erste weibliche Offizier im britischen Nachrichtendienst. Dort begann ihre Zusammenarbeit mit dem zwanzig Jahre jüngeren T. E. Lawrence, der zu Lebzeiten als Lawrence of Arabia zum Mythos werden sollte. Als sie sich 1911 bei Grabungen im Süden der Türkei kennenlernten, war Bell schon berühmt; ihr erstes Urteil über ihn lautete: »Ein interessanter Junge. Wird ein Reisender.« Beide waren 1,65 m groß, formidable Reiter, Wüstenfanatiker, die Paradiesvögel unter den Briten in Kairo. Sie wurden Freunde.
Lawrence war Verbindungsmann zu den Aufständischen und entwickelte mit ihnen Taktiken des Angriffs, Bells Aufgabe war es, die einflussreichen Personen des Nahen Ostens dazu zu bewegen, sich dem Aufstand anzuschließen. Eine Frau in ihren Reihen schätzten die Militärs nicht, einer schrieb, offenbar kurz vor dem Herzinfarkt: »Zur Hölle mit dieser aufgeblasenen dummen Quasselstrippe, dieser eingebildeten, überschwänglichen, flachbusigen, mannweibischen, herumzigeunernden, hinternwackelnden, Blödsinn blökenden Ziege.« Aber sie lernten, sie zu respektieren, denn »Miss Gertrude Bell weiß über die Araber und Arabien mehr, als praktisch jeder andere lebende Engländer oder auch Engländerin.«
1917/18 siegte die arabische Rebellion dank massiver britischer Unterstützung; im Herbst 1918 gingen England und Frankreich daran, das osmanische Herrschaftsgebiet unter sich aufzuteilen. Die regionalen Unabhängigkeitsbestrebungen waren zu stark, um die Bildung neuer Kolonien in Betracht ziehen zu können, es mussten andere Lösungen gefunden werden, die den Einfluss von Frankreich und England nicht gefährdeten.
Im Rahmen dieser Umwälzungen zog Bell 1917 nach Bagdad, ihre Lieblingsstadt; hier lebte sie zum ersten Mal in ihrem Leben in einem eigenen Haus, legte einen Garten an, umgab sich mit Tieren. Sie beriet die englische Regierung bei der Gründung des Iraks, verhandelte mit den Stammesfürsten, empfahl mögliche Regierungsmitglieder, baute Faisal zum irakischen König auf. Und sie skizzierte den Grenzverlauf des neuen Staates. Winston Churchill, damals Kolonialminister, berief 1920 in Kairo eine Konferenz ein, bei der England diese und weitere Details des künftigen irakischen Staatsgebildes festlegte. Bell war auch hier wieder die einzige Frau, ein berühmtes Foto zeigt die Konferenz-Teilnehmer auf Kamelen vor der Sphinx, Bell zwischen Churchill und Lawrence.
Mit dem Abstand von einem Jahrhundert fallen in Bells Büchern, Briefen und Journalen zwei Dinge auf: Ihr idealisiert-romantisches Bild vom Beduinen als edlem Wüstenkrieger, und ihre Überzeugung, dass Englands Regierungsform allen anderen weit überlegen und somit für alle Völker dieser Erde erstrebenswert sei. Bell und Lawrence teilten diese Ansichten, sie wollten eine arabische Unabhängigkeit bei unbedingter Sicherung der englischen Hegemonie. Weil die Briten die kurdische Provinz Mossul als Puffer gegen die Türkei und Russland brauchten, zwangen die Beschlüsse von Kairo die ehemaligen osmanischen Provinzen Bagdad, Mossul und Basra und die dort lebenden, seit Jahrhunderten verfeindeten Schiiten, Sunniten und Kurden in einen Staat. Nicht nur der Nahe Osten leidet bis heute unter den Folgen dieser unheilvollen Entscheidung.
Als die Staatsgründung vollbracht war, kehrte Gertrude Bell zur Archäologie zurück: Sie wollte, dass die Zeugnisse der jahrtausendealten mesopotamischen Zivilisation im Land blieben. Darum gründete sie das Irakische Nationalmuseum (damals das Archäologische Museum Bagdad) und entwarf ein Antikengesetz, das die Ausfuhr von Grabungsfunden streng kontrollierte. Das Museum wurde im Juni 1926, wenige Wochen vor Bells Tod, eröffnet.
Die Bagdader Jahre waren hektisch. Sie lebte so rastlos, wie sie es immer getan hatte, arbeitete zu viel, magerte ab, das Klima machte sie krank. Bell war in Bagdad eine geachtete, ja verehrte Persönlichkeit, jetzt aber empfand sie das Leben als einzige Frau unter Männern als sehr fordernd. Deprimiert schrieb sie an ihren Vater: »Es ist zu einsam, mein Leben hier, ich kann nicht weiterhin immer allein sein. Vor allem die Nachmittage, nach dem Tee, lasten schwer auf mir.« Nach der Staatsgründung spürte sie, dass sie entbehrlich wurde. Es gab keine neuen Ziele, und eine Umsiedlung nach England kam nicht in Frage. Sie wusste, dass die Londoner Gesellschaft sie trotz ihrer großen Verdienste nicht respektierte – für sie war und blieb Gertrude Bell eine Außenseiterin, genauer: eine exzentrische alte Jungfer.
Es kamen weitere Schläge: sie hatte mehrmals schwere Lungenentzündungen, das Bell-Vermögen war aufgrund der Wirtschaftssituation so geschrumpft, dass sie sich Sorgen um die Finanzierung ihres Alters machen musste, ihr jüngster Bruder starb an Typhus.
Am 12. Juli 1926, zwei Tage vor ihrem 58. Geburtstag, fand ihr Dienstmädchen sie morgens tot im Bett. Sie starb an einer Schlafmittelvergiftung. Die irakische Regierung ordnete ein Staatsbegräbnis an, in einem langen Trauerzug folgten hohe Vertreter Großbritanniens und des Iraks ihrem Sarg, der mit den Flaggen beider Staaten bedeckt war. Sie wurde auf Bagdads britischem Friedhof beigesetzt.
Im Archäologischen Museum Bagdad gab es eine Bronzebüste von Gertrude Bell, die seit der Plünderung des Museums im Jahre 2003 verschwunden ist, eine Plakette würdigte auf Arabisch und Englisch ihre Verdienste. Der Text beginnt mit den Worten:
GERTRUDE BELL
Derer die Araber immer mit Achtung und Zuneigung
gedenken werden
Schuf dieses Museum 1923.
Die übrige Welt, auch England, vergaß sie schnell. T. E. Lawrence wurde noch zu Lebzeiten in mehreren Biographien heroisiert, was er selbst übrigens strikt ablehnte, und 1962 durch den mit sieben Oscars ausgezeichneten Spielfilm Lawrence of Arabia endgültig weltberühmt. Ein Spielfilm über Gertrude Bell kam erst 2015. Er dreht sich nicht, wie eine Filmbesprechung in der Wochenzeitung DIE ZEIT kritisierte, um »Bells außergewöhnliche Rolle als Wissenschaftlerin, Ethnologin, Pionierin, Geheimdienstmitarbeiterin und schließlich als Politikerin auf Augenhöhe mit Winston Churchill«, sondern vor allem um ihre tragisch gescheiterten Liebesbeziehungen.
Gertrude Bell war aus dem Stoff, aus dem man im Europa des 19. Jahrhunderts Abenteurer und Forscher machte. Aber sie war eben auch eine Frau. Manche Menschen macht das bis heute ratlos.
Ebba D. Drolshagen