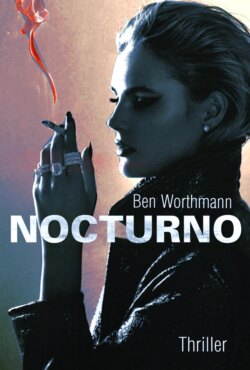Читать книгу Nocturno - Ben Worthmann - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.
ОглавлениеEr fand sich auf dem Sofa im kleineren der beiden Wohnräume im Erdgeschoss wieder, den sie als Salon bezeichneten, und fühlte sich miserabel. Die Vorhänge vor den großen Flügeltüren zur Terrasse waren zugezogen, aber nicht ganz geschlossen, sondern ließen einen ziemlich breiten Spalt frei, durch den sich eine Lichtbahn bis zum Sofa erstreckte und genau auf ihn mündete, der sich in voller Kleidung dort hin gestreckt hatte, nicht einmal die Schuhe hatte er mehr abgestreift. Es war nicht viel Scharfsinn notwendig, um zu dem Schluss zu gelangen, dass er einen wenig vorteilhaften Anblick bot.
Während er sich mit schwerem Schädel und schmerzendem Gesicht mühsam aufsetzte, dachte er, was Hanna wohl sagen würde, wenn sie ihn hier so anträfe. Der nächste Gedanke war keineswegs schöner, denn er besagte, dass sie ihn in diesem desolaten Zustand bereits vorgefunden haben musste und längst aus dem Haus war, denn dem Stand der Sonne nach musste es kurz nach Mittag sein. Halb zwei, schätzte er, und ein Blick auf die dunkle schmale Standuhr – ein Erbstück von Hannas Urgroßvater, das ihm angesichts seiner immer noch präzisen Zeitangaben wie ein wahres Wunderwerk vorkam – zeigte ihm, dass er sich nur um knappe fünf Minuten geirrt hatte.
Wo Agnes bloß stecken mochte? Ihr freier Nachmittag und Abend war mittwochs, wenn Hanna in der Firma ihren Jour fix mit ihren Leuten hatte und ohnehin spät nach Hause am, während er sich meist mit seinen Freunden zum Essen und Trinken traf. Er traf sich mit ihnen auch an anderen Tagen, wie beispielsweise gestern, am Donnerstag. Aber der Mittwoch war der Tag, an dem Hanna und er ganz dezidiert ihre eigenen Wege gingen und einander so gut wie nie sahen. Das war auch früher schon so gewesen, als sie noch besser mit einander ausgekommen waren. Da sie getrennte Zimmer mit jeweils eigenem Bad hatten, kam es aber auch an anderen Tagen vor, dass sie einander gar nicht oder nur kurz begegneten. Wenn Hanna, die ihr Frühstück ohnehin allein einnahm, aus dem Haus ging, schlief er meistens noch.
Er spürte jenen hässlichen Geschmack im Mund, der zurück blieb, wenn er am Abend zuvor verschiedene Spirituosen durcheinander getrunken hatte, und fragte sich erneut, weshalb sich Agnes nicht um ihn kümmerte. Er brauchte dringend etwas zu essen, denn immerhin fühlte er sich nicht verkatert, nachdem er mehr als zehn Stunden geschlafen hatte.
Von seiner ursprünglichen Absicht, ein Bad zu nehmen und zu versuchen, sich bei einem Glas Burgunder zu entspannen, war er nach seiner nächtlichen Heimkehr gleich abgekommen. Kaum dass die Haustür hinter ihm ins Schloss gefallen war, hatte er nur noch den Wunsch gehabt, seine flatternden Nerven zu beruhigen, und das möglichst schnell und effektiv. Statt sich Wein aus dem Keller zu holen, ging er in die Küche zum Kühlschrank und genehmigte sich ein Wasserglas von dem polnischen Bison-Wodka, den Agnes kürzlich von einem Heimaturlaub mitgebracht und ihm augenzwinkernd als „persönliches Präsent“, wie sie es nannte, überreicht hatte. Er kippte es noch im Stehen, nahm gleich noch ein zweites und begab sich dann in den Salon, wo er kurz den kleinen Beistelltisch mit dem Spirituosensortiment musterte, um sich für eine Flasche Hennessy zu entscheiden. Nach dem dritten oder vierten Glas musste er in einen fast komatösen Schlaf gesunken sein.
Er raffte sich vom Sofa auf, zog die Vorhänge zurück, öffnete die Flügeltüren und genoss die hereinströmende Wärme. Dann schaute er in der Diele und in der Küche nach und überlegte, ob er die paar Stufen zum Souterrain hinuntersteigen sollte, wo sich außer seinem Trainingsraum und der Sauna das kleine Apartment von Agnes befand, als er hörte, wie der Schlüssel im Haustürschloss gedreht wurde. Er fuhr zusammen. Offenbar kam Hanna früher als gewohnt, und das ausgerechnet an diesem Tag. Solch ein Mist. Aber es war nicht Hanna, sondern Agnes, mit einem Einkaufskorb und einer Tüte beladen. Sie ließ beides zu Boden gleiten und schlug sich in einer Geste des Erschreckens die Hand vor den Mund.
„Oh Gott, Herr Ziegler, was ist denn mit Ihnen passiert?“, entfuhr es ihr, während sie einen Schritt auf ihn zu tat und ihn mit Zeichen größter Besorgnis musterte. Er wich ein Stück zurück. „Kann ich etwas für Sie tun? Soll ich Ihnen einen Tee machen?“, fragte sie weiter, und dann, nach kurzem Zögern, mit einem sonderbaren Unterton in der Stimme: „Hat es irgendwie mit Ihrer Frau zu tun, mit diesem Anruf?“
„Was reden Sie denn da?“, entgegnete Max brüsk. Er hatte nicht die geringste Ahnung, worauf sie mit dieser Bemerkung anspielte.
„Hat Ihre Frau Sie denn noch nicht erreicht? Sie wollte auf jeden Fall noch einmal anrufen“, fuhr sie fort, während sie ihre Einkäufe an ihm vorbei in die Küche trug. „Es ging ja alles so schnell, und ich dachte nur …“.
Die Frage irritierte ihn, genau wie alles andere, das Agnes da von sich gab. Hanna rief ihn so gut wie nie aus dem Büro an. Allerdings, wenn sie ihn am Morgen, auf dem Sofa seinen Rausch ausschlafend, vorgefunden hätte, wäre das ein plausibler Grund gewesen, wenn auch aus seiner Sicht kein guter.
„Nein, das hat sie nicht“, murmelte er mit belegter Stimme und suchte in Agnes' Blick vergeblich nach irgendeinem Zeichen der Erklärung.
Nach all den Jahren wurde er immer noch nicht recht schlau aus ihr. Obschon sie nur wenig älter war als er selbst, erinnerte ihn sein Verhältnis zu ihr bisweilen an das eines etwas schwierigen Neffen zu seiner Tante, die regelmäßig zu Besuch kam, um nach dem Rechten zu sehen. Aber sie ihrerseits sah das vermutlich etwas anders. Es war schwer zu übersehen, dass sie unentwegt um ihn besorgt und bemüht war, es ihm besonders recht zu machen, so als hätte sie einen Narren an ihm gefressen. Max empfand das eher als lästig denn als amüsant und manchmal sogar als geradezu aufdringlich, vor allem, wenn sie Anstalten machte, mit ihm über Literatur oder Kunst zu reden, wozu sie sich offenbar bemüßigt fühlte, weil sie einige Semester studiert hatte. Zum Glück kam das selten vor. Zwar war sie nicht direkt unansehnlich mit ihrer kompakten, jedoch straffen Figur und dem glatten Gesicht, und sie pflegte sich auch und kleidete sich stets für ihre Verhältnisse vorteilhaft, aber falls sie insgeheim hoffte, dass Max sie auch nur im Entferntesten als Frau interessant finden könnte – was er ihr unterstellen zu können glaubte –, so war das einfach nur grotesk.
Tatsächlich war sie weit mehr als eine Hausangestellte, und das bereits seit jener Zeit, als Hannas Eltern noch lebten, die vor zehn Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen waren. Sie kochte und bereitete das Frühstück, sofern das notwendig war, denn oft traf sich Hanna schon frühmorgens mit Geschäftspartnern, und auch Max verzichtete nicht selten darauf und begnügte sich mit Obst. Sie kümmerte sich um die Wäsche, putzte und räumte auf und hielt auch draußen alles in Ordnung, soweit das nicht über ihre Kräfte ging. Den ganzen Tag über war sie auf den Beinen. In ihrem Appartement im Souterrain hielt sie sich nur zum Schlafen auf. Als Hanna und Max überlegt hatten, ob sie nicht noch ein weiteres Hausmädchen und einen Gärtner einstellen sollte, hatte Agnes derart betroffen reagiert, dass sie den Gedanken sofort wieder verwarfen. Für den Garten, den man durchaus auch als Park bezeichnen konnte, kamen jedoch regelmäßig Leute von einer Gartenbaufirma vorbei, und wenn sie Gäste hatten, wurde eine Catering-Firma beauftragt. Outsourcing sei auch im privaten Bereich das Gebot der Zeit, pflegte Agnes dies zu kommentieren. Sie war 1989 von Danzig herüber gekommen, in jenem Jahr, da die Grenze fiel, die Europa und die Welt und die Systeme geteilt hatte, und sie ließ hin und wieder gern durchblicken, dass sie nicht nur die Lektionen des Westens gelernt hatte, sondern auch bestrebt war, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.
„Ihre Frau ist nicht da, sie ist weggefahren“, fuhr sie in ihrem nahezu akzentfreien Deutsch fort, nachdem er ihr in die Küche gefolgt war. „Sie hat gestern Abend noch versucht, Sie anzurufen, aber Sie hatten wohl mal wieder, wie immer, kein Handy dabei."
Es dauerte ein paar Sekunden, bis ihm die Tragweite dieser Nachricht bewusst wurde und er erleichtert durchatmete. Agnes unterbrach ihr Auspacken und trat einen Schritt näher an ihn heran. In ihren Augen war jetzt etwas, das ihm wie gutmütiger Spott erschien. Sie registrierte offenkundig seine Erleichterung und dachte sich ihren Teil.
„Wieso … ich meine, wo ist sie denn hin? Wann kommt sie zurück?“, stotterte er.
„Ihre Freundin aus Hannover hat angerufen, mit ihrem Mann ist offenbar etwas Schlimmes geschehen. Sie hat nur ein paar Sachen in ihre Reisetasche geworfen und sich ein Taxi bestellt, selbst fahren wollte sie nicht, da sie etwas getrunken hatte, und es ging auch kein Flugzeug mehr."
Sie war also zu Petra gefahren, zu ihrer Freundin aus alten Zeiten. Petra – wie hieß sie noch gleich weiter? Er konnte sich weder an ihren Mädchennamen erinnern noch fiel ihm ein, wie sie hieß, seit sie verheiratet war. Petra war in Hannas Alter, knapp Mitte dreißig, eine dunkelblonde, kurzhaarige, sportlich wirkende Lehrerin mit leicht überspannten Vorstellungen von einer ökologisch korrekten Lebensweise. Max fand sie nicht unsympathisch, aber doch einigermaßen anstrengend. Ihrem Mann war er erst ein paar Mal begegnet. Er hatte ihn als ruhigen, etwas dicklichen, in sich gekehrten Mittfünfziger in Erinnerung, der als Naturwissenschaftler in irgendeinem Institut beschäftigt war und Henning hieß. Worin das angeblich Schlimme bestehen mochte, das diesem Henning zugestoßen war, interessierte ihn jedoch relativ wenig, vor allem interessierte es ihn jetzt nicht, da er mit seinen eigenen Problemen vollends ausgelastet war. Aber es war gut, Hanna dort zu wissen. Das verschaffte ihm erst einmal Luft. Das Wort Galgenfrist ging ihm durch den Kopf. Nur ganz kurz meldete sich eine innere Stimme, die ihm zuflüsterte, dass dieser überstürzte Aufbruch doch etwas seltsam anmutete. So eng war die Freundschaft zwischen Hanna und Petra schließlich auch nicht mehr, jedenfalls nicht, soweit er wusste. Und Hanna mochte zwar generös sein, aber dass sie einfach alles stehen und liegen ließ, um unter solchem Aufwand Samariterdienste zu leisten, passte nicht so ganz zu ihr. Womöglich weißt Du so manches nicht, flüsterte die Stimme, doch sie war zu schwach, um in sein Bewusstsein durchzudringen.
„Sie wird bestimmt noch einmal anrufen“, sagte Agnes. „Es ging ja alles so schnell." Dann, fast im selben Atemzug: „Sie möchten sicher erstmal ein Bad nehmen. Ich werde Ihnen inzwischen etwas zu essen machen. Ich habe Rinderfilet und grüne Bohnen gekauft. Das Jackett legen Sie am besten für die Reinigung raus. Und wegen des Auges sollten Sie schnell mal zum Arzt gehen. Wie ist denn das nur passiert?“
„Ach, das ist nichts weiter, ich habe mich nur ein bisschen gestoßen, beim Aussteigen aus einem Taxi“, entgegnete er unwillig.
Aber sie gab nicht bei.
„Vielleicht ist es besser, wenn Dr. Herold herkommt und sich die Sache anschaut. Soll ich ihn anrufen?“
„Nein, nein, lassen Sie das! Es ist wirklich nicht weiter schlimm. Es lohnt nicht, deswegen solch ein Aufhebens zu machen“, erwiderte er so heftig, dass sie sich resigniert ihrer Arbeit zuwandte.
Oben in seinem Zimmer fiel ihm ein, dass er sich etwas zu trinken hätte mitnehmen sollen. In seinem kleinen Kühlschrank neben der Tür zum Ankleideraum standen nur noch ein paar Flaschen Vitaminsaft und ein bisschen Chablis. Nach Saft war ihm gar nicht zumute. Aber er wollte Agnes nicht extra wegen einer Flasche Wasser kommen lassen. Und wenn er es recht bedachte, stand ihm der Sinn auch nicht nach Wasser. Er zog den Korken aus der halbvollen Flasche Weißwein, goss sich ein Glas ein und genoss das Gefühl des kalten Alkohols auf nüchternen Magen. Er spürte eine kleine Euphorie und sagte sich, dass es ihm irgendwie schon gelingen werde, Herr der Lage zu bleiben und ungeschoren aus dieser äußerst unangenehmen Sache herauszukommen.
Während das Badewasser lief, räumt er Brieftasche, Schlüssel und Zigaretten aus seinen Jacketttaschen und legte alles auf den Glastisch in der Leseecke. Dann zog er sich aus. Es tat gut, dieses Zeug endlich vom Leib zu bekommen – fast war ihm, als könne er damit zugleich auch die bösen Erinnerungen an die Nacht abstreifen. Und wenn nicht das geschwollene Auge, der leichte Schmerz im Knöchel der rechten Hand und die Beule am Hinterkopf gewesen wären, hätte er sich womöglich einzureden vermocht, bei dem, was ihm passiert war, handele es sich lediglich um das trügerische Produkt eines alkoholisierten Traums. Konnte er womöglich hoffen, dass überhaupt nichts weiter geschehen würde, dass ihm jegliche Komplikationen erspart blieben – abgesehen von dem ewig nagenden Skrupel, jemanden umgebracht zu haben, wenn auch nicht mit Absicht und aus juristisch durchaus vertretbaren Gründen?
Nein, er durfte sich keine Illusionen machen. Ein Toter, der erkennbar keines natürlichen Todes gestorben war, würde in jedem Fall Anlass für polizeiliche Ermittlungen sein. Und dann war da auch noch die verletzte Frau, von der er nicht wusste, welche Rolle genau sie in dieser Angelegenheit spielte, außer, dass sie zu einem Opfer geworden war, das zum Glück überlebt hatte. Aber selbst das ließ sich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Fest stand nur, dass sie dort gelegen hatte, verletzt und ohnmächtig, und dass sie kurze Zeit später verschwunden war.
Aber was waren das überhaupt für Überlegungen, mit denen er sich herumzuschlagen hatte. Was hatte das alles mit seinem Leben zu tun? Er war mit einer attraktiven, wohlhabenden Frau verheiratet, die von ihren Eltern eine der schönsten Wannsee-Villen geerbt hatte, ein architektonisches Schmuckstück aus der Gründerzeit, und die mit Erfolg das Bauunternehmen weiterführte, das in dritter Generation im Familienbesitz war – solides altes Geld, das bisher allen Krisen getrotzt hatte. Alles, was er tat, tat er aus Neigung, da materielle Gründe für jede Art von Beschäftigung entfielen. Er sah sich selbst bisweilen als Flaneur – und kam sich zugleich wie ein Fremder, wie ein Besucher in seinem Leben vor.
Aber er konnte es drehen und wenden wie er wollte: Fest stand, dass ihm eine äußerst unerfreuliche Zeit bevorstand. Morgen würde gewiss etwas in den Zeitungen stehen über den Toten, und womöglich auch über die Frau. Wenn es ganz schlimm kam – und damit musste er rechnen –, würde auch das Feuerzeug erwähnt werden, das am Tatort gefunden worden war. Er selbst war ja, vor lauter Schreck und Verwunderung über das Verschwinden der Frau, nicht mehr dazu gekommen, danach zu suchen, genau so, wie er es nicht geschafft hatte, die Polizei wenigstens anonym zu informieren. Dafür hätte er sich jetzt verfluchen können. Über kurz oder lang würde die Polizei bei ihm klingeln. Sicher, er könnte einfach leugnen, dass das Feuerzeug seins war. Aber auf jeden Fall würde Hanna es wiedererkennen, wenn ein Foto davon veröffentlicht würde. Und überhaupt, wenn er erst einmal anfinge zu lügen, würde er sich alsbald in Widersprüche verstricken.
Vor den Fragen Hannas hatte er noch mehr Angst als vor denen der Polizei. Er sah schon die Szene vor sich, wie er verzweifelt zu erklären versuchte, dass das Ganze nichts weiter als eine Verkettung unglücklicher Umstände war, dass er die Frau nicht kannte und nie zuvor gesehen und ihr einfach nur so gefolgt war, dass sein handfestes Eingreifen nichts, aber auch gar nichts mit jenen etwaigen abgründigen Affekten zu tun hatte, die ihm seine Ehefrau unterstellte. „Du würdest doch nur zu gern mal zuschlagen, wenn sich die Gelegenheit böte, einfach, weil Du Dich stark fühlst." Dieser Satz Hannas dröhnte ihm immer wieder in den Ohren.
Er nahm das Jackett und hängte es im Flur über das Geländer, so wie er es mit allen Textilien tat, die in die Reinigung mussten – wie eine Flagge der Trostlosigkeit hing es jetzt da. Dann leerte er die Taschen der Jeans, um sie sodann in den Wäschekorb zu stopfen. Das einzige, was er dabei zutage förderte, war jenes Streichholzheftchen, das er der Handtasche der bewusstlosen Frau entnommen hatte. Es trug den Aufdruck eines Kaffeehauses in der westlichen Berliner City, des „Café Wien“, das er kannte, weil er und Hanna es früher gelegentlich aufgesucht hatten. Sie mochten es wegen seines etwas unzeitgemäßen, überheblichen Charmes. Doch in letzter Zeit waren sie kaum noch zusammen dort gewesen, er allein oder mit seinen Freunden allerdings das eine oder andere Mal. Die Frau, deretwegen er sich geschlagen hatte, verkehrte also offenbar auch dort. War es möglich, dass er sie schon einmal gesehen hatte? Ein irritierender Gedanke.
Er klappte das Heftchen auf. Es enthielt nur noch das letzte Hölzchen, nachdem er sich mit dem vorletzten seine Zigarette angezündet hatte. Auf der Innenseite des Deckels war mit Kugelschreiber eine Adresse vermerkt: Modick, Schledestraße 120. Die Schrift war klar und leicht. Der Name sagte ihm nichts, aber die Anschrift umso mehr. Das war ja nur ein paar Häuser weiter von jener Stelle, an der es passiert war, vom Tatort. Die Frau hatte sich die Adresse offenbar notiert, um sie nicht zu vergessen. Die Frage lautete allerdings, weshalb sie mitten in der Nacht unterwegs gewesen war, um jemanden namens Modick in der Schledestraße zu besuchen.
Als er seine Unterwäsche ablegte, um sich in die Wanne zu setzen, fiel ihm wieder ein, dass er sein Oberhemd in der Toilette des Restaurants in den Behälter für die gebrauchten Papierhandtücher geworfen hatte, und obschon er das Badewasser wegen der Hitze nur auf eine laue Temperatur eingestellt hatte, überkam ihn ein Schweißausbruch. Was hatte er sich bloß dabei gedacht. Das Hemd war, ganz abgesehen von den auffälligen Knöpfen mit seinen Initialen, mit einem Etikett des Schneiders versehen – eine weitere Einladung an die Polizei, sich auf seine Spur zu begeben. Als einziger schwacher Trost blieb ihm vorerst die Vermutung, dass es nicht ganz leicht sein würde, eine Verbindung zwischen dem Vorfall in der Schledestraße und dem Hemd im Toilettenpapierkorb eines mehrere hundert Meter von dort entfernten Lokals herzustellen. Aber mit einiger Sicherheit würde die Kellnerin sich an ihn erinnern. Ob sie sich auch daran erinnern würde, dass er zunächst ein Hemd und später nur noch ein T-Shirt unter dem Jackett getragen hatte, war allerdings wiederum zweifelhaft.
Er stieg aus der Wanne, wickelte sich ein Badetuch um die Hüften, nahm sich noch ein Glas Wein und warf sich in seinen Lesesessel. Er versuchte – zum wievielten Mal eigentlich? – sich den Verlauf des Kampfs möglichst präzise vor sein inneres Auge zu holen. Doch das wollte ihm einfach nicht gelingen. Zwar stand außer Zweifel, dass da außer dem Angreifer noch ein weiterer Mann gewesen war. Doch welche Rolle dieser gespielt hatte, ob es sich um einen Komplizen des Angreifers gehandelt hatte oder jemanden, der wie er selbst zufällig zugegen gewesen war, konnte er beim besten Willen nicht sagen. Sein Gedächtnis setzte an einem bestimmten Punkt aus. Er hatte offenkundig eine Erinnerungslücke, da er eine Art Blackout erlitten hatte.
Später unterzog er sein Auge einer eingehenden Inspektion vor dem Spiegel. Ganz so schlimm schien es ihm doch nicht zu sein. Er tat etwas, das er selten tat, und ging nach nebenan in Hannas Badezimmer. In ihrem Kosmetikschränkchen fand er sofort, was er suchte und tupfte sich vorsichtig und mangels jeder Übung entsprechend ungeschickt etwas Puder auf die geröteten und geschwollenen Stellen. Außerdem beschloss er, außer Haus vorerst eine Sonnenbrille zu tragen.