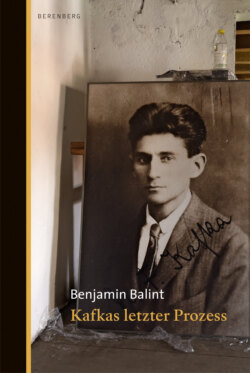Читать книгу Kafkas letzter Prozess - Benjamin Balint - Страница 9
3 Der erste Prozess
ОглавлениеTel Aviv, Familiengericht, Ben-Gurion-Boulevard 38, Ramat Gan, September 2007
Was tätig zerstört werden soll, muß vorher ganz fest gehalten worden sein […].
FRANZ KAFKA, »Zürauer Aphorismen«1
Nachdem Eva Hoffe und ihre Schwester im September 2007 mit dem Testament ihrer Mutter einen Erbschein beantragt hatten, wurden sie unsanft aus ihrer Trauer gerissen.
Nach Ester Hoffes Tod suchte Evas Schwester Ruth die nötigen Unterlagen zusammen und brachte sie persönlich zum Nachlassgericht in der Ha’Arbaa-Straße in Tel Aviv. Eva Hoffe bezweifelte, dass die Sache reibungslos über die Bühne gehen würde, denn das Testament ihrer Mutter gleiche einem »Buschfeuer in einer Dornenhecke«. Doch sie fügte sich ihrer älteren Schwester.
Nach dem israelischen Erbschaftsgesetz von 1965 kann ein Testament nur vollstreckt werden, wenn das israelische Nachlassgericht dessen Gültigkeit bestätigt. Für den entsprechenden Antrag muss eine vom Antragsteller unterzeichnete, notariell beglaubigte eidesstattliche Erklärung eingereicht werden, außerdem die Sterbeurkunde, das Originaltestament und Angaben zu anderen Erben oder Nutznießern. (Israel erhebt keine Erbschaftsteuer.) Damit Widerspruch gegen das Testament möglich ist, wird der Antrag veröffentlicht, meist in Form einer Zeitungsanzeige. Das Amt reicht den Antrag in Kopie an das Justizministerium weiter, das nach eigenem Ermessen einschreiten kann, sofern ein öffentliches Interesse vorliegt. Die offizielle Bestätigung des Testaments ist rechtlich bindend wie ein Gerichtsurteil.
»Mein [Kanzlei-]Partner ging eines Tages zufällig durch die Bibliothek, als ihm ein älterer Herr einen Stoß Unterlagen in die Hand drückte«, sagte Meir Heller, der Anwalt der Nationalbibliothek, gegenüber der Sunday Times. »Und in diesem Stoß befand sich Max Brods Testament. Wie mir beim Lesen gleich klar wurde, sollte Ester Hoffe die Papiere nach Brods Willen zu seinen Lebzeiten verwahren. Nach seinem Tod sollten sie an ein öffentliches Archiv gehen. Im Internet sah ich, dass die Gerichtsanhörung über die Bestätigung von Ester Hoffes Testament zwei Tage später stattfinden sollte.« Weniger als 48 Stunden darauf hatte Heller seinen dramatischen Auftritt. »Ich stürmte in das Gericht und rief: ›Halt! Es gibt noch ein anderes Testament – das Testament von Max Brod!‹«
Das Familiengericht belegt mehrere Stockwerke eines grauen Bürogebäudes an der Hauptstraße der Stadt Ramat Gan in der Nähe von Tel Aviv. Der zurückgesetzte Eingang ist von rot gefliesten Säulen gerahmt. Rechts daneben saßen vor einem Kiosk Anwälte und ihre Klienten auf orangefarbenen Plastikstühlen bei Sandwich, Falafel oder Schakschuka. Eva Hoffe und ihre Schwester Ruth kamen an jenem Morgen im September 2007 allein; Ruth war davon ausgegangen, dass es keinen Anlass zur Sorge gebe und kein Anwalt nötig sei. Als Heller auftauchte, war das ein Schock für die beiden, plötzlich standen sie der eisernen Maschinerie des staatlichen Rechtsapparates gegenüber. »Das war ein Hinterhalt«, sagte Eva Hoffe. »Man hatte uns getäuscht.«
Hellers Intervention führte dazu, dass der Staat Israel – vor dem Familiengericht vertreten durch den staatlichen Treuhänder (apotropos), die Nationalbibliothek und den gerichtlich bestellten Verwalter für Brods Nachlass – die Bestätigung des Testaments verweigerte und Ester Hoffes Testament anfocht. In den folgenden fünf Jahren, bis zum Urteil im Oktober 2012, wurde der Fall in einem engen Raum des Familiengerichts von Richterin Talia Kopelman Pardo verhandelt, die auf Erbrecht spezialisiert war.
Heller argumentierte, Brod habe Ester Hoffe die Kafka-Papiere nicht als Nutznießerin überlassen, sondern als Nachlassverwalterin. Da ihr die Manuskripte nie gehört hätten, könne sie sie auch nicht an ihre Töchter Eva und Ruth vererben. Ester Hoffe habe Brods Letzten Willen missachtet, behauptete Heller, genauso, wie Brod Kafkas Letzten Willen missachtet habe.
Nach Ester Hoffes Tod seien Kafkas Manuskripte wieder dem Brod-Nachlass zuzuordnen, der laut seinem Testament aus dem Jahr 1961 nun der Israelischen Nationalbibliothek nicht verkauft, sondern vermacht werden müsse, ohne dass den Hoffes dafür eine finanzielle Entschädigung zustehe. Brod habe in seinem Testament verfügt, dass Ester Hoffe seinen literarischen Nachlass nach ihrem Ermessen »der Bibliothek der Hebräischen Universität Jerusalem [mittlerweile die Israelische Nationalbibliothek] oder der Städtischen Bibliothek Tel Aviv oder einem anderen öffentlichen Archiv im Inland oder Ausland zur Aufbewahrung« übergeben solle.2 Die Nationalbibliothek brannte darauf, die Kafka-Sammlung in den großen Bestand der dort bereits befindlichen Papiere deutsch-jüdischer Schriftsteller einzureihen, unter ihnen auch Dichter aus dem Prager Kreis.
Meir Heller präsentierte Richterin Kopelman Pardo die Aussage seiner wichtigsten Zeugin Margot Cohn. Cohn, 1922 im Elsass geboren, wurde mit der Tapferkeitsmedaille der französischen Fremdenlegion ausgezeichnet, weil sie im Holocaust über ein geheimes Netzwerk unter Leitung von Georges Garel jüdische Kinder gerettet hatte. Sie emigrierte 1952 nach Israel, war von 1958 bis zu dessem Tod 1965 Sekretärin des Philosophen Martin Buber und arbeitete anschließend als Archivarin seines Nachlasses in der Nationalbibliothek in Jerusalem.
Cohn zufolge hatte Brod 1968 wenige Monate vor seinem Tod gemeinsam mit Ester Hoffe die Nationalbibliothek besucht. »Brod hatte zuvörderst die Absicht, das Archiv in der Jerusalemer Bibliothek unterzubringen, wo sich auch die Archive seiner besten Freunde befinden«, erklärte sie. »Aus meinem Gespräch mit Brod ging für mich eindeutig hervor, dass er schon beschlossen hatte, sein Archiv der Bibliothek zu übergeben. […] Bei seinem Besuch in der Abteilung sollten die fachlichen Details für die korrekte Übergabe des Archivs geklärt werden.« Später ergänzte Cohn im Gespräch mit dem israelischen Journalisten Zwi Harel: »Während seines Besuchs bei uns [in der Nationalbibliothek] wich Frau Hoffe keine Sekunde von seiner Seite. Ich versuchte Brod zu erklären, wie ich Bubers Archiv verwalte. Sie ließ Brod nicht zu Wort kommen.« Auf Harels Frage, warum Brod in seinem Testament verfügt habe, sein literarischer Nachlass solle an Ester Hoffe gehen, äußerte Cohn die Vermutung, es könne daran gelegen haben, dass Brod »Frauen gegenüber sehr schwach war. Das war seine Schwäche.«
Nach Brods Tod hatte die Nationalbibliothek Verhandlungen mit Ester Hoffe aufgenommen. Im Gegenzug für die Übergabe des Brod-Nachlasses und der Kafka-Manuskripte wollte sie sich verpflichten, die Brod-Forschung finanziell zu unterstützen, 1984 eine Ausstellung zu Brods 100. Geburtstag zu zeigen und ein internationales Symposium zu seinem Werk auszurichten. Doch Hoffe blieb unkooperativ.
In einem letzten Versuch schickte die Nationalbibliothek 1982 den Leiter der Manuskript- und Archivabteilung Mordechai Nadav und seine Assistentin Margot Cohn erneut zu Ester Hoffe. Sie besuchten sie in ihrer Erdgeschosswohnung in einem kastigen rosa Wohnblock in der Spinoza-Straße 20. »Wir betonten, wie wichtig es sei, Brods und Kafkas Manuskripte der Bibliothek zu überlassen«, erzählte Cohn. »Wir versprachen, sie würden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, damit das intellektuelle Wirken Brods und seiner Prager Freunde eine Fortsetzung finden konnte.«
Cohn beschrieb vor Gericht die Unordnung in der Wohnung, die Ester Hoffe mit Eva teilte. »Mit Erstaunen sah ich, dass sich in der Wohnung Papiere und Aktenordner stapelten«, erzählte sie von dem Besuch 1982. »Auf fast jedem Stoß saß eine der vielen Katzen, die durch die Wohnung streiften. Man konnte sich nirgends hinsetzen, und wir bekamen kaum Luft. Ich hatte den Eindruck, dass Frau Hoffe nicht daran interessiert war, das Archiv der Bibliothek zu übergeben, und am Ende gab sie die Schriften auch nicht her […] und ließ Brods Wunsch unerfüllt.«
Hier widersprach Eva Hoffe, Margot Cohn habe gar keine Katzen über die Manuskripte klettern sehen können, weil ihre Katzen nicht in das Zimmer ihrer Mutter durften, wo die Papiere aufbewahrt wurden.
In einer Gerichtsverhandlung im Februar 2011 unter Vorsitz von Richterin Kopelman Pardo nahm Hoffes Anwalt Margot Cohn ins Kreuzverhör. Er fragte, ob sie sich an die Farbe des Bücherregals in der Wohnung der Hoffes in der Spinoza-Straße erinnern könne.
»Nein.«
Wenn sie sich nicht an die Farbe des Bücherregals erinnere, hakte er nach, warum könne sie sich dann so lebhaft an die Unordnung und die Katzen erinnern?
Ein Regal, erwiderte sie, »ist unter Jeckes [Juden deutscher Herkunft] normal und fiel mir nicht weiter auf. Aber Katzen und stapelweise Papier fand ich ungewöhnlich.«
Einen Monat später wurde Cohn erneut vorgeladen, um sich zu der Frage zu äußern, ob Brod seine Kafka-Manuskripte an Hoffe übergeben habe.
Cohn: »Dass er ihr Geschenke machte, wusste ich. Das war kein Geheimnis.«
Richterin Kopelman Pardo: »Er machte ihr Geschenke?«
Cohn: »Er schenkte ihr Bücher, Manuskripte.«
Schmulik Cassouto, gerichtlich bestellter Verwalter für Ester Hoffes Nachlass, hielt dagegen, Margot Cohn hätte damals eine gerichtliche Anordnung für die Herausgabe der für die Bibliothek vorgesehenen Materialien erwirken können, wenn sich die Nationalbibliothek wirklich als Erbe der vernachlässigten Manuskriptstapel betrachtet hätte. Er rief dem Gericht zudem in Erinnerung, dass sich Cohn, die Brod nur einmal begegnet war, wohl kaum in der Position befand, etwas über seine Wünsche auszusagen. Man habe Cohn unbeabsichtigt »in eine unangenehme Lage gebracht, indem man sie als (ungeeignetes) Werkzeug für die Revision von Dr. Brods Testament missbrauchte«, so Cassouto. »Es gibt ein neues Deutschland, und Max Brod gehörte zu den Ersten, die das erkannten«, so der Anwalt. »Es gibt in der Tat ein neues Deutschland«, erwiderte Cohn mit einer gewissen Schärfe, »aber das heißt nicht, dass Brod erwogen hätte, sein Archiv dort unterzubringen.«
Im Juni 1983 waren die langwierigen Gespräche zwischen Ester Hoffe und der Nationalbibliothek endgültig gescheitert. Der deutsche Literaturwissenschaftler Paul Raabe, ehemaliger Bibliotheksdirektor des Marbacher Literaturarchivs und Leiter der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel, der Brod persönlich gekannt hatte, schrieb damals verärgert an Ester Hoffe:
Es scheint wohl so zu sein, wie ich befürchtete: Sie können sich nicht entschließen, für Max Brod das zu tun, was nicht nur seine Freunde erwarten, sondern was Ihnen auch selbstverständlich sein sollte.
Wenn es jetzt nicht zu einem Abkommen mit der Nationalbibliothek über den Nachlaß von Max Brod kommt, wird sein hundertster Geburtstag vorbeigehen, und damit werden Sie Max Brod den schlechtesten Dienst erweisen, dem [sic] Sie diesem gütigen Menschen erweisen können. So sehr ich verstehe, daß Sie tausend Zweifel und Bedenken haben, so möchte ich Ihnen doch sagen, daß Sie diese im Interesse Max Brods zurückstellen müssen. […]
Es hat uns [Raabe und seine Frau] sehr bewegt, Sie in Tel-Aviv wiederzusehen. Ich habe auch Ihre Hilflosigkeit gefühlt, ich hatte Ihnen deshalb spontan meine Dienste angeboten. […] Wie gerne hätte ich mit Ihnen wieder zusammengearbeitet, und wie gern hätte ich Ihnen bei all Ihren Problemen zur Seite gestanden. Aber wenn Sie alle Welt verärgern, werden Sie in Kürze ganz allein dastehen. Das ist nicht nur für Sie schlimm, sondern auch für das Andenken an Max Brod und an Kafka katastrophal.
Es tut mir leid, daß ich Ihnen so offen schreibe und schreiben muß, doch sie sollten meine Enttäuschung wissen, da ich zu Max Brods Verehrern gehöre und wir, liebe Frau Hoffe, immer in einer engen persönlichen Beziehung gestanden haben.
In einem zweiten Brief fügte Raabe etwas später hinzu:
Nun sehe ich, daß die Verhandlungen gescheitert sind, und ich möchte Ihnen nur sagen, daß ich darüber sehr traurig bin. Sie haben damit wohl die letzte Gelegenheit vertan, zu Ihren Lebzeiten die Papiere von Max Brod so unterzubringen, wie er es sich sicherlich in seinem Leben gewünscht hat, aber ja leider in seinem Testament nicht eindeutig verfügte. Nun werden auch diese Papiere eines Tages sowie die Papiere von Franz Kafka zum Spielball persönlicher Interessen, und dies hat Ihr guter Max Brod nicht verdient.3
Es sei durchaus keine Seltenheit, schrieb Henry James 1914 an seinen Neffen, dass der Verwalter eines literarischen Nachlasses dessen Nutzung ganz und gar vereitele. In Raabes Augen hatte auch Ester Hoffe ihre Pflicht als Hüterin des Andenkens und der Arbeit von Max Brod verletzt. Wie T. S. Eliots Witwe Valerie, die vor ihrer Heirat acht Jahre lang Sekretärin des Dichters gewesen war, und wie Ted Hughes, Nachlassverwalter für das literarische Werk von Sylvia Plath nach ihrem Selbstmord 1963, hatte auch Ester Hoffe ihr Vetorecht missbraucht und Biografen und Forscher abgewimmelt. Aus lauter Besitzgier und Eifersucht drohte sie genau das Andenken zu beschädigen, dessen Schutz ihr anvertraut worden war. So zumindest sah es Raabe.
Aber stimmte das auch? Behinderte Ester Hoffe in ihrer Habsucht die Forschung? Eva Hoffe betont, dass ihre Mutter Ende der siebziger und in den achtziger Jahren angesehenen Kafka-Forschern sehr wohl erlaubt habe, die Papiere einzusehen. »Dass wir Forschern den Zugang zu dem Material verweigert haben, ist eine Lüge«, sagte sie im Gespräch mit mir. Es ist wahr, dass Ester Hoffe dem Patriarchen des Suhrkamp Verlags, Siegfried Unseld, das Manuskript von Kafkas »Beschreibung eines Kampfes« verkaufte.4 Auch übertrug sie dem S. Fischer Verlag das Recht, Fotokopien von Der Prozess, Kafkas Briefen an Brod und den Reisetagebüchern Kafkas und Brods für die Kritische Ausgabe zu verwenden, an der Malcolm Pasley von der Universität Oxford damals arbeitete. Für diese Rechte erhielt Ester Hoffe 100.000 Schweizer Franken und aus der Startauflage fünf Exemplare jedes Bandes. Sie muss auch den deutschen Herausgebern von Walter Benjamins Gesammelten Werken Einblick gewährt haben; die Originale einiger Briefe Benjamins an Brod, die dort abgedruckt sind, wurden später in Ester Hoffes Nachlass gefunden.
Wie vor ihm Raabe äußert auch Reiner Stach in seiner maßgeblichen dreibändigen Kafka-Biografie seinen Missmut: »Diese unbefriedigende Situation würde sich zweifellos entscheidend bessern, wenn mit dem Nachlass des langjährigen Freundes Max Brod eine literaturhistorisch erstrangige und keineswegs nur im Zusammenhang mit Kafka bedeutsame Quelle endlich der Forschung zugänglich würde.«5 Ich bat Stach, dies näher zu erläutern.
In den 1970er Jahren machte Ester Hoffe die Papiere in ihrer Wohnung einigen Forschern zugänglich, unter ihnen Margarita Pazi [die sich mit deutsch-jüdischer Literatur und auch mit Brod befasste] und Paul Raabe; sie erhielten aber nicht die Gelegenheit, »systematisch« damit zu arbeiten. Deshalb zitierten sie in ihren Aufsätzen und Büchern auch nie daraus. Die einzige Ausnahme war (soweit ich weiß) Joachim Unseld [Siegfried Unselds Sohn]: Er kaufte ein Kafka-Manuskript und erhielt anschließend die Erlaubnis, einige Briefe Max Brods zu kopieren.
Malcolm Pasley erhielt Zugang zu den Safes, weil der S. Fischer Verlag viel Geld für Kopien der Kafka-Manuskripte zahlte, die er für die Kritische Ausgabe brauchte. Er erhielt keinen Zugang zu den Papieren in der Wohnung, obwohl das für den Kommentar sehr wichtig gewesen wäre.
Hans-Gerd Koch, der seit etwa 1990 am Kommentar arbeitet, erhielt nie Einsicht in die Papiere in der Wohnung, obwohl es auch für ihn und die Ausgabe sehr wichtig gewesen wäre.6
Aus eben diesem Grund schrieb Stach den chronologisch ersten Band über Kafkas frühe Jahre als letzten. Seine amerikanische Übersetzerin Shelley Frisch erklärt in ihrem Vorwort zur englischen Ausgabe:
Diese Reihenfolge, die auf den ersten Blick abwegig, ja geradezu »kafkaesk« anmutet, wurde von der gerichtlichen Auseinandersetzung um Max Brods literarischen Nachlass in Israel erzwungen; in dieser Zeit erhielten Forscher keinen Einblick in die Materialien, von denen sich viele unmittelbar auf Kafkas Entwicklungsjahre bezogen.
Als Stach 2013 für seinen Band Kafka: Die frühen Jahre recherchierte, bat er nach eigener Aussage »Eva Hoffe in einem ausführlichen Brief, mir nur einige von Brods frühen Tagebüchern zu zeigen«. Sie lehnte ab. Eva Hoffe bestätigte mir das. »Ich erklärte ihm, dass mir die Hände gebunden seien«, sagte sie, »und dass ich die Schlüssel zu den Schließfächern nicht mehr hätte.«
Meir Heller vermischte vor Gericht von Anfang an juristische Argumente und ideologische Erwägungen, unterstützt von einem Chor israelischer Beobachter, die Kafkas rechtmäßigen Platz in einer israelischen Einrichtung sahen. So erklärte der Kafka-Forscher Mark Gelber, Professor an der Ben-Gurion-Universität, gegenüber der New York Times, Kafkas »enges Verhältnis zum Zionismus und den Juden« untermauere den Anspruch, seine lange verschollenen Schriften in Israel zu belassen.
Die Entscheidung, Ester Hoffes Testament anzufechten, machte Beobachter in Deutschland ebenso fassungslos wie Eva Hoffe. Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach hatte mit ihr darüber verhandelt, den Brod-Nachlass einschließlich Kafkas Schriften zu erwerben. Das Literaturarchiv meldete sich als interessierte Partei beim Gericht und bekräftigte Eva Hoffes Anrecht auf die Manuskripte. Das Marbacher Literaturarchiv, das weltweit größte für moderne deutsche Literatur, ist für Deutschland mehr oder weniger, was die Nationalbibliothek für Israel darstellt. Finanziert wird es vom Land Baden-Württemberg, vom Bund und von Drittmitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft (deren Gelder wiederum überwiegend vom Bund kommen).
Anders als die Israelische Nationalbibliothek erhob Marbach keinen Anspruch auf die Manuskripte; man wollte lediglich das Recht erhalten, dafür zu bieten. Die Forderung Israels wirkte auf die Marbacher daher wie ein verzweifeltes, wenn auch cleveres Manöver. Wenn man dem Markt freien Lauf ließe, so argumentierten sie, würde Hoffe die Manuskripte nach Deutschland verkaufen.
Als die Spannungen zunahmen, bestätigte der Direktor des Deutschen Literaturarchivs Ulrich Raulff Eva Hoffe brieflich, ihre Mutter Ester habe »mehrfach die Absicht geäußert, den Nachlass von Max Brod nach Marbach zu geben«. Raulff lobte die »modernsten Möglichkeiten der fachgerechten Lagerung und Verzeichnung« wie auch das Fachpersonal für Konservierung, Restaurierung, Entsäuerung und Digitalisierung und brachte seinen Wunsch zum Ausdruck, Kafkas Manuskripte in die Nachlässe der mehr als 1400 Schriftsteller im Marbacher Archiv einzureihen, die in speziellen Lagerräumen bei konstant 18 bis 19 Grad Celsius und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 bis 55 Prozent aufbewahrt würden.7 Unter anderem lagerten dort das Helen und Kurt Wolff-Archiv mit den Nachlässen von mehr als zweihundert Schriftstellern und Gelehrten, die vom NS-Regime verfolgt worden und ins Exil gegangen waren.8 Raulff fügte hinzu, dass Marbach bereits die nach Oxford weltweit zweitgrößte Sammlung von Kafka-Manuskripten beherberge.9
»Die Israelis sind anscheinend verrückt geworden«, kommentierte der Kafka-Experte Klaus Wagenbach (dessen Papiere ebenfalls in Marbach archiviert werden), als die Anfechtung von Ester Hoffes Testament bekannt wurde.10 Doch im Lauf der Verhandlung unter Richterin Kopelman Pardo rückte das Literaturarchiv von seiner konfrontativen Haltung ab und betonte, eine Schlacht um Kafka mit nur einem Sieger lasse sich durchaus vermeiden. Marcel Lepper, der damalige Leiter des Forschungsprogramms in Marbach, verwies darauf, dass das Deutsche Literaturarchiv im Jahr 2012, finanziell unterstützt vom Auswärtigen Amt, mit dem Franz Rosenzweig Minerva Research Center und der Hebräischen Universität Jerusalem ein Forschungsprojekt begonnen habe, bei dem es um die Bewahrung deutsch-jüdischer Sammlungen in israelischen Archiven gehe. »Kooperative, dezentrale Projekte sind im Kontext der deutschisraelischen Beziehungen besser mit der besonderen deutschen Verantwortung vereinbar.«11
Eva Hoffe hatte dazu eine dezidierte Meinung. »Marbach traut sich nicht, den israelischen Behauptungen offen zu widersprechen«, wird sie im November 2009 in der Wochenzeitung Die Zeit zitiert. »Da ist immer noch ein schlechtes Gewissen wegen des Krieges und des Holocaust.«12 Mir gegenüber sagte sie, »Deutschland und Israel, die deutsche und die levantinische Kultur«, seien eben »einfach unvereinbar«.
Das Archiv verpflichtete den israelischen Urheberrechtsexperten Sa’ar Plinner, die Marbacher Interessen im Fall Hoffe zu vertreten. Plinner legte dem Gericht eine Aussage des Archivleiters Ulrich von Bülow vor, der zufolge Brod in den 1960er Jahren das Archiv besucht und explizit den Wunsch geäußert habe, dass sein Nachlass nach Marbach gehen solle. Das Verfahren diene dem israelischen Staat lediglich als Vorwand, Privateigentum an sich zu reißen, so Plinner. Der ursprünglich private Austausch zwischen Kafka und Brod sei zunächst in Brods Besitz übergegangen, dann in den weiteren Kreis der Familie Hoffe, und nun falle er womöglich sogar an den Staat.
In einer späteren Verhandlung verwies Plinner erneut auf die persönliche Beziehung, die am Beginn dieses Falls stehe: die Freundschaft zwischen Kafka und Brod. Das Gericht möge doch bitte unterscheiden zwischen den Manuskripten, die Kafka Brod geschenkt, und denen, die Brod nach Kafkas Tod aus dessen Schreibtisch geholt hatte. Letztere, so Plinner, gehörten rechtmäßig weder der Familie Hoffe noch der Nationalbibliothek, sondern höchstens Kafkas einzigem lebenden Erben, Michael Steiner in London.
Doch auch Brods Anrecht auf die Geschenke, die er direkt von Kafka erhielt, ist durchaus umstritten. Kafka-Biograf Reiner Stach etwa schreibt, dass Brod zwar behauptete, Kafka habe ihm mehrere unvollendete Manuskripte geschenkt, doch tatsächlich habe Kafka sie Brod nur als eine Art »Dauerleihgabe« überlassen und ihn später ausdrücklich darum gebeten, sie zu verbrennen. Wegen seiner Verdienste um Kafkas literarisches Vermächtnis stellte allerdings kaum jemand Brods Behauptung infrage. Michael Steiner schrieb mir dazu:
Den Kafka Estate interessierte in dieser Angelegenheit, ob Franz Kafka einige der Manuskripte, um die es in der Streitsache ging, Max Brod womöglich nie geschenkt hat und sie daher zum Kafka-Nachlass gehören. Wir brauchten viele Jahre, um eine Inventarliste zu bekommen, und da diese Liste nicht von einem Wissenschaftler erstellt worden war, bleiben bis heute Zweifel, ob bestimmte Manuskripte je als Schenkung an Brod gingen. Sämtliche Richter haben über die Jahre betont, dass sie sich mit dieser Frage nicht befasst hätten, sondern nur damit, wer der rechtmäßige Eigentümer der Manuskripte war, die laut Brods Letztem Willen ihm gehörten oder ihm zu Lebzeiten möglicherweise geschenkt worden waren.13
Die Auseinandersetzungen vor Richterin Kopelman Pardo fanden auch außerhalb des Gerichtssaals Widerhall. Im Januar 2010 bezog Reiner Stach im Berliner Tagesspiegel Stellung:
Marbach wäre sicher der richtige Ort für den Brod-Nachlass, weil man dort die Wissenschaftler und die Erfahrung hat im Umgang mit Kafka, Brod und der deutsch-jüdischen Literaturgeschichte. Dass die Hoffe-Töchter mit Marbach jetzt ernsthaft verhandeln, hat im Israelischen Nationalarchiv [sic] irgendwelche Ressentiments oder Begehrlichkeiten geweckt. Dort jedoch fehlen für diese deutschsprachigen Texte aus dem einstigen Kulturraum zwischen Wien, Prag und Berlin die sprach- und milieukundigen Leute. Brod hatte ja schon als junger Mann zahllose Kontakte geknüpft, zu Heinrich Mann, zu Rilke, Schnitzler, Karl Kraus, Wedekind oder zu Komponisten wie Janacek [sic], und er besprach diese Korrespondenzen mit Kafka. Aber das war Jahrzehnte, ehe er nach Palästina kam – hier von israelischem Kulturgut zu sprechen, erscheint mir ganz abwegig. In Israel gibt es heute weder eine Kafka-Gesamtausgabe noch eine einzige Straße, die nach Kafka benannt wäre. Und suchen Sie Brod auf Hebräisch, müssen Sie ins Antiquariat gehen.14
Tatsächlich begann Mordechai Nadav erst 1966 mit dem Aufbau der Archivabteilung der Nationalbibliothek, als die literarischen Nachlässe von Martin Buber und dem israelischen Nobelpreisträger S. J. Agnon an die Bibliothek gingen. Und erst 2007 richtete sie eine gesonderte Abteilung für Handschriften und Nachlässe ein.15 Doch einige Israelis wehren sich gegen die Behauptung, Israel mangele es an Wissen und Ressourcen für die Aufbewahrung von Brods Manuskripten. Professor Otto Dov Kulka erklärte gegenüber der israelischen Zeitung Ha’aretz: »Als gebürtiger Prager, der an der Hebräischen Universität mit israelischen und ausländischen Kollegen die jüdische Kultur und Geschichte sämtlicher Epochen erforscht – in ihren Sprachen Hebräisch, Deutsch und Tschechisch –, verwahre ich mich entschieden gegen die verlogenen und ungeheuerlichen Behauptungen, die unsere Legitimität für die Durchführung dieser Forschungen und einen wissenschaftlich angemessenen Umgang mit diesen Primärquellen im Allgemeinen und mit Kafka und Brod im Besonderen infrage stellen.« Der New York Times sagte Kulka 2010: »Es heißt, die Papiere seien in Deutschland sicherer. Die Deutschen würden sich gut darum kümmern. Die Deutschen haben sich aber im Lauf der Geschichte nicht sonderlich gut um Kafkas Sachen gekümmert. Sie haben sich nicht gut um seine Schwestern gekümmert [die im Holocaust umkamen].«16
Im Februar 2010 verfasste Kulka mit zwei Dutzend renommierten israelischen Wissenschaftlern einen offenen Brief auf Hebräisch, der auch auf Deutsch erschien (einem nicht ganz perfekten und etwas altmodischen Deutsch): »Wir, die Unterzeichneten, israelische Akademiker und Forscher die sich mit der deutsch-judischen Geschichte befassen, sind entsetzt über die Art wie die israelische Akademia in der deutschen Presse dargestellt wird, als ob wir weder Interesse, noch das historische Wissen und sprachliches Können hätten, um das Max Brod Archiv zu erforschen. Max Brod ist ein Teil der Geschichte des Staates Israel, ein Schriftsteller und Philosoph, der unzahlige Artikel über den Zionismus geschrieben hat und der sich, nach seiner Flucht vor den Nazis aus Prag, in Israel (damals Palaestina) niederliess und hier uber dreissig Jahre bis zu seinem Tod lebte.«17
Nurit Pagi, die an der Universität Haifa über Brod promovierte, war die treibende Kraft hinter dem offenen Brief. Der Zeitung Ha’aretz sagte Pagi: »Brods breit gefächertes Werk hat unter anderem deshalb nicht die verdiente Anerkennung erhalten, weil sein Archiv – das 20.000 Seiten umfasst – seit seinem Tod 1968 Wissenschaftlern nicht zugänglich war, obwohl er darum gebeten hatte, dass es an die Nationalbibliothek gehen solle. Nun besteht die einzigartige Chance, diese Ungerechtigkeit, die ihm seit vielen Jahren widerfährt, zu korrigieren und Forschern aus Israel und anderen Ländern die Möglichkeit zu geben, neues Licht auf sein Werk und sein Erbe zu werfen.«
Pagi erzählte mir, ihre Mutter und Eva Hoffe hätten in dem Jugenddorf Ben Schemen zusammen die Schule besucht, das 1927 gegründete landwirtschaftliche Internat. Pagi stieß in den 1960er Jahren in einer öffentlichen Bücherei in Haifa zum ersten Mal auf Brods Romane und erkannte mit wachsender Faszination, dass Brod parallel zu seiner Hinwendung zum Zionismus literarisch einen realistischeren Stil und Wortschatz entwickelt hatte. Für sie war Brod der Beweis für eine allgemeinere Weisheit: »Der Zionismus wurde auf Deutsch verfasst.« Pagi bezog sich auf die tiefe Verwurzelung der zionistischen Bewegung in der deutschsprachigen Kultur, angefangen mit den Schriften des Wiener Journalisten Theodor Herzl, den ersten Zionistenkongressen in Basel und zionistischen Zeitungen wie der Jüdischen Rundschau von Robert Weltsch, einem Cousin Felix Weltschs.
Vor einigen Jahren erfuhr Pagi, dass der Sohn einer der bedeutendsten israelischen Dichterinnen zögerte, den literarischen Nachlass seiner Mutter in Israel zu belassen, weil »wir hier keine Zukunft haben«, wie er sagte. »Der Verbleib des Brod-Archivs in Israel könnte beweisen, dass wir an unsere Existenz und unsere Zukunft hier im Land glauben«, so Pagi. »Dass wir wissen, die zionistische Bewegung hat sich noch lange nicht verwirklicht und dem Erbe des mitteleuropäischen Judentums fällt bei dieser Verwirklichung eine wichtige Aufgabe zu. In der Tat, auch der Kampf um den Verbleib des Archivs von Max Brod in Israel ist einer der wichtigen Kämpfe, die wir für unsere Zukunft in unserem Land austragen.«18 Andreas Kilcher aus Zürich, renommierter Experte für Kafka und deutsch-jüdische Literatur, zitierte Pagis Worte als ein Beispiel für den »kulturkämpferischen Gestus« und die »bellikose Rhetorik« rund um den Prozess.19
Die Wortwahl der Wissenschaftler auf beiden Seiten – »Ressentiments«, »ungeheuerliche Behauptungen«, »kulturkämpferisch« – spiegelt jedenfalls deutlich den Streit von Deutschen und Israelis um das gemeinsame literarische Erbe wider.
Bei der nächsten Sitzung des Familiengerichts von Tel Aviv, kurz nach Margot Cohns Kreuzverhör, machte auch Eva Hoffe ihre Aussage. Nach dem »Hinterhalt« beim ersten Gerichtstermin hatten sich ihre Schwester Ruth und sie zunächst an Arnan Gabrieli gewandt, einen der angesehensten Anwälte für Urheberrecht in Israel. Gabrieli hatte ihre Mutter Ester vertreten und auch die Verhandlungen für den umstrittenen Verkauf der Sammlung des Jerusalemer Dichters Jehuda Amichai an die Yale University geführt. Doch Eva Hoffe zufolge belästigte ihre Schwester Gabrieli dermaßen – unter anderem rief sie wiederholt bei ihm zu Hause an –, dass er den Fall ablehnte. Stattdessen engagierten die Schwestern die Anwälte Uri Zfat und Jeschajahu Etgar. (Zfat hatte 1975 im Alter von 24 Jahren als Jurastudent an der Bar-Ilan-Universität Büroarbeiten für Richter Schilo erledigt.)
Von Anfang an stellten die beiden Anwälte die Position der Nationalbibliothek als Versuch dar, Privateigentum zu verstaatlichen. Das Urteil von Richter Schilo aus dem Jahr 1974, mit dem der Vorstoß des Staates, sich die Kafka-Manuskripte anzueignen, abgewehrt wurde, solle Bestand haben, argumentierten sie und riefen Richterin Kopelman Pardo in Erinnerung, dass Schilo im damaligen Verfahren, anders als im gegenwärtigen, Ester Hoffes Aussage selbst hatte hören können. »Die Ansprüche der Bibliothek waren bereits Gegenstand eines Verfahrens […] und wurden in einer Weise entschieden, die für eine erneute Verhandlung keinen Raum lässt.«
Ohnehin dürfe man die Kafka-Papiere nicht als Teil von Brods Nachlass betrachten, so Uri Zfat. Da Brod in seinem Testament Kafkas Papiere nicht gesondert erwähnt habe, sei er sich durchaus bewusst gewesen, dass sie nicht mehr zu seinem Nachlass gehörten; er hatte sie Ester Hoffe ja bereits geschenkt. Und schließlich habe die Nationalbibliothek in den Jahren, in denen sie mit Ester Hoffe über die Kafka-Schriften verhandelt habe, nie auch nur angedeutet, dass sie sich selbst als rechtmäßige Erbin verstanden hätte.
Schmulik Cassouto, Ester Hoffes Nachlassverwalter, fügte hinzu, der Vorstoß des Staates, die Manuskripte an sich zu reißen, komme »offener Bevormundung« gleich und sei »eines demokratischen Staates, als der sich Israel präsentiert, unwürdig«. Cassouto fuhr fort: »Es ist nicht an uns zu entscheiden, ob Brod seinen Nachlass der Person hinterlassen hat, die dafür am besten ›geeignet‹ war. Auch steht es uns nicht zu, in Zweifel zu ziehen, was ihm am meisten am Herzen lag. Der Staat mag Recht haben mit der Behauptung, dass es für Brod besser gewesen wäre, wenn er Frau Hoffe nicht so nahe gestanden hätte, oder dass er seinen ›Schatz‹ besser einem passenderen Erben vermacht hätte – und einen passenderen Erben als den Staat Israel gibt es nicht. Aber Brod hat Frau Hoffe eben nahegestanden. Für ihn war sie die einzige verbleibende Familie, und ihr wollte er alles geben, was er besaß. Dieser Wille muss respektiert werden.«
Da Brod die Kafka-Manuskripte zu Lebzeiten als Schenkung an Ester Hoffe gegeben habe, so Cassouto, seien diese Manuskripte de facto und de jure nicht Teil des Brod-Nachlasses und somit nicht Gegenstand der Testamentsauslegung. Was Brods eigenen Nachlass angehe, habe er Ester Hoffe testamentarisch eindeutig das Recht übertragen, zu entscheiden, wo sie ihn hingebe und unter welchen Bedingungen. Wenn die Nationalbibliothek Anstand beweisen wolle, fuhr er fort, würde sie mit Eva Hoffe über den Erwerb der Manuskripte verhandeln, statt sie dermaßen unter Druck zu setzen. Dass die Nationalbibliothek die Manuskripte erhalten könnte, ohne Eva Hoffe dafür zu entschädigen, bezeichnete er als »absurd«.
Abgesehen von solchen juristischen Feinheiten waren die Sitzungen vor dem Familiengericht von Tel Aviv jedoch von allgemeineren Überlegungen darüber beherrscht, wo Kafkas und Brods Erbe nun eigentlich hingehöre. »Wie bei vielen anderen Juden, die ihren Beitrag zur westlichen Zivilisation geleistet haben«, sagte Meir Heller über Kafka, »sollten sein Erbe [und] seine Manuskripte unserer Ansicht nach hier im jüdischen Staat verbleiben.« Auch Ehud Sol (von der angesehenen israelischen Anwaltskanzlei Herzog, Fox und Neeman), gerichtlich bestellter Verwalter des Brod-Nachlasses, argumentierte, das Gericht müsse, wenn es zwischen Marbach und der Nationalbibliothek entscheide, auch Kafkas und Brods Haltung »zur jüdischen Welt und zum Land Israel« berücksichtigen, ebenso wie Brods Haltung zu Deutschland nach der Schoah. Die Frage, wie wichtig Brod und Kafka das jüdische Volk und seine politischen Ziele waren, sollte sich für den Prozess – und für die Urteile der Richter – als entscheidend erweisen.