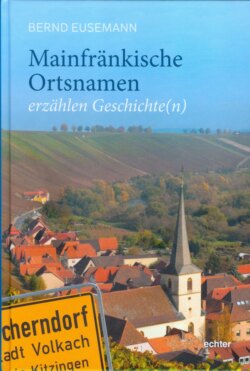Читать книгу Mainfränkische Ortsnamen erzählen Geschichte(n) - Bernd Eusemann - Страница 6
Main-Franken-Babel
ОглавлениеWenn Wolf-Armin Freiherr von Reitzenstein richtig liegen sollte, wenn! – so verbürge sich hinter dem hierin eher unverdächtigen Ortsnamen Eltmann – der Main. Nicht hingegen im diesbezüglich scheinbar so klaren Mainberg. Wie das?
Eltmann – am östlichen Rande Mainfrankens, beinahe schon Bambergisch – taucht in Urkunden des 12. Jahrhunderts auf als Eltimoin oder auch Eltemoin. Ebenso Eltimoin in jüngeren Kopien, die sich gar auf Belege des 8. Jahrhunderts beziehen. Daraus lesen Namenforscher einen Ort am alten Main oder meinen – ganz gelehrt –, es habe ursprünglich althochdeutsch ‚ze demo altin Moin‘ geheißen. Überliefert ist das freilich nicht, weder mündlich noch gar schriftlich. Reitzenstein übernimmt diese hypothetische, aus dem Namen erschlossene althochdeutsche Form und folgert, man könne für den Ort als Erklärung an einen Arm des Maines denken oder eine Verlagerung des Mainbetts. Die Sache mit dem Main klingt jedenfalls sprachlich plausibel. Um den kümmern wir uns gleich. ‚Altin‘ oder ‚alt‘ hingegen hat so seine Tücken. Alt nämlich meint in Ortsnamen durchaus nicht immer alt.
Mainberg – oberhalb Schweinfurts am Main gelegen – taucht 1245 urkundlich auf als Maienberg und 1303 als Meinberch. Demnach handelt es sich um einen ursprünglichen Burgnamen, folgert Reitzenstein, indem er den Berg im Namen als befestigte Anhöhe deutet. Als Namengeber sieht er einen ‚Mago‘, vorsichtig relativierend mit „wohl“, da er den Personennamen nur in den Ortsnamen hineinlesen kann. Ein irgendwie verbindendes Glied zwischen beiden findet sich nämlich nicht. Auf ähnliche Weise versuchten sich vor ihm schon andere und bemühten ein altes Wort für stark: megin, ersatzweise einen damit gebildeten Personennamen: Magino in der männlichen, Meginbirg in einer weiblichen Version. Mainberg meine also: der starke Berg. Oder doch lieber: der Berg, die Burg des Magino? Wieder andere wollten dahinter ‚Meien‘ gleich Birken sehen; oder doch ganz banal: Main.
Mainfränkisches Babylon, Turmbau zu Babel in Mainfranken: Ortsnamen deuten wirkt zwar nicht gerade wie ein gotteslästerlicher Akt, Sprachverwirrung befiel manche Namenbaumeister aber doch. Und dann gibt es Lehrmeinungen, Schulen. Wolf-Armin Freiherr von Reitzenstein, ein Zeitgenosse, ist der altehrwürdigen Namenforschung verpflichtet. Der gelernte Philologe und Historiker neigt der Volksetymologie durchaus zu und zeigt ein gewisses Faible zum Antikisieren. Den volkstümlichen Erklärungen gibt er gerne Vorrang und sucht hinter den meisten Ortsnamen tapfer einen Gründer als Namengeber. Er war Lehrer an einem Humanistischen Gymnasium in München, Jahrzehnte rührig in der Bayrischen Namenforschung, gewissermaßen eine Institution. Eine Reihe von Büchern über Ortsnamen in Franken und Bayern aus seiner Feder sind als Quelle früherer Formen von Ortsnamen nützlich. Auch dann, wenn man seinen Deutungen nicht folgen mag.
Richten wir unsern Blick auf zwei Orte, die den Frankenstrom unverhüllt im Namen tragen, aber dennoch zur Begriffsverwirrung passen: Mainbernheim und Mainstockheim. Beiden hat man den Main in der Zeit um 1300 vorangestellt, bis dahin ging es ohne: Offenbar sorgten sich Kanzlisten um Verwechslungen und wollten Klarheit über die Lage schaffen. Dabei liegt Mainbernheim fernab vom Main, fast am Westhang des Steigerwalds. Seinen Zusatz hat es als Besitz der Markgrafen von Ansbach bekommen, zur Unterscheidung weiterer Bernheims in ihrem Machtbereich. Vielleicht verstanden die den Main ja schon damals strategisch, denn 1448 kauften sie Marktsteft, an dessen Ufer gelegen, und bauten es zur Handelsniederlassung aus. Weil es 1216 Stephe hieß, liest es Peter Schneider „zum heiligen Stephan“ und schreibt den Ortsnamen dem Kirchenpatron zu.
Der 1958 verstorbene Peter Schneider, auch er übrigens Gymnasiallehrer, veröffentlichte in den Fünfzigerjahren zwei Bücher über den Steigerwald und die Vorlande zum Main. Seiner Deutung der Ortsnamen traut man besser nicht immer, obwohl er Kritikern zu bedenken gibt, er habe über „die meisten der vorkommenden Namen schon seit mehr als einem Menschenalter nachgedacht“. Mainbernheim deutet er als „Heim des Bero“ wegen einer Urkunde von 889, die sich freilich auf Burgbernheim bezieht – schreibt Reitzenstein, der den ‚Bero‘ beibehält, dafür aber nur allgemeine Namenbücher als Zeugen rufen kann. Volkstümlich taucht statt des ‚Bero‘ gerne der Bär auf, den die Stadt auch im Wappen führt. Im 19. Jahrhundert sah die Namenforschung dort einen Bärenstand als Namenlieferanten, sie dachten da wohl an wackere Franken bei der Bärenhatz. Die Fehldeutung hat eine lange Tradition. Kein Geringerer als Kaiser Wenzel hob den Bären aufs Wappenschild, als er dem Ort 1382 die Stadtrechte verlieh. Mainstockheim oberhalb Kitzingen hingegen liegt wirklich am Main. Mal erklärte man es mit Mainstöckich, mal mit Baumstümpfen, die beim Roden zum Vermodern stehenblieben. Darauf kommen wir am Ende dieses Kapitels noch einmal zu sprechen. Jetzt aber endlich der Main!
MOENVS: Durchaus witzig liefert uns Reitzenstein den Main in solchen Lettern, wie er Anfang des 1. Jahrhunderts in einer römischen Inschrift auftauchte. Nun ist das zwar der erste Beleg für unseren fränkischen Strom, aber ‚Moenus‘ stammt nicht ursprünglich aus dem Lateinischen, die Römer haben lediglich einen älteren Namen übernommen. Liebhaber alles Keltischen halten ihn gern für keltisch. Und sicherlich ging er über keltische Zungen, schließlich lebten sie lange genug in dieser Gegend. Der Frankfurter Ludwig Braunfels, er brachte es nach bewegten Jahren zum erfolgreichen Anwalt, schrieb im 19. Jahrhundert über unsern Main: „Will ihn jemand vom keltischen ‚mogin‘ = Schlange ableiten – wir haben nichts dagegen, obwohl uns wahrscheinlicher dünkt, dass er deutschen Namens sei.“ Er glaubt dahinter eine alte Wortgruppe ‚meg‘ (mag, mog): groß, stark. „Indessen mag ein jeder davon halten, was ihm gutdünkt“, meint er ganz entspannt, „denn dergleichen Deutungen gelangen ohnehin nie zur Gewißheit.“ So gelassen geht es unter Namenforschern selten zu.
Kamen nach den Kelten Germanen an den Main, so lebten lange vor jenen ebenfalls Menschen hier, die einen Namen für ihn hatten. Gewässernamen gelten als älteste uns noch zugängliche Schicht. Überaus zählebig, scheinen etliche viele Jahrtausende alt. Alteuropäisch nennt die Forschung solche Namen, wobei der Begriff allerdings etwas irrlichtert, nicht einheitlich angewandt wird. Es gibt sie ähnlich in ganz verschiedenen Gegenden Europas. Sie müssen also schon zu Zeiten entstanden sein, als man einheitlich sprach, bevor sich Einzelsprachen bildeten: also auch Keltisch und Germanisch. Diese beiden gehören zur Gruppe der indogermanischen Sprachen, wie die weitaus meisten anderen europäischen Sprachen auch und wie einige asiatische Sprachen. Neben indogermanisch hat sich auch der Begriff indoeuropäisch eingebürgert. Ich verwende sie gleichberechtigt. Nun braucht jede Sprache auch Sprecher. Ohne das Indogermanenproblem auswalzen zu wollen, sei kurz gesagt: Vor etwa sechstausend Jahren lebten in Europa Menschen mit einheitlicher Sprache, Urindogermanisch sozusagen. Und: Vor ihnen bevölkerten andere den Raum, mit ihrer eigenen Sprache. Selbst von dieser – noch älteren – glauben Forscher Reste in unserer Namenwelt zu erkennen.
Der 1956 verstorbene Heimatdichter Eduard Herold, noch ein Gymnasiallehrer, schrieb über den ‚Mee‘, für die Mainleute sei das eine Art Urbegriff: „Mee ist eben Allgemeinbegriff des Wassers, jeden Wassers, besonders aber des strömenden Wassers, sei es klein oder groß.“ Selbst Buben könne man im Angesicht fremder Rinnsale sagen hören: „Dia hömm ober an kleena Mee!“ Am Oberlauf sagen sie übrigens ‚Maa‘. Und am Unterlauf, in der Rhein-Main-Ebene, nun ja: ‚Moo‘ zu schreiben, träfe es nicht; es ist ein dumpfer Laut zwischen a und o; mit Sonderzeichen ließe er sich darstellen, nicht jedoch mit dem gewöhnlichen Alphabet. Grundproblem aller Schreiber, bevor Schreibweisen festgelegt waren, und gerade der ersten Schreiber, welche zuvor nur Gehörtes zu Papier brachten: Sprache ist eben mündlich, und Namen können aus verschiedenen Mündern höchst unterschiedlich klingen. Keine Überraschung also, wenn Schreibungen oft krass voneinander abweichen; aber eine Herausforderung für die Namenforschung.
Was also sagt nun die Wissenschaft zum Main? Ich weiß nicht, ob Herold sich damit je beschäftigt hat. Aber seine volkskundlichen Betrachtungen zum ‚Mee‘ sind in dem Zusammenhang schon sehr bemerkenswert. Denn immerhin darüber besteht in der Namenkunde weitgehend Einvernehmen: Die ältesten Gewässernamen – sie bestehen meist aus einer Silbe – bezeichnen immer das Wasser selbst, eine mit ihm verknüpfte Eigenschaft. Damit sind wir die Schlange los, die ihre Urheber ob der Form des Mainlaufes – Maindreieck, Mainviereck – ersannen: gewunden wie eine Schlange. Für keltisch erachten ihn gleichwohl viele: Erstens folgen Main und Rhein – der ebenfalls keltisch sei – sprachlich dem gleichen Bildungstyp; zweitens fließt auch in Irland ein ‚Maín‘, ‚Maoin‘. Aber: Im Baltikum finden wir ein lettisches Wort ‚maina‘ für Sumpf.
Allweil spannend ist es nun, nach indogermanischen Wurzeln zu suchen, die hinter solcher Vielfalt stecken. Diese Wurzeln kann man sich als einfache, urtümliche Elemente vorstellen, die dann in den einzelnen Sprachen der indogermanischen Gruppe Wörter bildeten. Eine beträchtliche Zahl der Wurzeln ist begrifflich verbunden mit: feucht, sumpfig, modrig, fließen, entspringen. So kennen die Wörterbücher eine indogermanische Wurzel ‚mā-no-‘, ‚mā-ni-‘ im Sinne von feucht und nass, die zum altirischen Wort ‚moin‘ für Moos und Sumpf, auch Torf leitet. Doch kennen sie ebenso eine Wurzel ‚mei-‘ im Sinne von wandern, gehen; sie steckt hinter Flussnamenwörtern wie mein-, moin-, min- und trug zur Bildung vieler Flussnamen bei. Manche sehen hier die sprachliche Quelle des Mains. Vorne dreht sich der Forscherdisput um Fragen, ob etwa ein kurzer oder ein langer Vokal zu diesem oder jenem Worte führt. Dahinter geht es ganz menschlich auch darum, ob wir die Welt als modrigen Sumpfpfuhl sehen oder lieber erhaben: der Main ein mooriges Wasser oder ein stolzer Strom?
Mit sprachlichen Mitteln allein wird sich der Gegensatz niemals lösen lassen. Die wirkliche Welt bietet beides, das Faulige und das Schöne. Die Namenwelt bildet es ab. Deutung schließlich liest nicht nur heraus, sondern legt auch hinein: Mit vernünftigen Annahmen zwar, die mehr oder minder plausibel, jedoch allesamt vorwissenschaftlich sind: Es liegt nahe zu glauben, die frühen Benenner hätten Eigenschaften wie gutes und schlechtes Wasser, fruchtbaren Boden oder morastigen Grund benutzt; eine andere Frage ist die nach Beweisen. Ebenso verständlich der Versuch, Namen mit Personen zu verbinden; allein, wo bleiben die Belege? Solche Fragen werden uns beschäftigen.
Mainfranken umschreibt – ja, was? Klar, für Schoppenfreunde: Mainfranken ist Weinfranken. Doch sonst? Zeigt sich Mainfranken als Kunstprodukt: Ganz wörtlich, ein Professor erfand das Wort, um eine Kunstlandschaft zu fassen. Das war während der 1920er Jahre. Nicht lange danach benutzten die Nationalsozialisten den Begriff für ihre Neuordnung der deutschen Lande. Nun bezeichnete er ein Gebiet, eine Raumschaft, eine Verwaltungseinheit. Heute deckt sich Mainfranken ungefähr mit dem weniger prosaischen Unterfranken, das mit Ober- und Mittelfranken Bayerns Norden krönt.
Über den Main haben wir gesprochen. Wie steht es nun mit Franken? Nun ja, wird man sagen, als die Franken ihr Reich westlich des Rheins gefestigt hatten, lockte der Osten. Die Merowinger, dann die Karolinger eroberten das Land um den Main. Das Gebiet und seine Bewohner bildeten freilich keine Einheit in den damals gebräuchlichen Bezeichnungen. Erst allmählich bürgerte sich Franken als Name für die Region ein. Darin liegt sogar eine besondere Ironie: Obwohl die Franken nicht von hier stammten und sich ein europaweites Reich eroberten, blieb ihr Name gerade an unserm kleinen Raum haften. Was aber bedeutet nun das Wort?
Franken sind schnell fertig: ‚frank‘ meint frei, der Franke ist der Freie, die Franken die Tapferen und Stolzen. Ach ja, wer schmückt sich nicht selber gern? Solche Erklärung bieten selbst die Gelehrten. Doch ganz gemütlich ist denen dabei nicht. Deswegen finden wir meist verschämt: Es meine „wohl“ frei. Sicher wissen wir nur: Es waren die Römer, die einen bunten germanischen Haufen so nannten. Um 250 tauchen die Franken in den schriftlichen Quellen auf, am Niederrhein hausend. Wie sie auf den Namen kamen, hinterließen uns die Römer nicht. Manche vermuten, sie hätten ihn von Kelten gehört. Jedenfalls ist es, von den Franken aus betrachtet, eine Fremdbezeichnung: Sie übernahmen diese, nachdem aus Einzelstämmen so etwas wie ein Volk gewachsen war. Trotz mancher Versuche, dem Namen eine germanische Basis zu geben, gilt er vielen Forschern als ungeklärt. Die Franken suchten selber schon früh ihre Herkunft zu ergründen. Und landeten – sich selbst überhöhend – im Mythos: Abkömmlinge der Trojaner wollten sie sein, wie zuvor schon die Römer, von denen sie so viel übernahmen, als deren rechtmäßige Erben sie sich verstanden.
Nun zeigen indogermanische Wörterbücher für Völkernamen oft Ableitungen von Wasserwurzeln: Völker werden damit Sumpfbewohner, provozierend gesagt. Obwohl in grauer Vorzeit, als man sie so benannte, damit vielleicht allein eine Herkunftsbezeichnung gemeint war. Die sehr viel jüngeren Familiennamen folgen dem gleichen Schema: Etliche weisen ihren Träger als – ursprünglichen! – Siedler am Sumpf oder Gewässer aus. So sieht Hans Bahlow auch die Franken. Er fährt eine ganze Reihe an Orts- und Gewässernamen auf, die nach seiner Überzeugung ‚frank‘ als verschollenes Wort für Wasser und Sumpf erweisen. Die Franken seien in lateinischen Schriften direkt so geschildert worden: „zwischen unwegsamen Sümpfen wohnend“, denen der Rheinmündung nämlich. Wäre man als Franke letztlich eine Sumpfpflanze, bräuchte man sich gleichwohl nicht herabgewürdigt fühlen: Vor den Sümpfen hatten die Römer höllischen Respekt; sie waren ein wichtiger Verbündeter der Germanen, als sie die römischen Legionen vernichtend schlugen, bei aller Tapferkeit.
Hans Bahlow – kein Lehrer – gilt im Kreise teutomaner Namenforschung als Unperson. Germanist von der Ausbildung, arbeitete er an den Universitäten Rostock und Hamburg als Bibliothekar. Er entwickelte eine Methode des Vergleichens, um verklungenen Wurzeln und dem Sinn alter Namen auf die Schliche zu kommen. Sie fand heftige Kritik. Ernsthafte Auseinandersetzung mit Inhalten suchte die traditionelle Namenforschung aber nicht gerade. Freilich wirkt sein Hauptwerk über „Deutschlands geographische Namenwelt“ fast privat, so schwer macht er es den Lesern. Quellen und Literatur fehlen meist, die Systematik ist nicht gerade eingängig. Lässt man sich aber darauf ein, ist es ungemein anregend. Prüfen muss man immer: Bei ihm wie bei den Traditionalisten. Bahlow starb 1982. Seine Gegner überzogen ihn noch postum mit Hohn. Die Pein scheint wirklich groß.
Kurz sei an jene Orts- und Örtlichkeitsnamen erinnert, die sich mit Franken schmücken. So wenige sind es nicht, darunter auch Gewässer. Gehen die wirklich alle auf freie Franken zurück, oder liegt nicht bei manchen das Wasserwort ‚frank‘ näher? Bei Frankenried und Frankenau, gleich mehrfach vorhanden, wäre das schon zu prüfen. Wir beschränken uns aber auf einen Ort in unserem Gebiet, der – zwei Volksnamen verknüpft. Wirklich? Frankenwinheim, schon Mitte des 8. Jahrhunderts in Urkunden genannt, bei Gerolzhofen gelegen. Damals war es noch frankenlos und blieb es lange. Erst 1574 tauchte der Zusatz auf: Franckenwindtheim. Die ältere Namenforschung sah, immer gern martialisch: Wendenheim, den Franken unterworfen. Die jüngere bleibt zwar bei den Wenden oder Slawen; Franken habe man lediglich unterscheidend zum Ort Burgwinheim bei Bamberg beigefügt.
Nun liegen bestimmt die Hälfte der Orte mit „win / wind“ und Varianten in Gegenden, wo niemals Wenden weilten. Auch das Land zwischen Steigerwald und Main bleibt westlich ihres Verbreitungsgebiets. Mit Bahlow könnten wir an ‚wind‘ mit seinen Spielarten ‚wend‘ und ‚wand‘ denken, ein prähistorisches Wort für Wasser, Sumpf, Moor: das schon Wilhelm von Humboldt erkannt habe! Schick, sich auf den Begründer der vergleichenden Sprachwissenschaft zu stützen. Grob gesagt verkörpert sie das Konkurrenzmodell zum Germanistenansatz, tunlichst alles deutsch zu erklären. Vergleichend meint eben auch, für Namenforscher sei es hilfreich, außer Deutsch wenigstens eine weitere Sprache zu beherrschen. Humboldt war mit einem guten Dutzend vertraut.
Kommen wir also, wie versprochen, noch einmal auf Mainbernheim und Mainstockheim. Im ersten erkennt Bahlow weder einen ‚Bero‘ noch den Bären, sondern ein prähistorisches Wasserwort ‚ber‘ für Schlamm und Morast. Es hätte sich demnach um eine Siedlung am Sumpf gehandelt. Im zweiten sieht er stagnierendes Wasser, wie es sich im Wort stocken zeigt, und keine Baumstöcke. Fern dem Getriebe der Fachgelehrten halten wir es mit Ludwig Braunfels und lassen alle glauben, was ihnen dünkt. Um die Existenz verschiedener Denkmodelle sollten sie aber schon wissen.