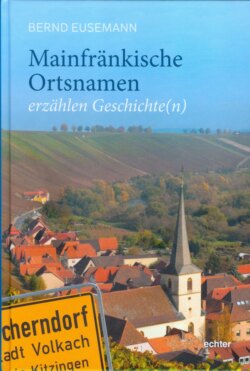Читать книгу Mainfränkische Ortsnamen erzählen Geschichte(n) - Bernd Eusemann - Страница 8
Mainfränkisches Gelächter
ОглавлениеNamen sind eine todernste Sache. Wie sonst wäre das Hauen und Stechen der Forscher verständlich. Als gälte es dem Innersten der Welt und was sie dort zusammenhält, wo es nur um Namen geht. Nur? Deren Geheimnis zu lüften, ihren verborgenen Sinn aufzuspüren, das kann einen Kopf schon in Beschlag nehmen. Bis sich im einen oder andern Kopfe die Schlüsse nur noch im Kreise drehen, Gefangene der eigenen Thesen, denen man zur Not auch mal die Vernunft opfert: Hauptsache, wir kriegen es passend. Da wird es rasch zum Bierernst.
Namen sind die heiterste Sache der Welt. Wie sonst ließe sich der Erfolg solcher Bücher erklären, die in der Namenlandschaft wildern mit dem Ziel, lustige Namen herauszupicken zum Gaudium ihrer Leserschaft. Lachen sei schließlich gesund. (Hängt aber davon ab, ob man zu den Lachern gehört oder unter die Verlachten zählt.) Tatsächlich ist Spott unter Nachbarn nicht gerade selten, verulkt man Einwohner gern wegen ihres Dorfnamens: zu dem sie freilich nicht einmal etwas können und der fast nie das bedeutet, was die Spötter in ihm sehen wollen.
Natürlich kennt auch Mainfranken seltsame Ortsnamen. In der eingedichteten Deutung scheinen manche sogar lustig. Lauschen wir also mainfränkischem Gelächter. Zum Beispiel Fritz Dunkel und seiner nicht ganz bierernst gemeinten „Rhöner Ortsnamenkunde“, wo er vor sieben Jahrzehnten en passant das Deutungshickhack auf die Schippe nahm: „Darüber sind wir in der Rhön schon lange erhaben“, wischt er den Gelehrtenstreit beiseit und hebt die Namen mit biblischer Anleihe auf eine Ebene, wo sie nach „Herkunft und Deutung unanfechtbar“ seien. Das Stückchen schreibt er Noah zu, der mit seiner Arche nicht in Armenien am Ararat gestrandet sei, sondern in der südlichen Rhön. Erster Seufzer: „So, den Berg hätten wir!“ Schon hat Noah dem Sodenberg an der Saale den Namen verpasst. Dann trotteten und krochen, flogen und krabbelten seine Tierpassagiere von Bord. Faule blieben in der Nähe, die Ehrgeizigen trieb es weiter, jedenfalls richteten sie sich alle doch irgendwo ein. Und gaben dem jeweiligen Ort seinen Tier-Namen: Kühsinge und Roßbach, Hammelburg und Hundsfeld, Fuchsstadt und Katzenbach, Motten und Schnackenwerth und wie sie sonst noch heißen.
Tatsächlich foppt uns eine beträchtliche Zahl an Orts- und Flurnamen, Berg- und Gewässernamen mit Tieren oder Pflanzen als Bestimmungswort. Darunter versteht man jenen Bestandteil, der das Grundwort näher bestimmt, seine Eigenschaft beschreibt: So werden dann eben zum Beispiel die vielen, vielen Roßbäche als Bäche gesehen, wo Rosse grasen. Manchmal mögen diese Deutungen sogar stimmen. Oft aber haben spätere Generationen die netten Tierchen und hübschen Pflänzchen einfach hineingedichtet, weil sie ein anderes, ursprüngliches Bestimmungswort nicht verstanden. Auf die Art entwickelte sich mancher Ortsname zu heutiger Form. Weil aber die meisten Menschen alles eins zu eins wörtlich nehmen, erklärt man sie auch gerne so und sucht nicht lange nach einem verborgenen, eigentlichen Sinn. Volksetymologie nennt man das. Die werfen sich Wissenschaftler schon mal gerne gegenseitig vor. Und treffen nicht selten ins Schwarze.
Lauschen wir einer weiteren hübschen Geschichte, die Fritz Dunkel erzählt: über den Drasenberg und die beiden Weiler Gomfritz und Sterbfritz an seinen Hängen. Ein Reiter ruft seinem kranken Pferd aufmunternd zu: „Gomm Fritz! Gomm Fritz!“ Es schlepptt sich noch über den Berg, wo es kraftlos niedersinkt. Da bleibt ihm nur noch zu sagen: „Sterb Fritz! Sterb Fritz!“ Volksetymologie reinsten Wassers. Klassisch verbrämt noch dazu, wie der Drasenberg zum Namen kam: Dort sei der römische Feldherr Drusus vom Pferd gestürzt, der ursprüngliche Name also Drusenberg gewesen. Hübsches Geschichtchen. Klassische Bildung kann aber wirklich mehr.
Die germanistisch geprägte Erklärung sieht in Sterbfritz die Siedlung eines Starkfriedes. Getreu der Deutungsmode, die Personennamen sucht, hinter denen man eine Gründerpersönlichkeit wähnt. Das mag hin und wieder zutreffen. Die ersehnten Urkunden hierüber fehlen fast immer. Übrigens haben wir es hier mit einer Untergruppe zu tun, wo das Grundwort wegfiel, also etwa hausen oder heim: Geblieben sei der Personenname, noch an den alten Zusammenhang erinnernd: Starkfriedeshausen, des Starkfriedes Haus, zu den Häusern Starkfrieds. Der Herd dieses Ortsnamentyps liegt von Fulda bis ins Land um Meiningen. Geortet hat ihn Mitte des 19. Jahrhunderts Ernst Förstemann. Das Werk des Altmeisters deutscher Namenforschung ist bis heute allgegenwärtig, trotz unbestrittener Mängel aus neuer Sicht. Die traditionelle Deutung beruft sich unbeirrt auf ihn, obwohl auch in diesem Lager mit Leidenschaft über eine Revision vielfach debattiert wurde. Förstemann selbst hatte schon darauf hingewiesen, es seien vorgermanische Einflüsse noch nicht genügend untersucht.
Zu nämlicher Zeit erzählte Ludwig Braunfels in seinem Buch über „Die Mainufer und ihre nächsten Umgebungen“ von scherzhaften Ortsnamen: Als einem Würzburger Fürstbischof auf der Hasenjagd das Langohr entwischte, seufzte er: „Has furt“ – und ließ an jener Stelle Haßfurt errichten; als er hernach zwei Löffel erspähte und den Hasen darunter wähnte, erregte er sich: „Der is! Der is!“ – was ihn zur Gründung des Klosters Theres animierte; endlich entließ er seine erschöpften Jäger: „Geht heim!“ – woran Gädheim erinnere. Da berühren sich Volksetymologie und Namenforschung: Auch diese bezieht in ihre Deutungsversuche mundartliche Formen mit ein.
Betrachten wir ein paar Ortsnamen aus einem Klassiker: „Unterfränkisches Orts=Namen=Buch“ von Anton Schumm. Die zweite Auflage erschien 1901. Anders als der augenzwinkernde Fritz Dunkel und der heitere Reisende Ludwig Braunfels versteht Anton Schumm sein Werk durchaus ernst, hegt wissenschaftlichen Ehrgeiz. Greifen wir einige Beispiele heraus, die es zu gehöriger Prominenz bei Lachern wie Deutern gleichermaßen brachten.
Das köstliche Gückelhirn beispielsweise, ein kleiner Weiler, heute zu Maroldsweisach gehörig. Bei Schumm finden wir die Siedlung in den Haßbergen als Gickelhirn genannt. Er liest das hirn als ‚horn‘ oder ‚hürn‘, was eine vorspringende und wenig bewaldete Bergspitze meine; den ‚gickel‘ stellt er zu ‚cucullus‘, verrät uns aber leider nicht, warum er aufs Lateinische verfällt; als Bedeutung werden wir mit Gugel und Kaputze überrascht: Schumm interpretiert den Ortsnamen als einen Bergvorsprung, der wie eine Kaputze aussieht. Das würde man sich doch gerne bildlich vorstellen. Vielleicht stieß Schumm ja in Grimms Wörterbuch der Deutschen Sprache auf Gugel, denn dort findet sich hierfür die Ableitung von ‚cucullus‘. Wenn man denn schon dieses ‚cucullus‘ ernst nehmen wollte, könnte man ein wenig weiterspinnen: Es kam offenbar als gallisches Lehnwort in die lateinische Sprache, und Mainfranken war Keltenland. Wäre da die Suche nach einem keltischen Wort nicht lohnender?
Als früher Sammler in solchen Gefilden zog sich Franz Josef Mone gar eine „rügende Abmahnung“ von Jacob Grimm zu, dem Übervater der Germanistik. Wir trauen uns trotzdem einen Blick in seine „Celtische Forschungen zur Geschichte Mitteleuropas“ aus dem Jahre 1857. Da erklärt er gückel als germanisierte Form eines keltischen Wortes, wie es im irischen coiche vorliegt. Demnach trägt es die Bedeutung: hoher Berg, und es findet sich in weiteren Ortsnamen. Nennen wir hier nur Gügel: Die Kapelle nahe dem oberfränkischen Scheßlitz liegt auf schroffem Fels, der zuvor schon eine alte Befestigung trug; benachbart ragt die Giechburg auf einem Berg, der in der Jungsteinzeit und später von Kelten besiedelt wurde. Deutung in der Richtung bietet sich an. Der Vorwurf der „Celtomanie“, dem sich Mone ausgesetzt sah, hatte viel mit nationalen Gefühlswallungen zu tun: Sprachliche und historische Studien dieser Art kamen für manche einer Preisgabe „Teutschlands“ gleich.
Der studierte Philologe und Historiker Mone führte ein bewegtes Leben und hinterließ auf vielen verschiedenen Feldern bleibende Spuren. Selbstsicher zahlte er Grimm und Konsorten mit gleicher Münze heim und zieh sie der „Germanomanie“ in ihrem Eifer, sprachlich widerstrebende Namen auf Biegen und Brechen fürs Deutsche zu retten. Im Grunde zieht sich diese Front bis heute durch die Namenforschung. Das monumentale Werk Mones kann man nicht unbedenklich nutzen. Unsere linguistischen, historischen und archäologischen Kenntnisse sind seither beträchtlich gewachsen. Doch sein Ansatz bleibt inspirierend. Es ginge also um eine Würdigung und Bewertung mit dem heutigen Wissensstand. Gugel eben, in Schweizer Bergnamen nicht unüblich. Die Schweiz war keltisches Siedelgebiet durch und durch.
Hans Bahlow hat ebenfalls eine Erklärung, in seinem gewohnten Muster: ‚Guck‘ und ‚gug‘ erschließt er als bislang unerkannte Sumpfwörter, in den Wörterbüchern des alten Sprachguts nicht enthalten. Er führt sogar ein historisch verbürgtes Volk ins Feld, die am Niederrhein siedelnden Gugerni, offenbar keltisch. Es würde sich jedenfalls in dieses ganze Szenario fügen. Der weite Bogen von Hochrhön und Grabfeld bis zu den Haßbergen und darüber hinaus war einst ebenfalls von keltischen Stämmen besiedelt. Das belegen archäologische Funde, so mancher Ortsname legt davon noch immer Zeugnis ab – vielleicht auch Gückelhirn. Eine weitere Stütze sieht Bahlow im ‚hirn‘: Bestandteil vieler Orts-, Bach- und Flurnamen, steckt darin ‚hur‘ im Sinn von Schmutz und Morast; es bildet eine Variante zum Sumpfwort ‚hor‘, noch im Althochdeutschen lebendig. Und so wie ‚horn‘ eben nicht immer nur den Bergvorsprung markiert, meint ‚hurn‘ ebenfalls den Sumpf. Als Gugelhurne taucht Gückelhirn anno 1232 auch erstmals urkundlich auf.
En passant streiften wir einen wichtigen Ortsnamentypus: nach der örtlichen Gegebenheit. Wobei ganz alte Namen eher auf den Boden abheben denn auf Geländeformen – sagen Namenforscher. Tatsächlich entstanden ja viele Ortsnamen aus ursprünglichen Flurnamen. Für Ackerbauern ist die Natur der Böden wichtig. Für nomadisch lebende Viehzüchter spielen auch andere Kriterien eine Rolle. Siedelnden wie umherstreifenden Menschen gemeinsam war die überragende Bedeutung von Wasser: als unverzichtbares Lebenselement, als Leitlinie für Wanderbewegungen und Siedelplätze, als Bedrohung oder doch jedenfalls Hindernis in Form großer Moorgebiete.
Gewagt erscheint es, sich allein auf Sprachliches bei der Deutung von Ortsnamen zu verlassen. Für spezielle Fragestellungen geht es an, solange man weiß, was man tut. Ansonsten gehört der Blick auf die Örtlichkeit dazu: Liegt dort alles platt, zum Beispiel, drängt sich die Lesart Berg für Gugel nicht gerade auf. So einfach ist es meist freilich nicht. Dazu wäre Kenntnis nötig, wie es zur Zeit der Benennung am Orte ausgesehen hat. Trockenlegen von Sümpfen, Kahlschlag und Schwund von Wäldern, Bodenerosion durch Überweiden – die Landschaft ist seither völlig umgekrempelt. Wie also steht es nun um Gückelhirn? Nahebei wölben sich hübsche Erhebungen, möge man sich mit Schumm an Kapuzen erinnert fühlen oder nicht. Die Siedlung hingegen schmiegt sich in eine flache Mulde, die ehedem sichtlich feucht und morastig lag, wie das Quellmulden eben charakterisiert.
Benachbart finden wir weitere Örtlichkeitsnamen mit Wasserbezug, Todtenweisach gleich unterhalb etwa. Der als Totenwissa ebenfalls anno 1232 erstmals genannte Ort enthält das Sumpfwort ‚tot‘ oder ‚tod‘ und den Bachnamen ‚wisaha‘, bezeichnet eine versumpfte Lage am moorigen Bachlauf. Toten- und Todtenbäche plätschern in ganz Deutschland; erinnert sei hier lediglich an den Todtenbach im Schwarzwald mit der Ortschaft Todtmoos, die im Namen so schön das Sumpfige bewahrt. Solche Sprünge sind in der Namenforschung nicht nur erlaubt, sondern zwingend; die Analyse sprachlich offenbar verwandter Namen, vom gleichen Bildungstyp, erschließt oft erst den Sinn und bewahrt vor Fehldeutung aus isolierter Einzelbetrachtung.
Die Weisach, wie sie nunmehr heißt, gab dem heutigen Zentralort Maroldsweisach seinen Namen, 1118 als Landgut Wisaha genannt. Auf welch verschlungenen Wegen dieses – oder der? – Marold in die Urkunden des 14. Jahrhunderts fand, bleibt ein Geheimnis. Wenn traditionelle Namenforschung einen Personennamen wittert, aber keine belegte Person findet, sagt sie: „wohl“. Also ziemlich oft. So sei bei Maroldsweisach ein Maroald im Spiel. Wohl – dem der es glauben mag. Wir begnügen uns mit dem Hinweis auf Marbach nahebei, gelegen am Bächlein des Namens, das wenig weiter in die Weisach mündet, nicht ohne zuvor noch ein Lohr zu durchfließen: Wie jenes bekanntere am Main, genau. Doch da sind wir schon mittendrin in einem alten, langen, heftigen Grundsatzstreit der Namenforschung: dem Lar-Problem. Mit den alten Sumpf- und Wasserwörtern ‚lar‘ und ‚mar‘ und ihrer Zugehörigkeit zum Keltischen oder Germanischen oder noch älteren Sprachschichten werden wir uns später beschäftigen.
Keltomanie ganz eigener Art schwappt seit etlichen Jahren durch Europa. So suchen zum Beispiel unsere französischen Nachbarn daraus nationale Identität zu ziehen – Asterix und Obelix lassen grüßen. Durch deutsche Wälder trampeln maskierte Druiden, Scharen im Schlepptau und suchen Heilkräuter – Auswuchs besonderer Art der Ökobewegung. An wirklichen oder vermeintlichen keltischen Kultstätten sammeln sich Verzückte in besonderen Nächten und geben sich dem Zauber der Kraftorte hin – noch eine Mode spiritueller Sehnsucht und Sinnsuche. So Ihnen jemand von fünftausend Jahre alten keltischen Gefäßen erzählt und weiter, die Kelten hätten nichts Schriftliches hinterlassen: Dann gehen Sie besser auf Habacht. Denn vor fünftausend Jahren gab es noch keine Kelten, nicht sonstwo noch gar in Mainfranken. Ihre Zeit war die Eisenzeit, ihre Spuren finden wir im ersten vorchrislichen Jahrtausend. Das Keltische entstand aus dem Indogermanischen um 1000 vor Christus, sagen uns Sprachforscher; wie und wo genau, darüber streiten sie; ein Favorit ist die Gegend um Lyon am Westalpenrand. Und Kelten kannten Schrift, dazu liegt feine Forschung vor; nicht erst die Inselkelten in Irland und Britannien fingen mit dem Schreiben an; schon vor Christi Geburt gruben die Festlandkelten auf dem Kontinent Inschriften in Steine und Metallplatten, wie Funde aus Frankreich und Spanien zeigen. Sie enthalten – Namen!, sind für die Namenforschung besonders wertvolles Material.
Arme Hummel, oder: Wer martert wen? Schumm ist für viele Überraschungen gut, so wenn er beim Weiler Hummelmarter nicht an ein Marterle denkt, einen Bildstock als den Inbegriff fränkischer Volksfrömmigkeit. Er tippt auf: ‚mar‘ und ‚tar‘, übersetzt das erste als Quelle, das zweite als Baum, Gesträuch. Und findet so: „Ort am hummenden, infolge des Aufenthalts der Bienen summenden Gesträuchs.“ Damit wir’s glauben mögen, rät er zum Vergleich mit dem Hummenwald. Tatsächlich gibt es im deutschsprachigen Raum etliche Ortsnamen mit hummel und hummen oder, noch mehr vereinfacht, Bildungen mit: ‚hum‘, wie ‚hun‘ ein Moorwort. Ohnehin rührt Schumm an den tieferen Sinn, wenn er bei Hummelmarter die Wurzel ‚mar‘ als Quelle ins Spiel bringt. Sie steht allerdings eher für den Quellsumpf als für eine klar sprudelnde Quelle, steckt im gallischen Wort ‚mercasius‘ und blieb erhalten im fanzösischen ‚marais‘, was eben Sumpf und Moor und Morast bedeutet.
Beim schönen Waldfenster erinnert sich Schumm an eine ältere Schreibweise: Waldmannsloch. Er folgt namenkundlicher Methodik, wonach man von der ältesten Form eines Namens ausgeht – und möglichst die ganze Kette der folgenden Schreibweisen im Blick behält. Macht Sinn, zeigt sich in der Praxis aber als dehnbar. Selbst in der Fachliteratur wird das Rohmaterial nicht immer in der Form gereicht, die ein Urteil über die Interpretation erlaubte. Beim Waldfenster greift sich Schumm das ‚loch‘ in einer Bedeutung ‚lueg‘ und versteht dies als Auslug. Eigenwillig, erst recht die Conclusio: „Als der alte Ausdruck fiel, ersetzte man ihn sinnrichtig mit Fenster.“ Wenn schon ‚loch‘ und ‚lueg‘, so hätte er besser über die indogermanische Wurzel ‚lug‘ an schwärzlichen, sumpfigen Boden gedacht. Das wäre überzeugender, zumal dem Walde selbst sprachgeschichtlich das Feuchte innewohnt. Zum Fenster gab es auch Überlegungen, ob sich darin nicht ebenfalls der Sumpf versteckt: ‚fen‘ lautet ein englisches Wort für Moor, und die sprachliche Gemeinsamkeit mit dem ‚Venn‘ liegt auf der Hand.
So ließen sich viele Seiten füllen. Wir könnten fragen, ob die Menschen in Kothen und Kurzewind, Fladungen und Reyersbach Probleme mit der Verdauung hatten. Da bringt man die Lacher schnell auf seine Seite. Hier ging es darum, wie merkwürdige Namen allerlei Deutung provozieren, wie der erste Anschein leicht in die Irre führt. Keinesfalls liegt mir daran, Anton Schumm vorzuführen. Er ist ein typischer Vertreter seiner Zeit, im Kuriosen wie mit treffenden Deutungen. Wir werden ihm auch weiterhin das Wort erteilen, denn für das Verständnis der Namenforschung selbst ist es allemal interessant. Er spukt mit seinen Erklärungen durch die fränkische Namenlandschaft, auch wenn die Nachschreiber meist vergessen, seinen Namen zu nennen.
Mainfränkisches Gelächter ohne Schlüpfrigkeiten? Doch, unsere Landschaft hat Frivoles zu bieten. Jedenfalls dann, wenn wir es in die Namen hineinlesen. Denn diese selbst sind durchaus unschuldig, sogar das lautmalerisch pralle Busendorf. Schumm stellt es zu einem althochdeutschen Wort ‚busc‘, womit aus dem Busendorf ein Buschendorf würde, eins am Gebüsch. Die Erklärung vermag nicht recht zu begeistern. Andere wollen im Busen verborgen einen wieder nicht bekannten Ortsgründer erkennen; oder beim Betrachten der Lage im Gelände springt ihnen eine sinnfällige Wölbung ins Auge; noch eine Variante hört ‚busen‘ und Variationen in Gewässernamen klingen, woraus man auf ein Wasserwort ‚bus‘ schließen möchte. Die Sache ist schillernd, denn wenn wir den Personennamen außen vor lassen, so findet sich vom Busen über den Hügel bis zum Feuchten ein gemeinsamer sprachgeschichtlicher Anschluss. Just in jener Gegend liegen weitere sprechende Ortsnamen, im Grenzbereich Mainfrankens, hart im Bambergischen. Sie fordern genaue Betrachtungen geradezu heraus. Später vielleicht. In einem andern Band über unsere Nachbarregion.
Lauschen wir an einem abschließenden Beispiel, wie sich Bierernst und mainfränkisches Gelächter treffen bei einer Namenverbindung, die Schumm gleich vierfach kennt: Poppendorf, Poppenhausen, Poppenlauer, Poppenroth. Den Jüngeren wird im Alltagsjargon das Poppen für ein gewisses Treiben vertraut sein. Allerdings wissen wir rein gar nichts über die Kraft der Lenden früherer Bewohner. Einen männlichen Gründer will die traditionelle Namendeutung aber schon erkennen: einen Poppo, auch Boppo oder Bobo. Laut Schumm bedeutet dieser Name: der junge Gebieter. Auf thüringische Ansiedelung weise er. Was mich betrifft, so weise ich hin auf den Poppengrund: kein Ort, sondern ein Tälchen, das Pfarrweisach gegenüber sich von der Weisach zum Simonskapellberg streckt. Statt nun auch noch für diesen Wiesengrund einen nirgends erwähnten Poppo zu vereinnahmen, denke ich mit Bahlow an Poppelsdorf am Rhein und Pappenheim an der Altmühl, womit sich für ‚pap‘ und ‚pop‘ ein Sumpfwort erschließt. Was Pappenheim und die Altmühl betrifft, so will ich diese überaus spannende Namenlandschaft gerne in einem Folgeband beleuchten. Selbst mit dem Kanalbau Karls des Großen zwischen Main und Donau können wir die Altmühl nicht Mainfranken zuschlagen.
Lassen wir es gut sein mit Anzüglichkeiten, bevor am Ende noch das weinselige mainfränkische in donnerndes Homerisches Gelächter ausartet. Falls jemand den Ausflug in klassische Gefilde völlig verfehlt findet, so gebe ich zu bedenken: Am Untermain war unsere Gegend länger von den Römern besetzt. Von Fall zu Fall hilft es, antike Wurzeln in Ortsnamen zu erwägen. Auch konnten es spätere Generationen nicht lassen, immer mal wieder im Rausch etweder Moden Namen zu latinisieren, zu gräzisieren. Also: Wie uns der Dichter Homer in seiner Ilias und in der Odyssee erzählt, brachen die griechischen Götter bei zwei Anlässen in unbändiges Lachen aus: als sie einen veritablen Ehekrach zwischen Göttervater Zeus und seiner Hera mitbekamen; und als sie Aphrodite mit Ares munter in ehebrecherischem Treiben sahen – gefangen im Lotterlager durch ein Netz aus Blitzen, ausgelegt vom gehörnten Hephaistos, Gott des Feuers und der Künste, Gemahl der Aphrodite. So ging es zu auf dem Olymp, dem verlotterten. Aber doch nicht in Franken!
Obwohl: Denk ich an Amorbach –