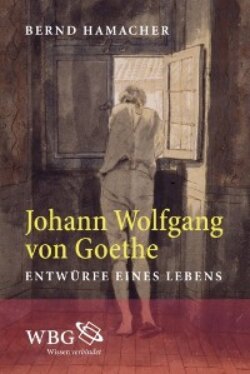Читать книгу Johann Wolfgang von Goethe - Bernd Hamacher - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Herkunft und Anfänge – Lebens- und Karrieregestaltung
ОглавлениеInwiefern Goethes Leben zu einem paradigmatisch modernen Leben werden konnte, ja geradezu werden musste, lässt sich im Blick auf seine Herkunft veranschaulichen – und damit in einem ersten Anlauf der Bogen von der Musterhaftigkeit zur Einzigartigkeit schlagen. In älteren Darstellungen stand statt einer Erklärung häufig die Verehrung, auch hierin, wie so oft, mehr oder weniger uneingestanden Goethe selbst folgend: „Hab ich dir das Wort / Individuum est ineffabile / woraus ich eine Welt ableite, schon geschrieben?“ (FA II 2, S. 300). Diese Maxime aus einem Brief an Lavater (vermutlich vom 20. September 1780), deren Herkunft unklar ist und die daher durchaus von Goethe selbst geprägt sein könnte, besagt, dass das Individuum unaussprechlich, sein Wesen nicht in Worte zu fassen sei. Entsprechend verfuhren dann viele Goethe-Darstellungen, wenn es um das Wesen des Dichters ging. Noch 1955 schrieb Günther Müller: „Wir kennen den Stammbaum Goethes bis ins sechzehnte Jahrhundert […]. Aber die Geburt des Genius läßt sich aus den Bedingungen des Erbgangs so wenig ableiten wie aus den geschichtlichen Zuständen. Sie gehört in das Mysterium des Tatsächlichen als eine Tatsache, die wir nicht weiter erklären, die wir nur ehrfürchtig feststellen können.“1
Ganz so unerklärlich ist das ,Phänomen‘ Goethe – individuelle Anlagen hin, Genius her – indes nicht.2 Vielmehr wird sein Auftreten durch ein spezifisches sozialgeschichtliches Bedingungsgefüge ermöglicht. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts lebte in Thüringen ein Hufschmied namens Geede, die Schreibung von Namen variierte zu jener Zeit noch, und in dieser Form ist die thüringische Lautung ausgedrückt. Sein Sohn ging als Schneidergeselle auf die Wanderschaft, zwölf Jahre lang, und kam auch nach Paris und Lyon. 1686 unterschrieb er nach der Heirat mit der Tochter eines Zunftmeisters das Gesuch um das Bürgerrecht der Stadt Frankfurt am Main mit Friedericus Georg Göthé. Nicht nur an den Stationen seiner Gesellentour, auch an der Schreibung des Namens ist die Orientierung am Vorbild Frankreich, der damals maßgeblichen europäischen Kulturnation, und damit seine Aufstiegsambition erkennbar. Seine zweite Frau, die er 1705 heiratete und für die es ebenfalls die zweite Ehe war, hatte von ihrem Mann einen Gasthof mit Weinhandlung in der besten Lage Frankfurts, auf der Zeil, geerbt. Göthé wurde zum Weinspekulanten, was sehr lukrativ war und ihm ein beträchtliches Vermögen zuführte. Zudem war das Gasthaus Haltestelle des Postkutschen-Linienverkehrs der sogenannten „Ordinari-Post“, also des ,normalen‘ Postverkehrs, bei dem die Passagiere aller Stände gleich behandelt wurden. Wirtshaus und Postkutsche waren Orte sozial riskanter Begegnungen – riskant deshalb, weil die Standesgrenzen stabil waren und es für den nicht vorgesehenen stände- und klassenübergreifenden Austausch keine durch Erziehung weitergegebenen sicheren Verhaltensprogramme gab. Im Schankraum und erst recht in der Kutsche ließ sich ein solches riskantes Aufeinandertreffen nicht immer verhindern. Auf dem Theater wurden derlei Ereignisse üblicherweise als Komödienszenen dargestellt.
Göthé hatte auf dem ,zweiten Bildungsweg‘ bzw. durch eine kluge Heirat die Weichen gestellt, um das Handwerkermilieu zu verlassen und sozial aufzusteigen. Als Wirt stand er ohnehin durch seine vielfältigen Begegnungen bereits potenziell außerhalb des Sozialgefüges. Dass er weiter nach Höherem strebte, erkennt man daran, dass sein Sohn Johann Caspar nach der Schule nicht in eine Handwerkslehre gegeben, wie es der konventionellen zunftbürgerlichen Laufbahn entsprochen hätte, sondern auf das Gymnasium in Coburg geschickt wurde. Damit war die Voraussetzung für die Juristenlaufbahn geschaffen, den höchsten Aufstieg in der Ständehierarchie, der einem Nichtadligen möglich war. 1730 nahm Johann Caspar Goethe – nun bereits in dieser teils wieder eingedeutschten, teils (durch die Umlautschreibung) latinisierten Form der Namensschreibung – sein Studium auf und folgte dem stereotypen Schema für höhere Staatsdiener. „Der Studienort mußte Leipzig sein, die teuerste und vornehmste der Universitäten, und das Fach mußte die Rechtswissenschaft sein, das teuerste, vornehmste und karriereträchtigste der Fächer.“3 Danach wurden drei ,Praktika‘ absolviert, deren Orte ebenfalls feststanden, nämlich an den drei Brennpunkten der Rechtspflege im Deutschen Reich: dem Reichskammergericht in Wetzlar, dem Ständigen Reichstag in Regensburg und dem Reichshofrat in Wien. Darauf folgte die sogenannte ,Kavalierstour‘ nach Italien mit Rückweg über Paris und Straßburg. 1741, im Alter von 31 Jahren, kehrte er mit der besten erreichbaren Ausbildung nach Frankfurt zurück. 1742 erwarb er durch Kauf den Titel eines ,Kaiserlichen Rates‘ und heiratete 1748 Catharina Elisabeth Textor, die älteste Tochter des Stadtschultheißen. Damit war jedoch seine Karriere unversehens zu Ende, der erhoffte weitere Aufstieg blieb aus. Johann Caspar Goethe wurde ,Rentier‘ bzw. Privatier, das heißt, er lebte vom väterlichen Vermögen und ging im Übrigen seinen Interessen nach. Die österreichische Kaiserin Maria Theresia hatte nämlich inzwischen den Kurs ihres Vorgängers Karls VII. geändert, so dass dem „Kaiserlichen Rat“ keinerlei kaiserliche diplomatische Geschäfte übertragen wurden und der Titel ein bloßer Ehrentitel blieb, was bei seinem Erwerb noch nicht absehbar gewesen war. Andererseits war der Aufstieg in der Hierarchie der Stadt durch die Familie seiner Frau blockiert.
Dennoch wollte er, dass sein am 28. August 1749 geborener Sohn Johann Wolfgang dieselbe Karriere durchliefe wie er selbst. Einzelne Stationen sind denn auch erkennbar: Der Sohn musste nach Leipzig, um Jura zu studieren, also aus der altväterlichen Reichsstadt ins ,Klein-Paris‘, ins Zentrum der Aufklärung und der Rokoko-Kultur, die freilich ihre Blüte bereits hinter sich hatte. Johann Wolfgang hätte Göttingen als die damals modernste Universität bevorzugt und als Fach die Philologie, nahm jedoch in Leipzig die vielfältigen, wenn auch teilweise überlebten kulturellen Traditionen auf, die ein Element der Basis für seine spätere Geistesweite und Bildungsbreite ausmachten. Ohne seine Herkunft zu verleugnen, wandelte er sich dennoch vom Frankfurter Stadtbürger zum Leipziger Weltbürger. 1768 erlitt er einen Blutsturz, vermutlich infolge einer Tuberkulose-Erkrankung, und musste das Studium vorläufig abbrechen. Seine lebensbedrohliche Erkrankung wird gelegentlich auch als allgemeines Krisensymptom gedeutet. Goethe kehrte zunächst nach Frankfurt zurück. Im folgenden sogenannten „Frankfurter Intervall“, seinen anderthalb Genesungsjahren, kam er durch den Kreis um Susanna Katharina von Klettenberg, eine Freundin seiner Mutter, in Kontakt mit hermetischen, alchimistischen und pietistischen Lehren, die eine Basis für die nächste ,Neuerfindung‘ seiner Individualität bildeten.4 1770 setzte er sein Studium in Straßburg fort und legte dort auch sein Lizenziat ab. Es folgte die erste der obligatorischen weiteren Stationen der Rechtsausbildung beim Reichskammergericht in Wetzlar, wo er jedoch keine ernsthaften juristischen Studien betrieb. In Frankfurt eröffnete er eine Rechtsanwaltspraxis und wurde darin vom Vater unterstützt, der ja keine eigenen Geschäfte hatte. Johann Caspar Goethe hielt das 1775 durch den Prinzenerzieher Carl Ludwig von Knebel an seinen Sohn ergangene Angebot, an den Weimarer Hof zu gehen, für unseriös. Hier schlugen die ideologischen Vorbehalte des Bürgers der Freien Reichsstadt gegen den Adel an einem kleinen Fürstenhof durch. Das Bürgertum war im 18. Jahrhundert als ökonomische Klasse noch nicht existent; seine heterogenen Mitglieder definierten sich häufig durch moralische Opposition gegen den vermeintlich oder tatsächlich sittlich verkommenen Adel. Johann Caspar wollte seinen Sohn nicht als Fürstendiener sehen, sondern erwartete, dass er stattdessen die nach dem biographischen Karrieremuster noch ausstehende Italienreise antrete. Als sich die Kutsche, die ihn in Frankfurt abholen und nach Weimar bringen sollte, verspätete, brach Johann Wolfgang Goethe doch noch, dem Wunsch des Vaters folgend, Richtung Süden auf. Die Schilderung des Aufbruchs im Tagebuch spricht von resignativer Ergebung in das Schicksal ebenso wie von seinem Wunsch, an eine transzendente Lenkung des Lebens zu glauben: „Diesmal rief ich aus ist nun ohne mein Bitten Montag Morgends sechse, und was das übrige betrifft so fragt das liebe unsichtbaare Ding das mich leitet und schult, nicht ob und wann ich mag. Ich packte für Norden, und ziehe nach Süden, ich sagte zu, und komme nicht, ich sagte ab und komme! […] und das weitere steht bei dem lieben Ding das den Plan zu meiner Reise gemacht hat.“ (GT I, S. 13 f.)
In Heidelberg holte ihn jedoch die Weimarer Delegation ein. Die dramatisch inszenierte Schilderung dieses Moments bildet den Schluss des postum zusammengestellten und herausgegebenen vierten Bandes von Dichtung und Wahrheit. Wenn man will, kann man in der Lähmung, die Goethe in den Tagen der Ungewissheit befallen hatte, während er darauf wartete, nach Weimar abgeholt zu werden, eine gewisse Entscheidungsschwäche sehen. Sie würde als Charaktereigenschaft nicht weiter interessieren, wenn sie nicht symptomatisch wäre für das zeittypische Zögern, den Möglichkeitssinn durch den Wirklichkeitssinn einzuengen, begrenzende Bestimmungen zu treffen, die Gestaltung des Lebens in die eigene Hand zu nehmen, wie es eigentlich erforderlich war. Das Schicksal des Vaters zeigte, dass es nicht mehr genügte, vorgegebenen Lebensentwürfen zu folgen, und dass es unabdingbar war, eigene riskante Entscheidungen zu treffen. Goethe setzte gerne auf Schicksalszeichen, die ihm die Entscheidung abnehmen oder ihn zumindest hinsichtlich einer getroffenen, problematischen Entscheidung entlasten sollten. Auch für die seinen Entwicklungsgang begleitende Frage, ob seiner Neigung zur bildenden Kunst Zukunft und Erfolg beschieden sein würde, berichtet Goethe von einer solchen Orakelbefragung, und zwar in Form des Wurfs eines Messers bei einer Wanderung entlang der Lahn Richtung Bad Ems und Koblenz im September 1772:
Ich wanderte auf dem rechten Ufer des Flusses, der in einiger Tiefe und Entfernung unter mir, von reichem Weidengebüsch zum Teil verdeckt, im Sonnenlicht hingleitete. Da stieg in mir der alte Wunsch wieder auf, solche Gegenstände würdig nachahmen zu können. Zufällig hatte ich ein schönes Taschenmesser in der linken Hand, und in dem Augenblicke trat aus dem tiefen Grunde der Seele gleichsam befehlshaberisch hervor: ich sollte dies Messer ungesäumt in den Fluß schleudern. Sähe ich es hineinfallen, so würde mein künstlerischer Wunsch erfüllt werden; würde aber das Eintauchen des Messers durch die überhängenden Weidenbüsche verdeckt, so sollte ich Wunsch und Bemühung fahren lassen. So schnell als diese Grille in mir aufstieg, war sie auch ausgeführt. Denn ohne auf die Brauchbarkeit des Messers zu sehn […], schleuderte ich es mit der Linken, wie ich es hielt, gewaltsam nach dem Flusse hin. Aber auch hier mußte ich die trügliche Zweideutigkeit der Orakel, über die man sich im Altertum so bitter beklagt, erfahren. Des Messers Eintauchen in den Fluß ward mir durch die letzten Weidenzweige verborgen, aber das dem Sturz entgegenwirkende Wasser sprang wie eine starke Fontaine in die Höhe, und war mir vollkommen sichtbar. Ich legte diese Erscheinung nicht zu meinen Gunsten aus, und der durch sie in mir erregte Zweifel war in der Folge Schuld, daß ich diese Übungen unterbrochner und fahrlässiger anstellte, und dadurch selbst Anlaß gab, daß die Deutung des Orakels sich erfüllte. (FA I 14, S. 605 f.)
Auf Orakel ist kein Verlass, die Kontingenz des Lebensverlaufs ist nicht abzuweisen oder auf übergeordnete Instanzen abzuwälzen. Obwohl Goethe weiß, dass ihm die Entscheidung nicht abgenommen wird, führt der Verlust einer transzendenten Autorität, die das Leben bestimmt, nicht unmittelbar zur Nutzung der gewonnenen Freiheit, sondern zunächst, nicht zuletzt aus Überforderung, zur Lähmung. Erst in Weimar, wo er sich durch die übertragene politische und administrative Tätigkeit oft genug fremdbestimmt sah, versuchte er sich an einer entschlosseneren Gestaltung des eigenen Lebenslaufs. Goethe wurde 1779 Mitglied im „Geheimen Consilium“, war also Minister in der Regierung des Herzogtums. Am 7. August 1779 notierte der knapp Dreißigjährige folgende Lebensbilanz in sein Tagebuch:
Zu Hause aufgeraumt meine Papiere durchgesehen und alle alten Schaalen verbrannt. Andre Zeiten andre Sorgen. Stiller Rückblick aufs Leben auf die Verworrenheit, Betriebsamkeit Wissbegierde der Jugend, wie sie überall herumschweift um etwas befriedigendes zu finden. Wie ich besonders in Geheimnissen, duncklen Imaginativen Verhaltnissen eine Wollust gefunden habe. Wie ich alles Wissenschafftliche nur halb angegriffen und bald wieder habe fahren lassen, wie eine Art von demütiger Selbstgefalligkeit durch alles geht was ich damals schrieb. Wie kurzsinnig in Menschlichen und göttlichen Dingen ich mich umgedreht habe. Wie des Thuns, auch des Zweckmäsigen Denkens und Dichtens so wenig, wie in zeitverderbender Empfindung und Schatten Leidenschafft gar viel Tage verthan, wie wenig mir davon zu Nuz kommen und da die Hälfte des Lebens nun vorüber ist, wie nun kein Weeg zurückgelegt sondern vielmehr ich nur dastehe wie einer der sich aus dem Wasser rettet und den die Sonne anfängt wohlthätig abzutrocknen. Die Zeit dass ich im Treiben der Welt bin seit 75 Oktbr. getrau ich noch nicht zu übersehen. Gott helfe weiter. und gebe Lichter dass wir uns nicht selbst soviel im Weege stehen. Lasse uns von Morgen zum Abend das gehörige thun und gebe uns klare Begriffe von den Folgen der Dinge. Dass man nicht sey wie Menschen die den ganzen Tag über Kopfweh klagen und gegen Kopfweh brauchen und alle Abend zu viel Wein zu sich nehmen. Möge die Idee des reinen die sich bis auf den Bissen erstreckt den ich in Mund nehme, immer lichter in mir werden. (GT I, S. 85–87)
Im folgenden Jahr, am 26. März 1780, führt Goethe diese Reflexionen fort:
Manichfaltige Gedancken und überlegungen, das Leben ist so geknüpft und die Schicksaale so unvermeidlich. Wundersam! ich habe so manches gethan was ich ietzt nicht möchte gethan haben, und doch wenns nicht geschehen wäre, würde unentbehrliches Gute nicht entstanden seyn: Es ist als ob ein Genius oft unser Hegemonikon [das innere leitende Prinzip; B. H.] verdunckelte Damit wir zu unsrem und andrer Vortheil Fehler machen.
war eingehüllt den ganzen Tag und konnte denen vielen Sachen die auf mich drücken weniger widerstehn. Ich muss den Cirkel der sich in mir umdreht, von guten und bößen Tagen näher bemercken, Leidenschafften, Anhänglichkeit Trieb dies oder iens zu thun. Erfindung, Ausführung Ordnung alles wechselt, und hält einen regelmäsigen Kreis. Heiterkeit, Trübe, Stärcke, Elastizität, Schwäche, Gelassenheit, Begier eben so. Da ich sehr diat lebe wird der Gang nicht gestört und ich muss heraus kriegen in welcher Zeit und Ordnung ich mich um mich selbst bewege. (GT I, S. 107)
Wiederum ein halbes Jahr später, im selben Brief an Lavater vom 20. September 1780, in dem das Diktum „Individuum est ineffabile“ fällt, wird das Programm der Selbsterziehung weitergeführt:
Das Tagewerck das mir aufgetragen ist, das mir täglich leichter und schweerer wird, erfordert wachend und träumend meine Gegenwart diese Pflicht wird mir täglich theurer, und darinn wünscht ich’s den grössten Menschen gleich zu thun, und in nichts grösserm. Diese Begierde, die Pyramide meines Daseyns, deren Basis mir angegeben und gegründet ist, so hoch als möglich in die Lufft zu spizzen, überwiegt alles andre und lässt kaum Augenblickliches Vergessen zu. Ich darf mich nicht säumen, ich bin schon weit in Jahren vor, und vielleicht bricht mich das Schicksaal in der Mitte, und der Babilonische Thurn bleibt stumpf unvollendet. Wenigstens soll man sagen es war kühn entworfen und wenn ich lebe, sollen wills Gott die Kräffte bis hinauf reichen. (FA II 2, S. 299)
1782 erfolgte Goethes Nobilitierung durch den österreichischen Kaiser Joseph II. und die Übernahme des Weimarer Kammerpräsidiums, womit der Gipfel der bürgerlichen Gesellschaftspyramide im Herzogtum erreicht war. Der Brief an seinen Freund Knebel vom 21. November 1782 fasst Problematik und Programm der Individualitätsentwicklung zusammen:
Ich sehe fast niemand, ausser wer mich in Geschäfften zu sprechen hat, ich habe mein politisches und gesellschafftliches Leben ganz von meinem moralischen und poetischen getrennt (äusserlich versteht sich) und so befinde ich mich am besten. […]
Und so fange ich an mir selber wieder zu leben, und mich wieder zu erkennen. Der Wahn, die schönen Körner die in meinem und meiner Freunde daseyn reifen, müssten auf diesem Boden gesät, und iene himmlischen Juwelen könnten in die irdischen Kronen dieser Fürsten gefaßt werden, hat mich ganz verlassen und ich finde mein iugendliches Glück wiederhergestellt. Wie ich mir in meinem Väterlichen Hause nicht einfallen lies die Erscheinungen der Geister und die iuristische Praxin zu verbinden eben so getrennt laß ich iezt den Geheimderath und mein andres selbst, ohne das ein Geh. R. sehr gut bestehen kann. Nur im innersten meiner Plane und Vorsäze, und Unternehmungen bleib ich mir geheimnißvoll selbst getreu und knüpfe so wieder mein gesellschafftliches, politisches, moralisches und poetisches Leben in einen verborgenen Knoten zusammen. (FA II 2, S. 460)
1779/80 richtete sich die Hoffnung noch nach außen bzw. nach oben, zu Gott als maßgeblicher Instanz. Das hat sich 1782 grundlegend geändert, und damit wird die Lebensproblematik, die im Alter von rund 30 Jahren durchaus Züge einer ,midlife crisis‘ trägt, zur typisch modernen. Gegen die Gefahren eines Doppellebens und der Dissoziierung des Subjekts wird nun die Instanz des ,Innersten‘ beschworen, das als Kern die Persönlichkeit zusammenhalten und das moderne Rollenmanagement ausbalancieren soll. Dazu bedarf das Subjekt jedoch nach wie vor einer äußeren Instanz als Gegenhalt. Von Gott ist nicht mehr die Rede, die Religion hat für Goethe ihre traditionelle Verbindlichkeit verloren. Ein solcher Gegenhalt war früher auch der gesellschaftliche Stand gewesen, dessen fest gefügte Verhaltensprogramme nun keine Orientierung mehr gewährten und sich schon für Goethes Vater als zu unflexibel erwiesen hatten. Da das Innere prinzipiell alle gesellschaftlichen Funktionsbereiche integrieren sollte, musste auch jene Instanz die Ganzheit repräsentieren und durfte nicht nur partikular einem gesellschaftlichen Funktionsbereich angehören. Solche Instanzen sind grundsätzlich die Liebe, die Natur und die Kunst – auf einen dieser Bereiche ist das Handeln des modernen Menschen in der Regel ausgerichtet, um die Sinnhaftigkeit seines Lebens dann zu verbürgen, wenn der beruflich, gesellschaftlich oder religiös erzeugte Sinn für ein erfülltes Leben nicht ausreicht. Daher geht es für das moderne Subjekt auch in scheinbar alltäglichen gesellschaftlichen Vollzügen rasch ums Ganze, und Goethe ist insofern repräsentativ, als er diesen modernen Zug und Zwang zur Ganzheit nicht etwa nur selbst in seinem Leben erfahren, sondern vor allem in seinem literarischen Werk paradigmatisch gestaltet hat. Natur, Kunst und Liebe (in dieser Reihenfolge) sind dann auch die Bereiche, in denen Werther in dem in dieser Hinsicht ersten modernen deutschsprachigen Roman Halt sucht – und schließlich eben nicht findet. Aber auch biographisch sind diese Bereiche bei Goethe auszumachen, wobei nicht zufällig ungefähr 1782, als die Spitze der bürgerlichen Karriereleiter erreicht ist, die naturwissenschaftliche Tätigkeit einsetzt. Goethes Naturwissenschaft ist in den kommenden Jahren immer als ein solches Krisensymptom zu sehen, als Versuch, sich der als notwendig erachteten Ganzheitskorrespondenz auf dem Weg über die Natur zu versichern, wenn dies als Liebender oder als Künstler nicht möglich war.