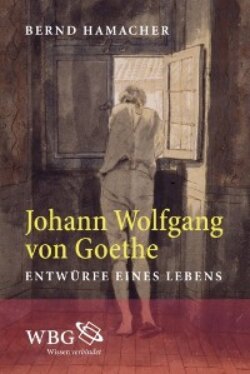Читать книгу Johann Wolfgang von Goethe - Bernd Hamacher - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Krisen- und Katastrophenmanagement des modernen Lebens
ОглавлениеDas Gelingen von Goethes Leben war weder durch einen angeborenen „Dämon“ noch durch ererbte Eigenschaften garantiert, sondern musste – individuelle Anlagen hin, Vererbung her – durch ein ständiges Krisen- und Katastrophenmanagement erschrieben werden. Die längs und quer zwischen den Werken und Zeiten laufenden Fäden können bei einem rein chronologischen Vorgehen nicht angemessen in den Blick kommen. Das krisenhafteste überpersönliche Ereignis in Goethes Leben war sicherlich die Französische Revolution, die genau in die Mitte seines Lebens fiel. Historische und persönliche Krise trafen zusammen, als Goethe seinen Landesfürsten, Herzog Carl August, beim Rheinfeldzug der Koalitionstruppen gegen die französische Revolutionsarmee 1792 begleiten musste. Er wäre lieber bei seiner Lebensgefährtin Christiane Vulpius und seinem noch nicht dreijährigen Sohn August geblieben. Seine Aufgabe war sehr unklar, denn als Kriegsberichterstatter fungierte er nicht, man muss ihn letztlich als Schlachtenbummler bezeichnen.1
Am 15. Oktober 1792 hielt sich Goethe während seiner Teilnahme am Feldzug in der Festung Luxemburg auf. Fast dreißig Jahre später gab er in der Campagne in Frankreich davon Bericht und versuchte, den Leserinnen und Lesern, die noch nie in Luxemburg waren, die Stadt zu erklären:
Wer Luxemburg nicht gesehen hat wird sich keine Vorstellung von diesem an und über einander gefügten Kriegsgebäude machen. Die Einbildungskraft verwirrt sich wenn man die seltsame Mannigfaltigkeit wieder hervorrufen will, mit der sich das Auge des hin- und hergehenden Wanderers kaum befreunden konnte. Plan und Grundriß vor sich zu nehmen wird nötig sein, Nachstehendes nur einigermaßen verständlich zu finden. (FA I 16, S. 484)
Was aber ist nach Goethes Ansicht so verwirrend?
Auf dem linken Ufer liegt hoch und flach die alte Stadt; sie, mit ihren Festungswerken nach dem offenen Lande zu, ist andern befestigten Städten ähnlich. Als man nun für die Sicherheit derselben nach Westen Sorge getragen, sah man wohl ein daß man sich auch gegen die Tiefe wo das Wasser fließt zu verwahren habe; bei zunehmender Kriegskunst war auch das nicht hinreichend, man mußte, auf dem rechten Ufer des Gewässers, nach Süden, Osten und Norden, auf ein- und ausspringenden Winkeln unregelmäßiger Felspartien neue Schanzen vorschieben, nötig immer eine zur Beschützung der andern. Hieraus entstand nun eine Verkettung unübersehbarer Bastionen, Redouten, halber Monde und solches Zangen- und Krakelwerk als nur die Verteidigungskunst im seltsamsten Falle zu leisten vermochte. (FA I 16, S. 484)
„Nichts“ könne „einen wunderlichern Anblick gewähren“, und Goethe resümierte: „Hier findet sich soviel Größe und Anmut, so viel Ernst mit Lieblichkeit verbunden, daß wohl zu wünschen wäre Poussin hätte sein herrliches Talent in solchen Räumen betätigt.“ (FA I 16, S. 485)
„Plan und Grundriß“, die Goethe für nötig hielt, lieferte er zwar nicht mit, doch lassen sie sich durch eine These ersetzen: Die Beschreibung der wunderlichen Anlage Luxemburgs vermag eine andere, nicht minder wunderliche Anlage verständlich zu machen. Die Beschreibung Luxemburgs in der Campagne in Frankreich lässt sich als Charakteristik des Goethe’schen Gesamtwerks und seiner Textstrategien lesen. Auch von den im Laufe seines Lebens errichteten Bücherfestungen kann man ohne Plan kaum eine zureichende Anschauung gewinnen, wie Goethe selbst im Vorwort zu Dichtung und Wahrheit zugegeben hatte. Die Aufgabe der Autobiographie sollte es sein, wie bei der Beschreibung der Festung Luxemburg zu zeigen, welche Teile wann zu welchem Zweck entstanden sind, um die verwirrende Synchronie durch eine diachronische Erklärung zu erhellen. Die komplizierte Entstehungsgeschichte von Goethes autobiographischem Projekt Aus meinem Leben, für das Dichtung und Wahrheit nur den ersten Teil bilden sollte, spiegelt indes selbst die verwirrende Situation wider, die es doch klären sollte. In seiner letzten Werkausgabe, der „Ausgabe letzter Hand“, tilgte Goethe bei den autobiographischen Schriften Italienische Reise und Campagne in Frankreich den Gesamttitel Aus meinem Leben, so dass nunmehr erst recht einzeln vor die Leserschaft trat, was ursprünglich zusammengehörte.
Diese auf den ersten Blick verwirrende, zumindest aber unübersichtliche Werkstruktur ist en miniature in der Beschreibung Luxemburgs angelegt. Dies gilt besonders für den Umstand, dass es sich bei Luxemburg um eine Festung handelt, die nicht nach einem feststehenden Konzept erbaut wurde, sondern deren Entstehung auf jeweils aktuelle Gefährdungslagen und Bedrohungen von unterschiedlichen Seiten reagierte. Das Ergebnis kann offenbar den kriegerischen Entstehungskontext vergessen machen, wenn Größe und Anmut, Ernst und Lieblichkeit verbunden scheinen und das Gesamtbild als ideales Sujet für den barock-klassizistischen Maler Nicolas Poussin beschrieben wird. Ganz ähnlich wie mit der Luxemburger Festung verhält es sich mit Goethes Werk, über dessen vermeintlich klassischer Harmonie die agonale Struktur nur selten bemerkt wurde. Nur wenige Interpreten haben das so scharf gesehen wie Richard M. Meyer, der mit passender militärischer Metaphorik davon gesprochen hat, dass das „Ich“ bei Goethe „in Wirklichkeit ein ,Regiment‘ von Einzelzuständen“ sei, und sich als Reaktion zur „Nothwehr“ gezwungen sah.2 Aus solcher Notwehr heraus ist auch Goethes Werk zu großen Teilen entstanden, als Reaktion auf Gefährdungen, die sich auf zwei große Komplexe beziehen lassen: Naturkatastrophen und Revolutionen, sprachlich in eins gefasst im Bild des Erdbebens.
Die Darstellung des Erdbebens von Lissabon 1755 bildet im ersten Buch von Dichtung und Wahrheit das Paradigma und die Urszene für Goethes Strategien des Katastrophenmanagements,3 für seinen narrativen Festungsbau gewissermaßen. „Durch ein außerordentliches Weltereignis wurde […] die Gemütsruhe des Knaben zum ersten Mal im Tiefsten erschüttert“ (FA I 14, S. 36) – so setzt die Darstellung ein, die als eines der prominentesten Rezeptionszeugnisse des Lissaboner Erdbebens immer wieder zitiert wird, wobei ziemlich einmalig sein dürfte, dass dem Zeugnis eines sechsjährigen Kindes so großes Gewicht in der abendländischen Kulturgeschichte beigemessen wird. Es hat seinen guten Sinn, wenn hier vom „Knaben“ in der dritten Person die Rede ist. Oft wurde der Abstand von über einem halben Jahrhundert zwischen dem Ereignis und der Niederschrift 1811 übersprungen und die Darstellung des über Sechzigjährigen als authentisches Erleben des Sechsjährigen genommen. Nicht nur der zeitliche Abstand ist immens. Die Distanzierung des Autobiographen beginnt schon damit, dass er eigens für diese Episode in die dritte Person wechselt, wenn er von seiner Kindheit spricht. Davor und danach schreibt er von sich in der ersten Person, häufig im Plural, wenn es um gemeinschaftliche Erlebnisse der Kinder geht, aber auch schon im Singular. Grund genug also, die erzählerische Distanzierungsleistung genauer in den Blick zu nehmen. Bei der Darstellung des Autobiographen Goethe handelt es sich um eine späte Inszenierung des Lissaboner Erdbebens als Kulturschock und Zivilisationsbruch, es handelt sich um eine konstruierte Urszene. Das Erdbeben als Verlust kultureller Unschuld ist eine ,Erfindung‘ (nicht nur, aber auch) Goethes, mit der er eine Bewältigungsstrategie für ähnlich gelagerte Erfahrungen erprobte. Da er für seine Deutung des Ereignisses zum Zeitpunkt der Darstellung bereits auf einen breiten Konsens im kulturellen Gedächtnis bauen konnte, trat deren Inszenierungscharakter selten ins Bewusstsein. Der zitierten Bemerkung über die Erschütterung der Gemütsruhe des Knaben geht die Schilderung des Umbaus von Goethes Frankfurter Elternhaus unmittelbar voraus. Dieser erscheint so gut gelungen, dass nur der notorische Ärger über die Handwerker den „gute[n] Humor“ unterbrechen kann. Wären sie nicht gewesen, „so hätte man kein glücklicheres Leben denken können, zumal da manches Gute teils in der Familie selbst entsprang, teils ihr von außen zufloß“ (FA I 14, S. 35).
Noch vor der viel zitierten Reaktion des Knaben auf die einlaufenden Nachrichten wird von den offiziellen Reaktionen berichtet: „Hierauf ließen es die Gottesfürchtigen nicht an Betrachtungen, die Philosophen nicht an Trostgründen, an Strafpredigten die Geistlichkeit nicht fehlen.“ (FA I 14, S. 36) (Man beachte die feinsinnige Unterscheidung zwischen „Gottesfürchtigen“ und „Geistlichkeit“.) Der Autobiograph gibt sich mit diesen institutionellen Bewältigungsmustern nicht weiter ab. Er empfindet sie als unzureichend und deutet die Katastrophe als persönliche Erschütterung, die im Rahmen der Autobiographie nur erzählerisch, nicht durch diskursive Schemata bewältigt werden kann. Aus dem zeitgenössischen Erleben selbst heraus soll die Bewältigung nicht gelungen sein, wie er zu verstehen gibt:
Der Knabe […] war nicht wenig betroffen. Gott, der Schöpfer und Erhalter Himmels und der Erden, den ihm die Erklärung des ersten Glaubens-Artikels so weise und gnädig vorstellte, hatte sich, indem er die Gerechten mit den Ungerechten gleichem Verderben preis gab, keineswegs väterlich bewiesen. Vergebens suchte das junge Gemüt sich gegen diese Eindrücke herzustellen, welches überhaupt um so weniger möglich war, als die Weisen und Schriftgelehrten selbst sich über die Art, wie man ein solches Phänomen anzusehen habe, nicht vereinigen konnten. (FA I 14, S. 37)
Es wird eine Urszene der Erschütterung des einheitlichen christlichen Weltbildes erzählt. Vorerst jedoch ändert sich beim Knaben noch nicht das gesamte Weltbild mit dem Zusammenhang von physischer und moralischer Welt, sondern lediglich das Gottesbild. Gott ist nicht mehr weise und gnädig, sondern zornig, denn, wie es im Text sofort danach heißt: „Der folgende Sommer gab eine nähere Gelegenheit, den zornigen Gott, von dem das alte Testament so viel überliefert, unmittelbar kennen zu lernen.“ Obwohl – oder gerade weil – bei der folgenden Episode vom Erdbeben gar nicht mehr die Rede ist, handelt es sich um eine Schlüsselstelle, in der auf engstem Raum ein weitreichendes Bewältigungsmodell für metaphysische Erschütterungen erprobt wird: Auf das epochale Erdbeben folgt ein banales, wenn auch ungewöhnlich heftiges Gewitter. Beide Naturereignisse werden dadurch parallelisiert, dass sie gemeinsam zum alttestamentlichen Gott in Beziehung gesetzt werden:
Unversehens brach ein Hagelwetter herein und schlug die neuen Spiegelscheiben der gegen Abend gelegenen Hinterseite des Hauses unter Donner und Blitzen auf das gewaltsamste zusammen, beschädigte die neuen Möbeln, verderbte einige schätzbare Bücher und sonst werte Dinge, und war für die Kinder um so fürchterlicher, als das ganz außer sich gesetzte Hausgesinde sie in einen dunklen Gang mit fortriß, und dort auf den Knieen liegend durch schreckliches Geheul und Geschrei die erzürnte Gottheit zu versöhnen glaubte; indessen der Vater ganz allein gefaßt, die Fensterflügel aufriß und aushob; wodurch er zwar manche Scheiben rettete, aber auch dem auf den Hagel folgenden Regenguß einen desto offnern Weg bereitete, so daß man sich, nach endlicher Erholung, auf den Vorsälen und Treppen von flutendem und rinnendem Wasser umgeben sah. (FA I 14, S. 37)
Der Hagel bringt Schrecken und Zerstörung. Durch die Parallelisierung der Darstellung ist der Hagel fast so schrecklich wie ein Erdbeben, ja schrecklicher, denn Lissabon ist weit. Es wird suggeriert, dass man einem Erdbeben und einem „Hagelwetter“ in gleicher Weise unterliegen, sich aber auch in gleicher Weise davor schützen könne: Ersteres – das Entsetzen, das Geheul, das Jammergeschrei gegen Gott – ist Sache des Hausgesindes und der Kinder, letzteres – die Gegenmaßnahmen – die Sache des Vaters, an dessen Reaktion Leistung und Grenzen des Aufklärers angesichts von Naturkatastrophen deutlich werden. Er vergeudet keine Zeit mit dem sinnlosen Anrufen einer menschlichen Einwirkungen nicht zugänglichen Gottheit, sondern ist um Schadensbegrenzung bemüht, indem er die neuen Scheiben vor der Zerstörung rettet. Sie stehen durchaus emblematisch für die Aufklärung, da sie das Licht in das Haus gelassen haben. Sein pragmatisches Handeln ist aber insofern nicht ohne die Signatur der Vergeblichkeit, als es zwar an einer Stelle Schaden verhindert, dafür jedoch an anderer Stelle umso größeren Schaden zeitigt, durch den Regen nämlich, der erst aufgrund der vermeintlich rettenden Tat für Zerstörung sorgen kann. Immerhin: Andernfalls wären vermutlich sowohl die Scheiben zerschlagen als auch die Einrichtung durch das Wasser beschädigt worden. Erfolgreicher noch als dieses Handeln ist die autobiographische Erzählstrategie der Schadensbewältigung, denn der Bericht fährt fort: „Solche Vorfälle, wie störend sie auch im Ganzen waren, unterbrachen doch nur wenig den Gang und die Folge des Unterrichts, den der Vater selbst uns Kindern zu geben sich einmal vorgenommen.“ (FA I 14, S. 37 f.) Was zunächst einen Bruch des christlichen Weltbildes bedeutete – die Herausforderung durch eine Naturgewalt, die sich nicht mehr moralisch vermitteln ließ –, ist nun zwar lästig, kann aber den Unterricht der Kinder und damit den Fortgang der Aufklärung nicht ernsthaft behindern. Was dem ,jungen Gemüt‘ des Sechsjährigen nicht gelungen sein soll, dem über sechzigjährigen Autobiographen gelingt es: „sich gegen diese Eindrücke herzustellen“. Der immense zeitliche Abstand dürfte dabei eine nicht unerhebliche Rolle spielen.
Insgesamt kam es darauf an, tragfähige Mechanismen zu entwickeln, um gewaltsame, zerstörerische Einbrüche in den Lebensverlauf und die Kultur als Ganzes zu verhindern, gleichsam die Scheiben der Immanenz gegen die Transzendenz abzudichten, in solchen Ereignissen also keine Einwirkung einer über- und außerirdischen Gottheit zu sehen. Das bevorzugte Bewältigungsverfahren stellt für Goethe die Naturwissenschaft bereit, und dabei kommt er auch zu wissenschaftlichen – oder aus heutiger Sicht pseudo-wissenschaftlichen – Rechtfertigungen des Übels. Schon in einem Brief vom 28. Dezember 1794 an Fritz Jacobi etwa kann er dem Erdbeben einen nützlichen Nebeneffekt abgewinnen. Er bezieht sich darauf, dass sein Schwager Schlosser seiner Tochter Louise verboten hatte, ihren Bräutigam Georg Heinrich Ludwig Nicolovius vor Beendigung des Krieges zu heiraten. Goethe kennzeichnet das Verbot als unwissenschaftlich, denn:
Wäre Schlosser ein Naturforscher so würde Nicolovius am Ziel seiner Wünsche seyn; denn es ist eine allgemeine Bemerckung daß die Prolification [Zeugung, Befruchtung; B. H.] nicht beßer gedeihe und gerathe als zu Zeiten des Erdbebens, eines Bombardements, oder irgend einer Stadt- oder Landkalamität und daß die unter solchen Aspeckten erzeugte Kinder an geist und körperlichen Gaben sich den Bastarden ziemlichermaaßen zu nähern pflegen.“ (FA II 4, S. 51)
Den „Bastarden“ deswegen, weil sie als besonders intelligent und robust galten. Es geht darum, der Katastrophe durch wissenschaftliche Beobachtung einen nützlichen Nebeneffekt abzugewinnen. Überdies ist ,Erdbeben‘ hier metaphorisch für den Krieg gebraucht, so dass das Katastrophenmanagement sich gegen natürliche wie geschichtliche Ereignisse gleichermaßen richtet. Wobei die von außen hereinbrechenden geschichtlichen Katastrophen – eben die Französische Revolution mit ihren tatsächlichen oder auch nur befürchteten Folgen in Deutschland – bald die eigentliche Herausforderung darstellen. Ziel ist die Herstellung einer konsistenten narrativen Struktur. Was aber im ersten Buch von Dichtung und Wahrheit noch gelingt, nämlich die Integration der Katastrophe in die Erzählung, gerät schon zwei Jahre später, 1813, in eine Krise. Nach der Niederlage Napoleons in Russland, die Goethe aufgrund seiner weitreichenden Identifikation mit dem Korsen als schicksalhaften Einbruch in die Sinnhaftigkeit der Individualitätsentfaltung empfand, unterbrach er die autobiographische Darstellung.4
Umso wichtiger war nach der Krise der Autobiographie das naturwissenschaftliche Krisenmanagement, wie es insbesondere in einem auf den 11. April 1821 datierten Schema greifbar ist, das in den Goethe-Ausgaben Naturwissenschaftlicher Entwicklungsgang betitelt wird. Goethe setzt zu einer neuen Erfolgsgeschichte an, indem er sich in den naturwissenschaftlich-technischen Fortschritt einschreibt, und wieder spielt das Erdbeben von Lissabon eine wichtige Rolle:
Schönes Glück die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts durchlebt zu haben.
Großer Vorteil gleichzeitig mit großen Entdeckungen gewesen zu sein.
Man sieht sie an als Brüder Schwestern, Verwandte ja in sofern man selbst mitwirkt als Töchter und Söhne.
Kurz vor meiner Geburt erregte die Elektrizität neues Interesse. […]
Erfindung der Wetterableiter.
Freude der geängstigten Menschen darüber.
Gestört durch das Erdbeben von Lissabon[.] (FA I 25, S. 49)
Damit werden die historischen Verhältnisse auf spektakuläre Weise auf den Kopf gestellt. Zwar wurden die ersten Blitzableiter kurz vor dem Lissaboner Erdbeben installiert (1752 durch Benjamin Franklin und 1754 durch den mährischen Prämonstratenser Prokop Divisch). Doch der Blitzableiter auf dem Pfarrhof des ,theologus electricus‘ Divisch wurde während einer Dürreperiode 1755 nächtens zerstört, weil er im Verdacht stand, alle Elektrizität aus der Luft in die Erde zu leiten und so den Regen zu verhindern.5 Es kann also keine Rede davon sein, dass sich die Menschen schon 1755 über den Blitzableiter gefreut hätten. Die erste Anlage in Deutschland wurde 1770 auf dem Turm der Hauptkirche St. Jakobi in Hamburg installiert, und bis zur allgemeinen Durchsetzung dauerte es noch längere Zeit. Das war Goethe natürlich bekannt. Durch die Umkehrung der Chronologie wird das Erdbeben von Lissabon in seiner Bedeutung von einer epochalen Katastrophe zu einem bloßen retardierenden Moment im Fortschrittsgang der Naturwissenschaften verkleinert. Indem aus der gegenüber der Niederschrift des ersten Buches von Dichtung und Wahrheit noch einmal um ein Jahrzehnt vergrößerten Distanz der Blitz als das Primärereignis erscheint, gegen das Naturwissenschaft und Technik in Stellung zu bringen sind, erscheint auch das Erdbeben implizit als beherrschbar. Dies gelang dadurch, dass in der zeitgenössischen Naturforschung Erdbeben und Elektrizität verbunden und Möglichkeiten denkbar wurden, Erdbeben ebenso wie Blitze abzuleiten. In dem nachgelassenen Versuch einer Witterungslehre von 1825 schreibt Goethe: „gar geneigt wären wir […], das Erdbeben als entbundene tellurische Elektrizität […] anzusehen, und solche mit den barometrischen Erscheinungen im Verhältnis zu denken.“ (FA I 25, S. 297) Zwar muss er gestehen, dass sich noch kein empirischer Beleg dafür gefunden habe. Mit den Stichworten ,tellurisch‘ – das heißt so viel wie: die Erde betreffend – und ,barometrisch‘ ist jedoch der rote Faden benannt, der sich durch alle Goethe’schen Strategien des Katastrophenmanagements hindurchzieht. So wie das Erdbeben von überirdischen Ursachen abgekoppelt und als rein innerweltliches Ereignis behandelt wird, so lehnt Goethe auch die Lehre extraterrestrischer Einflüsse auf das Klima ab: „die Witterungs-Erscheinungen auf der Erde halten wir weder für kosmisch noch planetarisch, sondern wir müssen sie nach unseren Prämissen für rein tellurisch erklären.“ (FA I 25, S. 276) Nur wenn keine überirdische Macht im Spiel ist, ist der Mensch den feindlichen Elementen ebenbürtig und kann den Kampf gegen sie aufnehmen:
Insofern sich […] der Mensch den Besitz der Erde ergriffen und ihn zu erhalten Pflicht hat, muß er sich zum Widerstand bereiten und wachsam erhalten. Aber einzelne Vorsichtsmaßregeln sind keineswegs so wirksam als wenn man dem Regellosen das Gesetz entgegen zu stellen vermöchte, und hier hat uns die Natur aufs herrlichste vorgearbeitet und zwar indem sie ein gestaltetes Leben dem Gestaltlosen entgegen setzt.
Die Elemente daher sind als kolossale Gegner zu betrachten, mit denen wir ewig zu kämpfen haben, und sie nur durch die höchste Kraft des Geistes, durch Mut und List, im einzelnen Fall bewältigen. (FA I 25, S. 295)
Abb. 1: Apokalyptische Naturvision. Zeichnung Goethes mit Bleistift und Feder, Januar/Februar 1807.
Diese gesuchte universelle Gesetzmäßigkeit, die dann auch die Vorhersage außergewöhnlicher oder gar katastrophischer Naturereignisse ermöglichen soll, ist Goethe zufolge am Barometer ablesbar, dessen Steigen und Fallen auf die wechselnde Anziehungskraft der Erde auf die Atmosphäre, auf ein pulsierendes „Aus- und Einatmen“ (FA I 25, S. 278) der Erde reagiere. Dabei ist das Barometer ein für Goethes Wissenschaftsverständnis im Grunde höchst dubioses Instrument, da es etwas zu messen vorgibt, was den menschlichen Sinnen üblicherweise entzogen ist: den Luftdruck. Dass Goethe ausgerechnet auf dessen Messergebnissen ein Weltgesetz aufbaut, liegt an seiner Wetterfühligkeit. Das eigentliche und genaueste Barometer – das ist die Pointe dieser Auffassung – bildet nämlich Goethes eigener Körper, und daher ist die sinnliche Wahrnehmung des Weltgesetzes doch möglich. Auf dieser Basis lässt sich auch für die Individualität, deren autonome Entfaltung nicht mehr möglich ist, zumindest ein diagnostischer Sinn gewinnen. „Wenn wir in einem bessern Clima wohnten; so wäre viel anders, ich bin der dezidirteste Barometer der existirt.“ (WA IV 5, S. 99). So schreibt er bereits am 28. März 1781 an Charlotte von Stein, und vermutlich am selben Tag klagt er gegenüber Merck: „Das Clima ist abscheulich und ich bin ein bestimmtes Barometer.“ (WA IV 5, S. 100) Diese Sensibilität soll ihn nun angeblich auch zu seismischer Telepathie befähigen. Am 6. April 1783 schreibt er an Frau von Stein: „Heute Nacht sah ich ein Nordlicht in Südost, wenn nur nicht wieder ein Erbeben gewesen ist, denn es ist eine auserordentliche Erscheinung.“ (WA IV 6, S. 147) Das Erdbeben von Messina, auf das hier angespielt wird, ereignete sich vom 5. bis 7. Februar 1783, und einem von Johann Peter Eckermann unter dem Datum des 13. November 1823 mitgeteilten Bericht von Goethes damaligem Kammerdiener Sutor zufolge soll Goethe das Beben 1783 prophezeit haben (vgl. FA II 12, S. 71 f.).
Die Barometer-Metapher wird nach dem Abbruch von Dichtung und Wahrheit über das Erspüren seismischer Erschütterungen hinaus auch für den politischen Bereich verwendet, dessen Bewältigung in der Autobiographie nicht gelungen war. Nach Napoleons Rückkehr von Elba schreibt Goethe am 22. April 1815 an Knebel: „Freilich ist die Einwirkung jener großen politischen Atmosphären-Veränderung an jedem, selbst dem stillsten häuslichsten Barometer zu spüren, und eine völlig veränderte Weltansicht waltet in jedem Gemüte.“ Eine Prognose über die politische Wetterlage ist jedoch aufgrund des Barometerstandes nicht möglich: „Man weiß wahrlich nicht, woran man besser tut, ob sich über die Zustände aufzuklären, oder sich darüber zu verdüstern. Ja, beides will nicht gelingen: wer sollte sich die Kräfte, die jetzt wieder in Bewegung sind, und ihre Wirkungen klar machen können, und wer könnte jetzt im Dunkeln und Trüben verweilen, da jeder Tag die Wolken, die er bringt, wieder auseinander reißt?“ (FA II 7, S. 429)
Goethes zitierte Skizze seines naturwissenschaftlichen Entwicklungsganges bietet nach dem Abbruch von Dichtung und Wahrheit einen autobiographischen Alternativentwurf. Indem er sein autobiographisches Projekt und seine naturwissenschaftlichen Forschungen programmatisch zusammenführt, erhält er die Möglichkeit, Wissenschaftsgeschichte als Autobiographie zu schreiben und umgekehrt. Hiervon wird noch zu reden sein. Bei Goethes lebenslangem Bemühen darum, die bedrohliche Unübersichtlichkeit der modernen Welt in eine konsistente erzählerische Struktur zu überführen, kann das Erdbeben von Lissabon integriert werden, die unter der Erdbeben-Metapher gedeutete politische Geschichte letztlich nicht. Indem jedoch die Barometer-Metapher wörtlich genommen wird, ist zumindest in der Form des Körpers der Kern der Individualität als eine Art zentrale Messstation der Welt zurückgewonnen: „Der Mensch an sich selbst, insofern er sich seiner gesunden Sinne bedient, ist der größte und genaueste physikalische Apparat, den es geben kann.“ (FA I 13, S. 166) Der Körper ist zentrale Messstation der Welt oder Beobachterposten, der Ausschau hält, von wo Gefahr droht und wie die Sinnhaftigkeit der Welt zu sichern ist. Damit lässt sich die Geschichte des Individuums und seiner Werke zwar nicht – wie die unterdrückte Vorrede zum dritten Buch von Dichtung und Wahrheit es als ursprüngliche Intention darstellt – nach den Gesetzen der „Metamorphose der Pflanzen“ schreiben, aber immerhin nach dem Modell des Luxemburger Festungsbaus rekonstruieren. Er kann als Allegorie nicht nur des Goethe’schen Werkes, sondern eines erheblichen Teils der kulturellen Überlieferung und des Krisenmanagements der modernen Welt gelesen werden. Den Goethe’schen literarischen Festungsbau zu beschreiben bedeutet damit, den Leserinnen und Lesern einen Kompass in die Hand zu geben, der zur Orientierung im planlos entstandenen Gebilde unserer Kultur befähigt. Und da dieser Kompass in letzter Instanz immer wieder der eigene Körper ist, bleibt trotz der historischen Ferne und der fremden Lebensansichten, -kontexte und -entwürfe ein unmittelbarer, voraussetzungsloser Zugang möglich. Goethes Körper bleibt uns zwar so fremd und unzugänglich wie die Gestalt, die uns auf Tischbeins Aquarell den Rücken kehrt. Da aber die elementaren Lebensvorgänge in jedem menschlichen Körper (im Rahmen gewisser Abweichungen) gleich verlaufen, ist gerade das Intimste und Privateste das, was von allen wenn nicht geteilt, so doch verstanden werden kann.