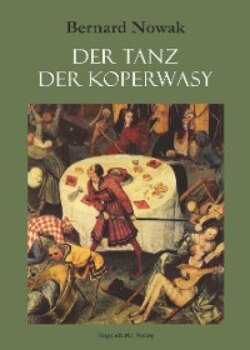Читать книгу Der Tanz der Koperwasy - Bernd Nowak - Страница 10
IV
ОглавлениеWir fuhren in den Ferien und zu Beerdigungen manchmal zu Taufen oder zu Erstkommunionen nach Koperwasy, aber nicht an Feiertagen. Und zwar niemals, wenn ich mich recht erinnere.
Nicht nur deshalb, weil es an Feiertagen ganz wenig Zeit gab, es zu weit war und die Züge überfüllt und teuer waren. Die Ursache lag woanders. Großmutter hätte uns nicht gelassen. Während der Feiertage wollte sie uns alle bei sich haben. Das waren Familientage, die nur einer Sache gewidmet waren, deren Wesen, Kern und Zentrum das frühe Aufstehen zur Ostermesse, der Gang zur Christmette, das Teilen der Oblate oder das österliche Frühstück waren. »Was wir ersehnten, haben wir erhalten, Alleluja«, sprach Großmutter, ohne ihre Rührung zu verbergen. Oder, wenn die Schneeflocken vor dem Fenster tanzten und das Mondlicht von den Feldern und Dächern widergespiegelt wurde, sprach sie in dem ihr vertrauten Latein den wunderschönen Satz: »Gloria! Gloria in excelsis Deo.«
An diesen Tagen wurden wir von nichts anderem abgelenkt. Weder von der Schule noch von Freunden oder von dem damals noch nicht vorhandenen Fernsehen. Und die Großmutter nicht von ihrer Arbeit. Es war seltsam und überraschend, dass nicht einmal die Arbeit als Hebamme, die ihrem Wesen nach Überraschungen und unmöglich festzulegende Termine in sich trägt, uns die Großmutter wegnahm. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie uns jemals an einem dieser Tage hätte allein lassen müssen. Sie war immer mit uns zusammen. So, als ob man da oben irgendwie wusste, dass man jetzt nicht stören durfte, besonders in einer Situation, in der wir für alle anderen Dinge so viele Tage hatten, an denen wir uns nicht auf die Angelegenheiten Gottes und – was vielleicht noch wichtiger war – der Menschen konzentrieren. Angelegenheiten der Eltern, Brüder und Schwestern. Der Eltern, die als Erste am Tisch fehlen würden. Der Brüder, die – wie das eben so ist – den Vater und die Mutter verlassen, um ihrer Frau zu folgen. Der Schwestern, die ihre Nester bauen. Ihre neuen Nester, die für sie wichtiger sind als jene, aus denen sie kamen. Jetzt also, so lange es nur geht, sollten wir uns gemeinsam an uns erfreuen, uns in die Gesichter schauen, uns mit Armen und Blicken umgarnen, denn der Moment, in dem jemand von uns nicht mehr da ist, könnte näher sein, als wir in unserer Weisheit meinen. Also sollten wir zusammenbleiben, so lange es nur geht.
Während der Festtage blieben wir also zu Hause. Die Großmutter und unter ihren Fittichen wir sechs. Mit einer einzigen Ausnahme. Aber das erzähle ich später.
Tante Gienia erwartete uns nicht und lud uns auch nicht ein. Ihr Kalender, von dauernder Agonie und der Perspektive auf die Beerdigung geprägt, trat in diesen Fällen hinter den Kalender der elementaren Liturgie zurück. Der kirchlichen, die in einem mindestens so hohen Grade in die natürliche Ordnung eingeschrieben war wie ihre eigene. Eine Ordnung, die im Handumdrehen ausgedacht worden war, einst in plötzlicher Not schnell geschaffen und später für immer in die Familienfeste hineinmontiert. Was auch immer man über ihre Marotten sagen mochte, hier ordnete sie sich klaglos dem Lauf der Dinge unter. Ich denke, dass sie ihn aus verschiedenen Gründen sogar heimlich unterstützte. Denn obschon wir in der Lage sind, einzelne Tage aus dem Strom der Zeit herauszubrechen, so müssen wir uns doch in bestimmten Momenten einer höheren Ordnung unterwerfen. In der keimenden Hoffnung, dass wenigstens sie uns nicht in den Abgrund der Stille, der Sinnlosigkeit und des Vergessens reißt. Und da war noch die Sache mit der Konkurrenz. Gienia spürte instinktiv, dass sie sich nicht in sie hineinbegeben sollte. Besonders nicht mit Ostern, angesichts dessen ihre Prozeduren und deren – verglichen mit der echten Auferstehung – totale Vergeblichkeit zum Vorschein kamen und sogar für die Jüngsten erkennbar waren.
Sehr viel später machte ich mir bewusst, dass es ihr deshalb immer gelang, ihre Festtage in einem zeitlichen Abstand zu jenen anderen durchzuführen, damit niemand – und zwar möglichst lange – die einen mit den anderen in Verbindung bringen konnte. Damit man nicht das Universelle mit dem Individuellen, das der Tante mit dem Göttlichen verglich. Die ungleichen Kräfteverhältnisse, das Zweitrangige ihrer Liturgie, der Kitsch des häuslichen, mit einstdeutschen Gegenständen angefüllten Tempels musste gegen jene andere Liturgie verlieren.
Die Tante besaß also so viel Weisheit, um sich nicht auf ein Terrain zu begeben, wo die Niederlage von Beginn an beschlossene Sache gewesen wäre. Ob sie sich sofort oder später einstellen würde, war dabei von keiner größeren Bedeutung. Ich denke, dass im Falle des Weihnachtsfestes, das von ihr nicht strapaziert wurde, noch etwas anderes von Bedeutung war. Etwas sehr Verlockendes, Attraktives und uns allen Nahes. Die Tatsache, dass wir ein Fest haben, das wir begreifen, erfühlen und erleben können. Und dass wir es so begehen wie eine ersehnte Situation, die uns und die Welt erneuert, still und geborgen. Es gibt noch einen anderen, ebenso fundamentalen Grund. Die Tatsache, dass die Geburt eines Menschen, selbst wenn es Gott ist, nicht über unser Begreifen hinausreicht.
Weihnachten. Immer wieder verwundert mich die Anziehungskraft eines Säuglings. Man stelle sich vor: Unter uns taucht ein Wesen auf, dem alles fehlt. Manchmal fehlt es ihm auch an gutem Aussehen. Nicht selten sehen wir (obwohl man das erst später, nachdem man wieder zu Hause ist, sagt), dass das Neugeborene hässlich ist wie die Nacht. Wie sein Vater. Hässlich wie ein Popo mit Ohren. Dennoch wird dort, wo es ist, ein ununterbrochenes Fest gefeiert. Und manchmal erlebt man, wie das mit Gästen gefüllte Haus sich auf nichts anderes konzentriert. Es wird nicht gesprochen, nichts anderes ist attraktiv, und wenn etwas eingeschaltet wird, so ist es die Videokassette mit dem Film über die ersten Tage. Über diesen kleinen, wehrlosen und gänzlich schwächlichen Schatz. Und dies geschieht aus einem Grund, den wir alle kennen. Denn es ist ein Mensch zur Welt gekommen, der noch alles vor sich hat, der ein Geheimnis und das Wunder des sich erneuernden Lebens darstellt. Eines Lebens, das genauer betrachtet gar nicht notwendig ist. Das nicht nur in einer von uns geschaffenen Welt, sondern im gesamten Weltall keine Chancen hat. Ein Leben, das nicht das Recht und die logischen Voraussetzungen hat, um zu existieren. Und dennoch ist es da. In der Wiege, im Steckkissen oder im Bettchen. Das große, herrliche Leben mit feuchter Windel zwischen den Beinen. Und wenn dieses Leben Gott ist – wer wird ihm dann widerstehen können?
Aus diesen Gründen, die wir als Kinder gar nicht formulieren konnten, blieben wir während der Festtage zu Hause. Wie gingen zur Christmette und danach, am zweiten Feiertag und in der Zeit der gesamten Oktav, zur Krippe. Begeistert und entzückt von diesem in einer Position erstarrten Püppchen, kalt und in der kalten Kirche liegend, aber immerhin lächelnd. Geheimnisvoll lächelnd, nicht zu uns hin, sondern wie zu sich selbst, in Gedanken an das Wunder, das geschehen war – aber vielleicht auch zu dem Vater, mit dem man zu dritt diese in ihrer Art einzigartige Ankunft erdacht hatten. Und dieses Lächeln, das von seinem Gesicht erstrahlte, füllte den gesamten Kirchenraum aus, setzte sich allmählich wie die Schneeflocken draußen auf Kleidung und Gesichter und erneuerte uns zumindest ein wenig. Wenn auch nur für diesen einen Tag. Wegen dieses Tages und dieses Gefühls waren wir immer mit Großmutter zusammen. Außer einer einzigen Ausnahme. Als wir an Weihnachten zu den Koperwasy fuhren. Die Kinder allein, denn Großmutter wollte aus uns unerfindlichen Gründen zu Hause bleiben. Warum das so sein musste, erfuhr ich erst Jahre später.
Die Feiertage bei den Koperwasy begeisterten uns nicht. Zwar vollzog sich alles, wie es sich gehört: Heiligabend, Christmette, Geschenke. Und nach den Feiertagen organisierte Aloch eine gemeinsame Schlittenfahrt – aber es war dennoch nicht so, wie es hätte sein sollen. Es war nicht bei uns. Nicht zu Hause, nicht im eigenen Nest, nicht bei Großmutter. Wir waren nicht unter uns, sondern wie Anhängsel. Und wir spürten das alle. Immer wieder sah ich, dass jemand von uns allein in der Ecke saß, was bedrückend traurig war.
Aber es hatte so kommen müssen. Heute weiß ich, dass es sein musste. Dass Großmutter richtig gehandelt hatte. Was war passiert? Es war nichts passiert, was für Großmutter neu gewesen wäre. Nur, dass es diesmal im Geheimen und in unserem Haus geschah. Sie hatte uns zu den Koperwasy verfrachtet, damit das Haus leer war. Großmutter nahm während unserer Abwesenheit eine Entbindung vor.
Eine Schwangerschaft lässt sich nicht verbergen, eine Geburt sowieso nicht, sie ist recht gut voraussehbar. Aber diesmal geschah es plötzlich, genauer gesagt, erfuhr Großmutter erst im letzten Moment davon. Eines Tages, bereits zu Beginn der Ferien, wurde sie von einem Mann besucht. Es war der Vater von derjenigen, die sich auf das Wochenbett vorbereitete, einer jener wenigen Deutschen, die übrig geblieben waren. Nach eben diesem Gespräch mit ihm, das natürlich auf Deutsch geführt wurde, verkündete Großmutter, dass wir über die Feiertage zu den Koperwasy fahren würden. Wir waren überrascht, aber Großmutter antwortete auf unsere fragenden Blicke nur: »Es muss sein.« Danach – wie zur Abmilderung – fügte sie hinzu: »Irgendwann einmal erkläre ich euch das.« Und damit genug.
Also fuhren wir hin. Und Großmutter führte die Entbindung durch. Das Mädel wurde im Schutz der Nacht gebracht. Und danach, als alles zu Ende war, auch wieder nachts weggebracht. Nicht in ihr Dorf, sondern nach Breslau. Wo sie niemand kannte. Sie fuhr zusammen mit ihrem Bruder, der einige Jahre lang ihren Ehemann mimen sollte. Und den Vater des Neugeborenen. Der echte war unbekannt und nicht feststellbar.
Es gab mehrere echte Väter. Das Mädel war von Russen und Polen, siegreichen Soldaten, vergewaltigt worden. Wie durch ein Wunder kam sie mit dem Leben davon und wie durch ein Wunder wurde sie von ihrer Familie wiedergefunden, die wusste, dass sie sich an niemanden wenden konnte. Die, wenn sie sich sogar für eine Abtreibung entschied, keine Möglichkeit hatte, sie durchzuführen. Also gab es nur die Zeit und das Warten. Die Zeit und die Hoffnung, dass es gelingen würde, sich etwas auszudenken. Eine Lösung zu finden. Ich weiß nicht, was und wie sie dachten, ob sie etwas entschieden oder sich dem Schicksal ergeben hatten. Immerhin war an jenem Tag ihr Vater zu Großmutter gekommen, die ohne zu zögern alles beiseiteschob, sogar uns und Weihnachten.
Damals also, an Heiligabend 1946, kam jener Junge zur Welt. Von einer deutschen Mutter, von einem unbekannten Vater, einem Polen oder Russen. Der vielleicht bis heute noch unter uns lebt. Der – um mich so auszudrücken – wie ein lebendiges Denkmal jener Zeiten weiterlebt. Chaotischer und schlimmer Zeiten, wie die Abgründe der menschlichen Seele.
Die Geburt erfolgte in der Nacht. Ebenfalls in der Nacht kam der Pfarrer zu Großmutter, um das Neugeborene zu taufen. Er kam allein, von Großmutter gerufen, die wieder einmal Taufpatin wurde. Der Pfarrer kam mit einem dicken Buch unter dem Arm und mit einem Gefäß voll Weihwasser. Er kam wie einst jene drei Könige zu dem Kind, ohne Gold, aber mit Weihrauch. Mitten in der Nacht lief er mit dem Weihrauchfass durch das ganze Haus. Denn in dieser Nacht führten diese zwei Menschen, von denen der Mann nicht nur kein Vater, sondern etwas wie ein Anti-Vater war, den kleinen Jungen in die Welt ein. In eine Welt, die rings um sie herum wütete. Eine von Herodessen erfüllte Welt, der sie sich entgegenstellten. Gegen die sie, eingeschlossen und bei verschlossenen Fensterläden, ein Leben vor einem rachsüchtigen Blutbad bewahrten.