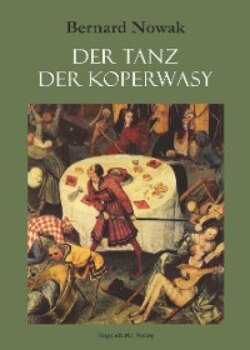Читать книгу Der Tanz der Koperwasy - Bernd Nowak - Страница 9
III
ОглавлениеKrankheiten kommen – sagen Personen, die in Gesundheitsdingen über größeres Wissen verfügen – grundsätzlich vom »Zug« oder vom »Überheben«. Alle anderen, die nicht in reiner Form auftreten, bilden eine Kombination dieser beiden grundlegenden Typen, ihrer Proportionen und ihrer Intensität. Die Krankheiten der Tante hatten die erste dieser Erscheinungen zur Ursache, denn seit frühester Jugend konnte sie dem Überheben entgehen. Sie heiratete im Alter von sechzehn einen zehn Jahre älteren Handelsreisenden und führte an dessen Seite ein leichtes, auskömmliches Leben.
Onkel Józef war auf größere Waren spezialisiert. Landwirtschaftliche Geräte, die Versorgung der Schmiede mit Rohstoffen, schließlich – und danach vor allem – der Handel mit gestohlenen Pferden. Józef kannte alle Geheimnisse der Branche. Er wusste, wie man ein Pferdefell farblich nachbessert und wie man es aufhellt, wie viel Alkohol man einer Mähre einflößen muss, damit sie im Moment der Transaktion so munter wie ein Jungpferd wirkt. Schließlich wusste er, wo, von wem und wie viele Male ein Pferd verkauft worden war.
Man sagte, dass es keine Kunst sei, einen Wallach so betrunken zu machen, dass er sich auf sein Hinterteil setzte und verdächtig wieherte. Die Kunst bestand darin, die dem Alter und der Kondition entsprechende Dosis zu verabreichen, die die wundersame Verwandlung der Ware in Bargeld garantiert. Perfekt konnten das die Zigeuner, und nur sie. Ihre Frauen, die Zigeunerinnen, wurden zu minderen Tätigkeiten abgeschoben, zum Diebstahl von Federvieh und zur kartenlegerischen Manipulation fremder Schicksale. Der Onkel ging umgekehrt vor. Sich mit Gienia verbindend, stieß er sie nicht in die Sphäre der Hilfsarbeiten ab, sondern behandelte sie partnerschaftlich. Deshalb wurden sie sehr bald zu einem sich hervorragend ergänzenden Paar.
Gienia half auf vielfältige Weise bei der Arbeit. Sie überredete und ermutigte die Käufer, flirtete mit ihnen, scherzte, schlüpfte manchmal in die Rolle der Konkurrentin und servierte »auf gutes Gelingen« immer ein Glas Grog. Da der Bauer zu Frühlingsanfang auf den Markt kam, bot sich ein Glas zum Aufwärmen auf jeden Fall an. Den so aufgeweichten Delinquenten ließ die Tante nicht mehr aus ihren Fängen. Sie verstand es, ihn aufzuhalten, den Preis hochzutreiben oder – ohne mit der Wimper zu zucken – einen Vortrag über die Vorzüge des Braunen zu halten, während sie nicht vergaß, dem frierenden Interessenten ein wenig von ihrem »Tee« einzuschenken. Später, nach dem abgeklatschten Handel, folgte der schönste Augenblick, wenn sie den beiden beschwipsten Glückspilzen, dem Pferd und seinem Herrn, mit ungetrübtem und höflich schmachtendem Blick folgte. Sie war die geborene Spezialistin für psychologische Kriegsführung. Ich denke, dass die damals erworbene Selbstständigkeit ihr später, als der Onkel nicht mehr zurückkam, erlaubte, die schlimmsten Jahre zu überstehen.
Der Beruf des Pferdediebs erfordert Beweglichkeit, gute Beherrschung der Topographie, schließlich die Fähigkeit, seine Ware rasch loszuschlagen. Die Tante musste das nicht erlernen, eher lernte der Onkel von ihr. Das war ein aktives Leben, an der frischen Luft, mit guter Kost. Es half, Figur und allgemeine Leistungsfähigkeit zu erhalten. Sie lebten mit einem Wort glücklich und aßen ein leichtes, umso schmackhafteres Brot. Seit Jahren in der Branche tätig, war sie keine Feldarbeit mehr gewohnt, zu der sie die Eltern seit Kindesbeinen (»Erde macht nicht schmutzig!«) vergeblich anhielten. So also, niemals schwer hebend, war sie auch nie krank. Erst später, bereits nach der Flucht des Onkels, begann ihre Gesundheit zu schwanken.
Von den neun Kindern Gienias war es Iryś, der außergewöhnlich gelungen war. Eher Philosoph als Schmied (er führte die Werkstatt von Fred weiter, als dieser im Gefängnis landete), war er der Einzige, der das Matriarchat der Tante in eine Männerwirtschaft hätte umwandeln können. Als Ältester begann er recht bald, während der Abwesenheit des Vaters, seinen Platz einzunehmen.
Seine Führungsqualitäten kamen nicht nur darin zum Ausdruck, dass er bei jedem Dorftanzfest die tonangebende Person war. Denn er war nicht nur ein hervorragender Tänzer, sondern konnte sich auch wie kein anderer prügeln. Dafür war er berühmt, und zwar nicht nur im eigenen Dorf. Er entschied, wenn eine Schlägerei begann, wer schuld war und auf wessen Seite man zu stehen hatte, er sprach, wenn nötig, auch zahlreiche Urteile. Manchmal, wenn eine Feier schon im Gange war, kam man zu ihm nach Hause gelaufen, weil es dort zu brodeln begann und jemand sofort auf seelische oder körperliche Unterstützung angewiesen war. Sich seiner Verantwortung bewusst, ließ Iryś alles stehen und machte sich auf den Weg. Die Tante musste ihn nicht einmal bitten, vorsichtig zu sein. Sie wusste, dass Iryś, wer sonst, wenn nicht er, keinen Fehler machen würde. Genau damit bezauberte er Jadzia.
Wie jeder Führer fürchtete er sich weder vor fremdem noch vor eigenem Blut. Er war immer bereit, es wegen einer gerechten oder weniger gerechten Sache zu vergießen. Seit seiner Kindheit hatte man ihm eingeflößt, sich niemals gegen die eigenen Leute zu wenden, also stellte er sich immer, auch wenn die Situation nicht ganz eindeutig war, ohne zu zögern auf die Seite der Koperwasy.
Aus Gesprächen hatte ich noch etwas erfahren. Er war es auch, der die erste Bestattung der Familie Wuttke durchführte. Ich sage erste, denn nach einer Weile hat man sie ausgegraben und auf den Friedhof umgebettet. Iryś nahm genauso, wie er sie begrub, auch an ihrer Exhumierung teil. Er wies den Platz und griff zum Spaten.
Er war zusammen mit der Tante nach Sedlenken, also das heutige Koperwasy, gekommen. Gienia ging trotz ihres Muts nicht allein auf solche Erkundungsreisen. Immerhin herrschten noch Kriegszeiten. Die Front war gerade vorbeigezogen, allein unterwegs zu sein, war für eine junge Frau gefährlich. Sie hatten auf der Suche nach etwas Passendem gemeinsam schon ein großes Gebiet durchstreift und bei dieser Gelegenheit das eine oder andere mitgenommen. Als sie schließlich auf jenes riesige Gehöft mit Fachwerkmauern stießen, als sie schon aus der Ferne entschieden hatten, dass es das war, ergab sich eine Komplikation. Die mit den Körpern der Getöteten. Sie fanden sie gleich hinter der Darre. Genau so auf einem Haufen liegend, wie man sie, zu einem Haufen zusammengedrängt, erschossen hatte.
Man könnte meinen, dass er, als er die Familie an Ort und Stelle begrub, ungebührlich handelte. Heute ist es leicht, so zu urteilen, damals standen die Dinge allerdings ganz anders. Da herrschte Krieg, immer noch Krieg, die Toten bestattete man wo auch immer, denn für etwas anderes fehlte die Zeit. Besonders, wenn es um die Front und das an oder hinter der Front liegende Gebiet ging. Dass man sie überhaupt begraben hatte, war bereits ein humanitärer, für die Koperwasy überraschender Akt. Wer dachte damals an ein normales Begräbnis und einen Pfarrer? Wo hätte man ihn suchen sollen, wenn man doch nicht selten gerade einen Pfarrer begraben musste?
Das Gleiche gilt für die Verwaltung. Es gab in diesen Gebieten keine Ämter, die für Bestattungen zuständig gewesen wären oder Totenscheine hätten ausstellen können. Solche Dinge waren weder möglich noch wurde darauf – wie heute – Wert gelegt. Nicht nur solche Menschen wie die Koperwasy, sondern auch diejenigen, die wirklich an die Wiederauferstehung der Leiber glaubten, konnten nicht viel mehr tun, als die Toten in die geduldige Erde zu legen.
Jene, die Iryś nicht mögen, können sagen, dass er einfach das Terrain reinigte. Wenn sie wollen, sollen sie so reden, man sollte aber daran erinnern, was die Tante sagte: »Söhnchen, das war Krieg. Und das waren doch Deutsche.«
Trotzdem hat Iryś es gemacht. Er verspürte wohl auch keine größeren Hemmungen. Alle haben damals Leichen gesehen. Die von Deutschen, von Russen und auch polnische. Außer ihm war damals niemand dabei. Hätte es die Tante vielleicht tun sollen? Sie half ihm sowieso, die Grube zuzuschaufeln, nachdem er die Leichen dort hineingelegt hatte. Man sollte darin eher einen Akt des Mutes erblicken. Genauso, wie er sich später mitten in eine Keilerei begab, tat er bereits am ersten Tag etwas, wofür sich nicht jeder andere entschieden hätte.
Wenn ich heute über sie alle, diese Koperwasy, nachdenke, weiß ich, dass sie vielleicht gar nicht zu denen gehörten, die es in den Augen anderer verdienten, hervorgehoben zu werden. Der Blick des Erwachsenen reduziert solche Größen auf die eigentlichen Ausmaße, verschiebt sie sogar manchmal ins vollkommene Vergessen. Damals aber waren sie für mich die Wichtigsten. Sie verdienten in den Augen des Kindes, die wie ein Vergrößerungsglas sind, Aufmerksamkeit. Sie füllten den Horizont der Kindheit.
Sicherlich waren sie keine sogenannten Persönlichkeiten, aber gerade deshalb trieben sie auch niemanden in die Enge. Jeder wuchs dort so auf, wie er wollte. Ohne züchterische Eingriffe, wie größeres oder kleineres, mehr oder minder gelungenes Unkraut. Nur Marta war vielleicht eine Ausnahme.
Das muss ich allerdings präzisieren. Jeder von ihnen war für mich wichtig, denn jeder unterschied sich durch irgendetwas vom anderen. Bereits die grundsätzliche Teilung in Frauen und Männer bildete für die Koperwasy die Grundlage für weitere Unterscheidungen. Außerdem die Kleidung und die Gesichter. Die Kleidung vielleicht am wenigsten, denn damit beschäftigten sie sich angesichts ihrer Möglichkeiten in geringem Maße. Doch die Gesichter, obschon ähnlich, waren der Anfang weiterer Klassifizierungen. Nicht für äußere Unterscheidungen, sondern für die in die Tiefe reichenden. Und menschliche Gesichter waren für mich – trotz allem – ein großes Geheimnis; sie sind es noch immer. Als der am stärksten vergeistigte Teil des Menschen, mit Augen und Nase, ließen sie darunter die Existenz – noch nicht der Seele – aber eines Innenlebens voller Rätsel und Möglichkeiten vermuten. Sie verbargen unter der Haut der Stirn die Erinnerung an all das, was sich viele Jahre vor mir ereignet hatte, und bewahrten eine unzugängliche und unverständliche Weisheit. Ich war nämlich zutiefst überzeugt, dass alle Erwachsenen das verstehen, was man in meinem Alter nicht wissen kann. Dass man automatisch, nach Überschreitung einer recht vagen Grenze, eine Erleuchtung erfährt und weiß, oder zumindest vermutet, wofür man lebt. Und, wie man leben sollte. Woher sollte ich, ein Kind, wissen, dass dies nur eine weitere Mystifikation war.
Iryś war einer der begabteren Diebe. Onkel Fred, ein guter Kumpel Kazik Krupniaks, des ersten Mannes von Marta, nahm ihn – trotz seines jungen Alters – auf seine Streifzüge mit. Sie fuhren bis zur Festung Breslau, um von dort mit Fuhrwerken zurückzukommen, die mit allerlei Gut beladen waren. Die Tante begleitete sie. Sie wusste nur zu gut, dass diese Philosophen ohne sie nichts, was für die Hauswirtschaft nötig war, herbeischaffen würden. Gerade zu jener Zeit versorgten sie die Gegend mit starken Pferden, die auf deutschen Höfen davongekommen waren. Und mit Aloch, wenn man das so sagen darf. Denn bei einer dieser Unternehmungen kam er mit ihnen hierher. Und blieb.
Die ersten waren die besten Monate. Später fingen schlechtere an. Es wurde kontrolliert, man forderte Empfangsscheine und Genehmigungen oder immer größere Schmiergelder – was so weit ging, dass sich die Sache nicht mehr lohnte. Iryś hatte noch die Idee, die Güter per Bahn herzuschaffen, aber das gelang nicht öfter als zweimal. Beim dritten Mal bekam es jemand mit – und alles ging verloren. Es gelang ihnen noch, die jungverheiratete Marta mit hineinzuziehen. Nur einmal, was aber genügte, dass sie – nach der Geschichte mit dem Russen und nach dem Tod der Kinder – gerade in jene Gegend reiste.
Nicht reiste, sondern floh. Dort eine neue Bleibe zu finden und von Neuem anzufangen, war recht einfach. Es genügte, an die Haustür eines verlassenen Hauses einen Zettel – »Von einem Polen belegt« – zu hängen, und man wurde zum Besitzer des gesamten Gehöfts mit all seinen Gerätschaften. Sie war eine der Ersten. Sie wählte ein hübsches Haus mit kleinem Garten und wirtschaftete einsam auf ein paar Morgen Land.
Diese Einsamkeit war, wie sich bald herausstellen sollte, unvollkommen. Man wunderte sich, dass sie die Offerten der von hinter dem Bug heranströmenden Freier ablehnte. Man wusste nicht, dass der Platz an ihrer Seite bereits besetzt war. Durch Kurt. Eines Tages nämlich, als sie in den Schweinestall ging, um etwas zu holen, stieß sie auf einen vor dem Trog knienden Soldaten in Uniformfetzen. Er nahm gerade das restliche Schweinefutter heraus. Niemand von den beiden geriet in Panik; beide hatten schon so viel gesehen, dass sie sich über nichts mehr wunderten.
Der mit deutschen Uniformresten bedeckte und von mehrtägigem Bartwuchs schwarzgesichtige Kurt sah aus wie ein menschlicher Fetzen. Der junge Organismus sollte aber bald wieder zu Kräften kommen. Nach ein paar Wochen kam Kurt wieder zu sich und begann mit seinen Reisevorbereitungen. Marta besorgte ihm einen Anzug und eine hübsche Reisetasche.
Eines Tages verschwand er aus dem Dorf; im letzten für die Flucht geeigneten Moment. Sie verschwanden beide. Kurt wusste nur zu gut, dass sie ihn erschießen würden, wenn sie ihn fänden. Bevor er auch nur im Stande gewesen wäre, den Mund aufzumachen.
Die Abwesenheit Martas entdeckte man erst nach vier Tagen. Direkt vor der Flucht hatte sie den Tieren noch Futter in den Trog gelegt, aber als keines mehr da war, alarmierten die im Stall eingeschlossenen Kühe die nächsten Nachbarn durch lautes Brüllen. Diejenigen, die das Haus als Erste betraten, fanden eine in der Eile hinterlassene Unordnung vor, ein Koppel mit der Aufschrift Gott mit uns sowie zwei Knöpfe. Gerade wegen dieser auf die Fantasie eines Kindes wirkender Accessoires und der über sie verbreiteten halb legendären Erzählung schlichen sich vollkommen neue Gedanken in meine Kindheit ein. Das, was magisch und unschuldig war, begann unumkehrbar auszutrocknen. Ich betrat den schwierigen Weg von Gut und Böse.
Die Geschichte Kurts erfuhr ich erst später, übrigens von Marta selbst. Er war einer der wenigen, dem es gelungen war, aus Lambsdorf zu entkommen. Von polnischen und sowjetischen Kommandos verfolgt, schlug er sich nächtens nach Westen durch. Er versuchte, zu Großmutter Weber, seiner Mutter, zu gelangen, die, in der Hoffnung, dass sie ihm würde helfen können, von Pommern dorthin, in die Nähe gezogen war. Vollkommen entkräftet, nachdem er zahlreiche Märsche zu Ehren Adolf Hitlers – wie dies von den polnischen Kapos bezeichnet wurde – hinter sich gebracht hatte, konnte er kaum noch die Beine schleppen. Als der erste Schnee fiel, beschloss er, abzuwarten. Hungrig und frierend stieß er auf den Schweinestall Martas. Sie wurden ein Paar und verbanden so meine beiden Familien, die der Koperwasy und der Großmutter Weber, miteinander.
All dies blieb über die Jahre in geheimnisvollen Vermutungen versunken. Entweder wusste Gienia nicht so viel oder sie wollte das Thema nicht berühren. Aber es war ausgerechnet die Tante, die mir bewusst machte, dass es schien, als würde jemand, wenn nicht das Schicksal aller, so doch das von Marta lenken. Als hätte sie jemand von hier, wie einst aus Ägypten, herausgeführt. Wie durch Zufall flüchtete ihr zweiter Mann aus dem Gefängnis, als ihr erster Mann Kazik gerade seine Strafe absaß. »Das Gefängnis hat ihr einen Kerl genommen und einen Kerl gegeben«, erklärte sie mir philosophisch. »Es hat ihr den besseren gegeben und den schlechteren genommen. Weil Kurt, obwohl Deutscher, besser ist.«
Damals verwunderte mich dieser Satz, denn ich wusste, dass Kazik Krupniak gleichsam ein Zögling der Tante war. Aus dem Priesterseminar geflogen, wurde er von den Koperwasy noch vor dem Krieg, als das junge Ehepaar seine Karriere begann, aufgenommen. Relativ schnell erreichte er die bequeme – wenn auch der Würde etwas abträgliche – Position eines angeflickten Bruders. Als man begann, nach einem Heiratskandidaten für Marta Ausschau zu halten, kam die Familie einvernehmlich zum Ergebnis, dass es wenig Sinn mache, einen fremden zu nehmen, wenn man einen eigenen habe. Einen guten, recht vermögenden und allseits bekannten. Auch vom Aussehen her fehlte es ihm an nichts. Hochgewachsen und dunkel, mit weißen Zähnen und gelockten Haaren, war er ein im Dorf auffallender junger Mann. Marta ließ sich überreden, obwohl ihr Kazik, warum auch immer, nicht so ganz gefiel. Über das Schicksal der ersten Ehe von Marta erfuhr ich zunächst etwas von Aloch, später von dem unglückseligen Kazik. Den Rest erzählte sie mir dann selbst.
Es war schon nach Kriegsende. Die Russen kehrten etwas lustlos ins sowjetische Paradies zurück, Dankbarkeit und Angst legten einem nicht nur nahe, alles mit ihnen zu teilen, sondern sich auch über ihre Anwesenheit und die neue Form von Freiheit zu freuen. Also freute man sich auch. Gerade da tauchte Grischa im Dorf auf. Onkel Ed, Inhaber einer erbeuteten Schmiede, freundete sich schnell mit dem Offizier an und bewirtete ihn wochenlang auf den gerade in Besitz genommenen Ländereien. Mehrtägige Zechgelage, die mit dem vor Ort beschafften Schwarzgebrannten versetzt waren, dauerten an. Unters Messer kamen Ferkel und schließlich auch Ziegen, die die Kriegswirren überstanden hatten. Gemordet wurde alle Schöpfung, die man anfangs noch abtastete, dies aber später ließ.
An der nicht enden wollenden Feier der Sieger nahm auch Krupniak, ein enger Freund des russischen Leutnants, teil, dem er die wärmsten – wenn auch recht trunkenen – Gefühle entgegenbrachte. Bis zur Besinnungslosigkeit betrunken küsste man sich und weinte, schließlich sang man traurige – Kazik nur brummelnd – Volkswaisen. Der Russe trug ihnen lebenslange Freundschaft und sie boten ihm Blutsbruderschaft an. Später, nachdem sie sich aus dem Haus gewälzt hatten, schossen sie mit Pistolen Salut oder – nüchterner geworden – auf die sogenannte Freiheit und den Sieg. »Das waren«, erinnerte sich die Tante, »wirklich großartige Zeiten.«
Der Gesellschaft schlossen sich auch andere an. Die Männergesellschaft (manchmal wurde eine der Soldatinnen mitgebracht oder, was besser war, eine erbeutete Deutsche) lumpte besinnungslos vor sich hin. Fast jeder der Russen schleppte all das mit sich herum, was er gestohlen hatte. Auf seine Findigkeit stolz, war man sofort bereit, einen Tauschhandel – etwas gegen nichts – abzuschließen.
An einem dieser Tage wurde beschlossen, das Zechgelage mir der Heirat der jungen Leute zu verbinden. Marta wehrte sich, stimmte aber – in den Wahnsinn der Feier mit einbezogen – schließlich zu. »Koperwasy! Koperwasy!«, schrie man bei Tisch und stieß so mit den Gläsern an, als wäre dieser Name mehr als nur ein Name. Als wäre es der alte Schlachtruf eines Geschlechts, das man jetzt neu entdeckte und präsentierte – wie ein frisches Wappen.
Die Hochzeitsfeier musste natürlich drei Tage dauern. Niemand von den Hochzeitern konnte sagen, wann die Feier begann und wann sie endete. Noch lange nach der kirchlichen Trauung (die ausgerechnet der Pfarrer aus Brachlewo vollzog) wurde vom Kuchen gegessen. Der Russe hatte aus einem bei Berlin gelegenen Gestüt einen stattlichen Hengst mitgebracht. Die Onkel, obschon betrunken, kalkulierten dessen Qualitäten nüchtern. Als der Leutnant aus Meve (heute das Städtchen Gniew) auf ihm angeritten kam, traten nur wenige Dorfbewohner heraus, um zu schauen. Braun, glänzend vor Sauberkeit und Haferkost, ging er in leichtem, alle Muskeln bewegendem Trab. Er glich dort einem fremden, aristokratischen Tänzer.
Diese Freundschaft, selbst die hochzeitliche, konnte nicht ewig währen. Es kam die Zeit des Abzugs – und der Russe reiste ab. Der Befehl sprach von Montag. Grischa aber war schon Freitag abgezogen … Allerdings stand der rassige Deckhengst weiter im Stall der Koperwasy.
Es dauerte einige Monate, bis das NKWD auf eine Spur stieß. In der Scheune wurde Grischas Leiche ausgegraben und die als Hauptschuldige verurteilten Onkel Fredek und Kazik gingen für lange Jahre ins Gefängnis von Sztum. Dass sie, entgegen der Erwartungen, nicht zum Tode verurteilt wurden, hatten sie angeblich Gienia zu verdanken.
Freds Schmiede wurde geschlossen, die Pferde Kaziks wurden verkauft und Marta – gerade erst Braut geworden – blieb allein auf dem Hof. Fünf Monate später gebar sie die Zwillinge, nach neun Monaten begrub sie die Kinder. Sie waren aus ungeklärter Ursache in einer Nacht gestorben. Man bestattete sie in einem kleinen Grab, direkt neben den Kriegsgräbern. Ohne Grabstein und Tafel; nur die Familie wusste, wen diese Grasdecke barg.
»Der Krieg hat alles durcheinandergebracht …«, seufzte die Tante einmal, ganz im Begriff, sich anzuvertrauen. »Marta war jung und die Zeiten unsicher. Ich dachte, es wäre gut, wenn sie denn einen hätte. Aber es kam anders …«