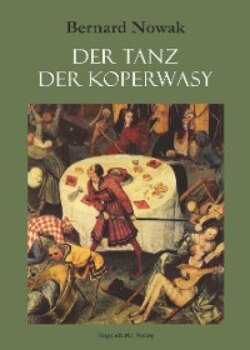Читать книгу Der Tanz der Koperwasy - Bernd Nowak - Страница 7
Der Tanz der Koperwasy
ОглавлениеTante Gienia starb viele Male. Man könnte ohne größere Übertreibung sagen, dass sie diese Kunst in vollkommener Weise beherrschte. Dann kamen bei den Koperwasy alle Familienangehörigen zusammen, die engeren und die ferneren, in erster Linie aber ihre neun Kinder, und jedes von ihnen mit dem eigenen, zahlreichen Anhang. Es kamen alle, sogar »die Stettiner von hinter dem Bug«, die von der Familie am weitesten entfernten Umsiedler. Im Haus wurde es eng und dunkel, man hörte Geflüster und das fieberhafte Aufzählen von Details, man zählte die Ansässigen und die Angereisten, aber alle wussten, dass auf den Listen sowieso jemand fehlen würde. Immer wenn sie starb, warteten wir auf die Anreise einer weiteren Person. Gienia erwartete den Besuch ihrer Schwester, Tante Marta. Und immer wartete sie umsonst.
Das Sterben fand im größten Zimmer des Fachwerkhauses statt, wo die Tante die Angereisten in dem bald nach dem Krieg irgendwoher beschafften Ehebett liegend empfing. »Meine lieben Kinder …«, seufzte sie auf den ihre vollbusige Gestalt stützenden Kissen. »Ihr seht mich zum letzten Mal, danke, dass ihr gekommen seid … Ist Iryś auch da? Aha, er soll übermorgen kommen, dieser Schlauberger taucht immer als Letzter auf. Du, Aloch, bist sicher wieder besoffen, was? Kannst du nicht die paar Tage abwarten, du siehst doch, wie schwach ich bin … Geh lieber und hilf Sabcia, das Mädel hat alle Hände voll zu tun«, dirigierte sie aus der Höhe ihres Todesthrons und zeigte damit allen, dass sie die Situation im Griff hatte und ihre Herrschaft bis zum letzten Atemzug verteidigen würde.
Bei jedem dieser Auftritte vergaß sie auf keinen Fall, zumindest für einen Moment einen Schwächeanfall zu erleiden und eine ihrer Hände so herabsinken zu lassen, dass sie schließlich kraftlos herabhing. Diese leblose Gelöstheit, die leicht geöffneten altersschwachen leberblauen Lippen und ihre durch Kosmetika balsamierte Blässe hielten sie nicht davon ab, den Moment abzuwarten, bis ihr eine der Töchter einen Becher mit leicht verdünntem Kompott an den Mund hielt. Verstohlen lugte sie unter ihren Lidern hervor, welche von ihnen die Erste sein würde. Und gerade in diesem Moment, urplötzlich, als das Ritual beendet schien, warf sie die noch heute in meinen Ohren nachklingende Frage in den Raum: »Habt ihr Marta ein Telegramm geschickt?«
Langsam und etwas zögerlich antwortete eine Stimme mit einem »Ja«.
Dann ereilte uns die zweite Frage: »Hat sie geantwortet?«
Es wurde still. Schließlich erklärte ein etwas Mutigerer: »Wir waren heute noch nicht auf der Post, Tante, aber wahrscheinlich noch nicht …«
Dann drehte sich Gienia, deren letzter Wusch unerfüllt geblieben war, zur Wand und wir – ignoriert und voller Hochachtung – schoben uns in die Küche hinaus, wo sich, so weit ich zurückdenken kann, schon immer das Familienleben abgespielt hatte.
In der westfälischen Küche war es ruhig und heimelig, wie mit Resten jener anderen, deutschen Gemütlichkeit versetzt, die auf häuslichen Gerüchen und der vom Ofen her pulsierenden Wärme beruht. So war es hier, dort aber, im Zimmer der Tante, herrschten Starre, Ruhe und Kälte. Und all dies, damit die Kranke leichter atmen und besser schlafen konnte, wobei jedem klar war, dass sich das Leben, mit den sich zwischen unseren Beinen tummelnden Hunden und Katzen, ganz auf unserer Seite vollzog. Auf Seiten der Tante gab es nur noch die zur vollkommenen Starre heruntergekommene Zeremonie der letzten Vermählung.
Wir, die Heranwachsenden, lungerten ziellos herum, wie irgendwo vergessene Jungs, und warfen verstohlene Blicke auf die selten gesehenen Altersgenossen der ferneren Verwandtschaft. Die blasse Sabina, die Tochter der Tante, schon ein wenig Hausfrau, kochte irgendetwas, ihr Mann, der von der Sterbenden erwähnte Aloch, nahm aus dem Backofen, feierlich wie aus einem privaten Tabernakel, Gefäße mit aromatischem Punsch heraus. All dies geschah, um sich aufzuwärmen, denn der Zufall wollte es, dass das Sterben der Tante auf die Wintermonate fiel, wenn die Feldarbeiten beendet waren und das Geschäft mit dem Vieh weniger wurde. Wenn – kurz gesagt – die Zeit fürs Sterben am günstigsten war.
Man muss zugeben, dass Gienia es verstand, den Moment fehlerfrei zu wählen, um für uns all die Langeweile, die uns wie eine dunkle Herbstnacht zusetzte, erträglicher zu machen. Ich glaube, alle Verwandten waren ihr ein wenig dankbar, dass sie die Feiertage um einen neuen, etwas makabren Brauch bereicherte. Gern fuhren wir, selbst vom ganz anderen Ende Polens, zu ihr. Gern kämpften wir uns durch das Land, froren in schlecht beheizten Bahnhöfen, garten in überfüllten Abteilen, nur, um die in der Kindheit so verlockende Odyssee erleben zu dürfen.
Bis zu einem bestimmten Alter fuhren wir zu zweit, Ania und ich. Später fuhr ich meistens allein und ein- oder zweimal mit Michał. Am liebsten war ich mit Ania unterwegs, denn dann war ich mir sicher, dass nichts passieren konnte. Dass sie es immer schaffen würde, mir zu helfen. Später wurde ich allein losgeschickt, man kaufte mir die Fahrkarte und erinnerte mich daran, wo ich umsteigen musste.
Zur Sicherheit nahm ich allerdings eine Landkarte mit: vergilbt und abgewetzt, mit nicht mehr gültigen Grenzen, aber mit den gleichen Verbindungen wie vor dem Krieg. Grenzen lassen sich ändern, aber Schienen bleiben am Ort, selbst nach allen noch so großen Verschiebungen. Damals bemerkte ich, dass man sich mithilfe des Schienennetzes leicht orientieren kann, wie weit der Einfluss der einen Zivilisation reicht und wo eine andere beginnt. Oder – genauer gesagt – gar nicht vorhanden ist. Und auf einer solchen Landkarte zeichnete ich mir mit einem dicken Strich meine eigene, von Süden nach Norden führende Trasse ein.
Wir kamen im Morgengrauen an. Der Zug hielt an einer kleinen, in einem Tal gelegenen Station und wir suchten mit unbeholfenen Füßen nach den hölzernen Stufen des Waggons, um – mit dem Köfferchen beladen – nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Das schwarze Ungeheuer fuhr weiter, während wir, zwei auf dem geschotterten Bahnsteig stehende Kinder, die nach Ferienfrische duftende Landschaft in uns aufnahmen.
Wir gingen dann den leeren, sich wie alle pommerschen Chausseen schlängelnden Weg entlang. Wir schritten wortlos nebeneinander her, mit in Träumen verfangenen Gedanken und mit Augen, die die vertrauten Orte wiedererkannten. Den Backsteinschlot ließen wir hinter uns und in der Ferne zeichneten sich das Kirchlein und der Dorffriedhof ab, auf dem die Zwillinge Martas lagen. Beim Sägewerk dufteten die Bretter und gleich dahinter fiel einem der rote Backstein der Tabakfabrik ins Auge. Hier hatte direkt nach dem Kriege Marta, die von allen nur »die Amerikanerin« genannt wurde, gearbeitet.
Wir wussten nie, auf welche Situation wir treffen würden. In den Telegrammen stand, dass der Zustand der Tante bedenklich sei, dabei war seit der frühesten Kindheit, seit den ersten Besuchen klar, dass sie krank war. Man sprach bei jeder möglichen Gelegenheit darüber. Ringsherum wuchsen die Kinder heran, gingen zur Kommunion, die Familie kam zu Kirchweihen und Hochzeiten zusammen und die Tante lebte gleichsam nebenher und außerhalb der Zeit, mit einer für die Ärzte ungeklärten Erkrankung ausgestattet. Wenn wir uns also zum wiederholten Mal dem Ort näherten, von dem aus die Fachwerkmauern dieses in der ganzen Gegend größten Hauses sichtbar wurden, wich die durch die Reise verursachte Aufregung jäh einer die Kehle zuschnürenden Angst.
Die Tante fragte auch uns wegen Marta und jedes Mal mussten wir hervorbringen, dass sie »momentan nicht vorhabe, zu kommen«. Marta hatte sich mit unserer Großmutter angefreundet und schrieb ihr oft, aber aus dem, was man mitbekam, zeichneten sich keine Reisepläne ab. Zunächst dachte ich, dass es eine Frage der Entfernung und der vielen Dollars sei, erst später erfuhr ich, dass es um mehr ging. Ein wenig von der Großmutter und ein wenig aus den in den Ferien aufgeschnappten Äußerungen folgerte ich, dass es zwischen ihnen Dinge gab, die viele Jahre zurücklagen, aber für ein Kind war es schwer, sich zu orientieren, und noch schwerer, sich Fragen zu erlauben. Es ging nicht um Geld, denn die kinderlose und berufstätige Marta war eine der wohlhabendsten Personen in unserer Familie und musste nicht auf jeden Groschen achten. Außer dieser Tatsache verstand ich nicht viel; die halb ausgesprochenen Worte und Andeutungen vergrößerten die Verwirrung nur. Immer dann, wenn der Name Marta fiel, öffnete ich aus purer Neugier den Mund.
Der Weg nach rechts führte nach Brachlewo, wohin ich als Kind, trotz zahlreicher Streifzüge, niemals kam. Die Grenze meiner Welt verlief unmittelbar am Anwesen der Tante entlang, am Ansatz der asphaltierten Gabelung; dahinter begann ein unbekanntes Land. Der dortige Himmel, weiter weg, war wie aus Blei, durch den kein Strahl hindurchdringt, nicht hindurchgelangen kann, obschon es doch etwas Verkehr in beiden Richtungen der Chaussee gab. Manchmal sprang hinter der Kurve ein LKW hervor, nicht selten fuhr an mir ein PKW vorbei, und ich war so vergafft, dass der Fahrer kurz bremsen musste, um mir mit der Faust zu drohen, doch die Fahrtgeräusche brachen – was mir erst jetzt bewusst wird – schon ein paar Meter weiter wie abgeschnitten ab. Die Fahrzeuge, egal welche, wurden unglaublich schnell kleiner und verschwanden zusammen mit den Motorgeräuschen und den sich ringelnden Abgasen im Raum, so als würden sie aufgesogen.
Nicht nur ich, sondern keiner von der Familie, die doch zahlreichen Geschäften nachging, fuhr jemals in diese Richtung. Schon bei der Nennung des Ortsnamens spürte man geradezu Abneigung. Auch der Pfarrer von Brachlewo (manche sagten noch immer Brachnebrau) wurde von der Tante kaum toleriert. Die offizielle Ursache war seine berühmte Gefräßigkeit, die jede Hausfrau fürchten musste, aber auch in dieser Angelegenheit witterte man eine durch das familiäre Beschweigen bemäntelte Unklarheit. Die Abneigung war gegenseitig. Der Pfarrer kam, wenn er zur Kirchweih erschien, niemals auf meine Tante zu.
Wir gingen weiter, vorbei an dem zu dieser Tageszeit abgezäunten Kółeczko, wo ein mir wenig bekannter Teil der Familie lebte. Die in den dortigen Häusern wohnenden Anverwandten und Verwandten gehörten – obschon vom Stamm der Koperwasy – zu einem Seitenzweig der Dynastie. Ich erinnere mich wie durch einen Nebel an diese Menschen; sie waren klein, dunkel, mit ein wenig semitischem, rötlichem Einschlag und trugen Vornamen, die mir heute nicht mehr geläufig sind. Der Stammbaum des Geschlechts war recht verworren, sodass mir manchmal schien, dass jeder mit jedem verwandt war, was wohl in gewisser Weise auch stimmte. Niemand außer Großmutter Weber war in der Lage, diese Verwandtschaftsverhältnisse zu entwirren.
Nach Kółeczko ging man, um mit anderen Jungen zu spielen. Dort war es leichter, einem der Altersgenossen zu begegnen, während andere in den auf den Feldern verstreuten oder sich an der asphaltierten Chaussee hinziehenden Gehöften unauffindbar blieben.
Die Gehöfte hießen nicht wirklich Kółeczko. Vielmehr bildeten sie das eigenständige Dorf Ołędry Sztumskie. Allerdings benutzten alle den verkürzten Ersatznamen, indem sie etwas hervorhoben, was sowieso klar war: Das Dorf war in Kreisform aufgebaut worden. Dort, mitten auf dem Platz, stand eine der wichtigsten Requisiten meiner Kindheit: eine große gusseiserne Pumpe mit einem abgewetzten glänzenden Griff. Dieses Meisterstück deutscher Gusskunst, das unter unseren Füßen unsichtbar blieb, hatte eine Eigenart, die mich immer wieder neugierig machte. In gewisser Weise identifizierte ich mich sogar mit ihr; ich kann sogar behaupten, dass sie genauso stotterte wie ich. Wenn man den Hebel bewegte und nicht das Wasser, sondern die neben dem Kolben entweichende Luft angesaugt wurde, gab die Pumpe Geräusche von sich, die aus dem Erdinneren zu kommen schienen, indem sie lange, metallische Selbstlaute ausstieß. »Aa… Aahh… Iiii… Aaa… Aah«, stöhnte sie arm und einsilbig vor sich hin, als könne sie trotz der Anstrengung nichts anderes hervorbringen.
Aber diese Spiele dauerten sogar im Sommer nicht lange. In der Abenddämmerung wurde Kreislein mit einem breiten, unüberwindlichen Zaun abgesperrt. Wir spürten, dass die von dort doch etwas anderes waren als die Kinder an der Chaussee oder die aus den im Tal verstreuten Gehöften. Die Dorfbewohner bildeten eine Gruppe für sich mit einem durch Sitte festgelegten Rhythmus des Verschließens, während alle anderen ein weitaus weniger geregeltes Leben führten. Für uns war das beschwerlich, denn manchmal wären wir gern bis abends geblieben, aber da wurde schon der Palisadenzaun aufgestellt und wir mussten weichen. Die aus Kółeczko blieben zurück, auf der Wiese und mit der geheimnisvollen Pumpe, wir aber gingen zögerlich in alle Richtungen auseinander. So richtig habe ich diese Unbequemlichkeit aber erst viel später verspürt. Und zwar dann, als mich die dort – wie hinter der Palisade einer von Schwarzerde umgebenen Burg – eingesperrte Kasia Kurcjanow zu interessieren begann.
Kasia war die Erste von den Altersgenossinnen aus der Familie, bei der ich schon lange die immer größer werdenden Wölbungen ihrer Brüste wahrgenommen hatte. Sie nahm meinen ebenso verschämten wie kühnen Blick genau wahr und erwiderte ihn mit der ganzen Direktheit einer zum Leben erwachenden jungen Frau. Sie sah mir gleichermaßen mutig wie schamlos in die Augen. Sie war älter und brauchte mich nicht ernst zu nehmen, weshalb sie bei mir weitergehen konnte als bei anderen. Mit den anderen hatte sie sicher schon das eine oder andere ausprobiert, sie musste sich also vor ihnen in Acht nehmen, aber mit mir konnte sie sich alles erlauben. Ich glaube, dass ich für sie so etwas wie ein bequemes Versuchskaninchen war, von dem man sich, wenn es denn so weit ist, ein für alle mal trennt. Das habe ich erst viel später verstanden und bevor dieser Moment kam, war ich überzeugt, dass sie für mich die gleichen Gefühle hegte wie ich für sie. Dabei handelte es sich – denn ich muss den Mut haben, die Dinge beim Namen zu nennen – um mit Provokation vermischtes Mitleid und Erbarmen.
Wir bogen nach links ab und gelangten vorsichtig durch das verwässerte Ultramarin des Morgens zu den an dem doppelten Bogen – aus Weg und Bachlauf – gelegenen Gebäuden. Das große Haus, mit dem unter einem Dach untergebrachten Wirtschaftsteil, war im Schlaf versunken. Manchmal klirrte ganz kurz eine von einem Kuhschädel bewegte Kette. Ihr antwortete von der gegenüberliegenden Seite des Hofes die andere, durch die Schwelle der Bude hindurchgezogene und auf dem Holz schnarrende Kette des Hundes. Der alte Schäferhund, der von Aloch als »einstdeutsch« bezeichnet wurde, begrüßte uns als Erster. Wir waren immer ein wenig verwundert, dass in dem Trauerhaus kein Licht zu erblicken war, dass alle schliefen, so als ob nichts passiere. Und dass es nicht gelingen würde, dem für niemanden angenehmen Wecken, den verschlafenen Gesichtern und den nächtlichen, uns küssenden Mündern zu entgehen.
Zunächst ein schüchternes, dann ein zweites Anklopfen und danach die blässliche Cousine Sabina in der Tür, der die Mutter einst, als es ihr schlecht ging, die Schlüssel übergeben hatte. Danach das Eintreten, das Hinstellen der Koffer und der Blick in die nach Knoblauch duftende Küche, während Sabina, noch immer in dem mit braunen Punkten bekleckerten Nachthemd, die Herdringe abnahm und Feuer machte. »Wie geht es der Tante?«, fragten wir, nachdem wir einen Moment gewartet hatten, um im Gegenzug das zwischen dem Kratzen der Schaufel erwiderte »Krank … Gestern war der Arzt da« zu hören.
Nach dem Frühstück, bei dem kaum gesprochen wurde, legten wir uns für zwei, drei Stunden hin; wir in unser kühles Bett, die blasse Sabine in ihr warmes, zu dem im ganzen Haus vernehmbar schnarchenden Aloch. Es schickte sich zu so früher Tageszeit nicht, in das von Krankheit erfüllte Zimmer der Tante hineinzuschauen. Sie schlief.
Während unserer Besuche erhielten wir immer dasselbe Zimmer. Auf der einen Seite des Korridors befand sich der Kuhstall, auf der anderen der Wohnbereich, von dem aber nur die Küche und die drei größten Stuben hergerichtet worden waren. Unsere Tür war die zweite in der Zimmerflucht, die dritte führte zu einer Stube, die nie genutzt wurde. Dahinter befand sich noch eine Stube mit Blick auf die Darre, das sogenannte Gästezimmer, das den Trauernden zur Verfügung gestellt wurde. Gerade hier sollte später, für ein paar Wochen, Marta wohnen.
Auch unsere Stube war, außer den zwei Betten und einigen Stühlen, von denen jeder einzelne einer anderen Garnitur entstammte, nicht eingerichtet. Als Tante Gienia einmal gefragt wurde, warum dort niemand wohne, erwähnte sie die Feuchtigkeit, die man zwar noch nicht spüre, aber die noch kommen werde, die unter dem Fußboden scharrenden Mäuse und noch etwas anderes … Sie gab mir aber niemals eine eindeutige Antwort.
Das Haus der Tante war mit allerlei Absonderlichkeiten vollgestopft, die für ein Kind unverständlich blieben. Oben der verwahrloste Dachboden voller Gerümpel, hinter dem Kuhstall der verfallende Keller, schließlich die in der Scheune stehenden, niemals in Gang gesetzten Maschinen. Dies alles formte sich zu einer unverständlichen und dadurch noch attraktiver werdenden Chiffre. Es wurden keine neuen Gebäude errichtet und nur selten nahm man Reparaturen am Gehöft vor. Sicherlich, keiner konnte in jenen Jahren wissen, wie lange er dort bleiben würde, aber man hätte doch die einstdeutschen Werkzeuge oder das niemals in Bewegung gesetzte und mit Grünzeug überwucherte Göpelwerk benutzen können. Zur Rechtfertigung von Frau Koperwas muss allerdings ergänzt werden, dass die Gerätschaften der Tante nicht die einzigen waren, die ungenutzt herumlagen. Jeder, der sich in jenen Jahren nach Pommern verirrte, konnte mit eigenen Augen wesentlich schlimmere Dinge erblicken.
Wir erhoben uns von unseren Schlafstätten, wenn das Haus schon lange auf den Füßen war. »Die Kinder sollen sich richtig ausschlafen, sie waren die ganze Nacht unterwegs, Gott verhüte, dass sie krank werden …«, rechtfertigte uns die von einem aufs andere Jahr schmaler werdende Sabine. Man weckte uns also erst, wenn das Mittagessen schon fertig war, sodass wir uns wieder schläfrig abermals an den Tisch setzten. Man erzählte, unterhielt sich und erkundigte sich nach unseren Angelegenheiten, also nach der Oma und der Schule; wir fragten umgekehrt nach der Tante, nach ihrem Befinden und der neuesten Entwicklung ihrer Erkrankung. Ich wusste, dass ich sie auch diesmal im gleichen Zustand erblicken würde. Dass wir wiederum ein ums andere Mal bei ihr hineinschauen würden, immerzu verlegen und desorientiert und selbst nach einigen Tagen nicht wissend, ob wir uns auf die Rückreise vorbereiten oder auf ihren Tod warten sollten.
Im Trauerhaus wurde natürlich nur halblaut gesprochen. Man fragte uns nach Marta, nach den Chancen für ihr Kommen und nach anderen Neuigkeiten, worauf wir aber nur wenig zu antworten wussten. Im Laufe der Jahre schrieb Marta immer seltener und beschränkte sich auf Postkarten, die sie zu bestimmten Anlässen verschickte. Ihre langen und auf Deutsch verfassten Briefe (sie hatte es ein wenig während der Besatzungszeit und später gut von Kurt gelernt) erhielt die Großmutter, die uns Kindern allerdings nicht erzählte, worauf sie sich bezogen.
Ich verbrachte alle Ferien in Koperwasy und das nicht nur deshalb, weil Gienia für mich einer engen Verwandten gleichkam, sondern aus dem einfachen Grund, weil es in den Nachkriegsjahren kaum Orte gab, wohin man reisen konnte. Allein hätte man mich nicht reisen lassen, und beide Kinder irgendwohin zu schicken, konnte sich die Großmutter nicht leisten. Um sich zu revanchieren, schickte Marta, meine Patin, etwas Geld, Pakete mit Kleidung und für die Erwachsenen Ansichtskarten, die man hinter die Scheibe der Anrichte steckte. Im Gegenzug wurden wir als Kinder von den Koperwasy ein wenig umsorgt.
Eine spezielle Betreuung ist in diesem Alter übrigens nicht nötig. Wir verbrachten viel Zeit damit, bei der Arbeit zu helfen, den Rest der Zeit verbrachte ich mit Streifzügen durch die Gegend oder in der immer interessanten Ziegelei mit ihrem ganzen System von Lehmhöhlen. Die Tante mochte mich wohl trotz all meiner Wunderlichkeiten und drückte mich öfters an sich als ihre echten Enkel, die sich das ganze Jahr über in ihrer Nähe aufhielten. Ich musste allerdings schon jetzt und etwas beschämt feststellen, dass die Aussicht auf ihren Tod mich nicht so richtig in Angst versetzte. Nicht nur deshalb, weil ich die mit der Möglichkeit ihres Ablebens verbundenen Zweifel der Erwachsenen wahrnahm, sondern weil ich selbst den Eindruck hatte, dass all das – diese ganzen Todesvorbereitungen – eine mit unbekanntem Ziel ausgedachte Inszenierung darstellten. Man hatte den Eindruck, dass Gienia, nachdem sie auf die Idee mit dem Todesspiel gekommen war, sie immer dann, wenn die Bedingungen günstig waren, in Szene setzte. Damals war noch niemand aus der Familie gestorben, es gab also keinen Grund, sich mit so extremen Lösungen zu beschäftigen. Auch der in der Nähe gelegene Friedhof weckte keine Unruhe. Sicher, ich ging da ab und zu hin und ich kannte schon das kleine Grab von Martas Kindern, aber all das, was aus einer anderen Epoche stammte, konnte die bestehende Bedrohung nicht anschaulich werden lassen.
Die fast alljährlichen Querelen mit der Tante sorgten für Situationen, denen ich niemals Glauben geschenkt hätte, wäre ich selbst nicht einmal ihr Zeuge geworden. Es geschah, wenn ich mich recht erinnere, im Herbst, nach einer der ersten Gesundungen. Es goss damals in Strömen, wohl an die zwei Wochen lang, und niemand wollte sich rühren. Es stellte sich aber heraus, dass Aloch hinausmusste, und zwar bis nach Sztum, um einen Auftrag zu stornieren. Ob er wollte oder nicht, er musste sich auf das nasse, unter der Dachtraufe stehende Fahrrad setzen und losfahren. Wegen der Blumen. Denn gerade damals hatten sie es, wie sich herausstellte, mit der Ausstattung übertrieben.
Seit dieser Zeit zahlte die Familie für die Blumen einen kleinen, immer wieder verfallenden Vorschuss, während sie bei anderen Einkäufen Abmachungen traf, die an konkrete Bedingungen geknüpft waren. Ich erfuhr nämlich, dass dies nicht die einzige Vorbereitung war und dass sich die engsten Verwandten der Tante schon seit einiger Zeit um die Ausstattung für ihren letzten Weg gekümmert hatten. Ich wunderte mich über diese Art zu denken, ich war sogar bestürzt, aber im Laufe der Jahre verstand ich, dass sie diese traurigen Probleme nicht so behandeln konnten, als würde zukünftig nichts geschehen.
Einige Dinge erledigte man früher, andere, die heikel waren, sah man für die letzte Stunde vor. Im Falle der Kleidung gelang es zum Beispiel, einen vorsichtigen, absolut vernünftigen Kompromiss zu schließen. Die von dem mehrjährigen Tanz erschöpfte Familie kam zum Ergebnis, keine Kleider zu kaufen, die sämtliche Merkmale von Einmaligkeit trugen, sondern sowohl das Kostüm als auch die Stiefel sorgfältig auszuwählen. Sie sollten der Tante länger als nur eine Saison dienen. Man vermied Schwarzes und wählte Brauntöne, die zu älteren Damen passten, und man ergänzte das Ganze um geschmackvolle Schuhe mit niedrigen Absätzen. Die schwarze Unterwäsche hatte die Tante selbst gekauft. Sie hob sie im Wäscheschrank auf dem Todesregal auf.
Es gab noch ein anderes Problem. Das war für ein Kind zwar sonderbar, aber nicht ganz so makaber. Viele alte Menschen, die sich eine Ruhestätte sichern möchten, kaufen auf dem Friedhof eine Parzelle und bereiten sie vor, indem sie einen Grabstein aufstellen und auf der Platte ihren Namen sowie den Namen ihres Ehepartners eingravieren lassen. Die Tante machte das auch. In ihrem Fall stellte sich die Angelegenheit allerdings einfacher dar als sonst. Es war bekannt, dass sie einzeln, auf Ewigkeit allein ruhen würde, weil sie weder verwitwet noch geschieden und schon gar nicht Jungfrau war.
Ich erinnere mich an sie und sehe immer wieder, wie sie aus dem Zug steigt, ihre Frisur automatisch richtet und – sich rasch aus der Menschenmenge lösend – entschlossenen Schrittes in Richtung Laden geht. Ich höre noch heute, wie sie mit ihren wohlgeformten, in Leder glänzenden Beinen den Asphalt bearbeitet. Leicht tragen die guten Schuhe den nicht gerade kleinen Körper, während sich das anmutige, hoch erhobene Köpfchen kaum bewegt. Ich sehe sie inmitten des Dorfladens mit dem vergitterten Fenster, mit den zwei Töchtern, die sich in ihrer Gegenwart schneller hinter der Theke bewegen als gewöhnlich. Die Tante macht sich an der Kasse zu schaffen, schaut in das Lager, füllt irgendwelche Rechnungen aus und setzt sich schon wieder in Richtung Wirtshaus in Bewegung, um die Höhe der für den Markttag bestimmten Lieferungen festzulegen.
Gienia, die auf der vom Regen glänzenden Straße entlangmarschiert, an der Kapelle den Gruß des Kirchendieners erwidert, das verrauchte Wirtshaus betritt (der Lärm ebbt respektvoll ab), das sind Bilder aus all meinen Ferien. Irgendwann einmal wurde dieses Portrait durch einen Spazierstock – einem Herrschaftszeichen gleich – ergänzt. Aber das war nur ein Detail. Ehrlich gesagt, hatte ich während meiner ganzen Kindheit den Eindruck, dass meine Tante außer während ihrer Krankheitsphasen wirklich unsterblich sei. Dass dies, wem sonst, wenn nicht ihr, ganz sicher gelänge. Gelingen müsse.
Sterben ist keine einfache Angelegenheit. Und auch nicht komisch. Man kann darüber zuweilen einen Scherz machen, wie man über ernste Dinge scherzt, also nur des Scherzes wegen. Das weiß man, selbst wenn man es nur einmal in seinem Leben mit einer nicht simulierten Agonie zu tun hatte. Deswegen wäre es falsch, anzunehmen, dass Gienia nach jedem ihrer Tode wieder so auferstand, als sei nichts gewesen, wie bis zur nächsten Folge einer nie endenden Serie. Das war durchaus nicht so. Die Tante behandelte den Tod mit vollkommenem, seiner Majestät angemessenem Ernst. Dies ergab sich aus der schrecklichen Überzeugung, dass diesmal – und bei jedem anderen Mal auch – ihr letzter Moment gekommen sei. Andernfalls wäre es von ihrer sowie von der Seite der Trauernden eine nie endende Komödie gewesen. Sicherlich, wir lächelten dümmlich vor uns hin, wie Kinder das so tun, allerdings nicht so sehr deshalb, weil wir nicht an den nächsten Akt dieses düsteren Trauerspiels glaubten, sondern weil wir nicht in der Lage waren, auf die uns über den Kopf wachsende Situation angemessen zu reagieren. Diejenigen, die die Wahrheit über die Erkrankungen der Tante kannten, waren sich der todbringenden Klinge bewusst, die in jedem Moment – einem Stilett gleich – den letzten Stoß setzen konnte.
Gut erinnere ich mich an das dunkelblaue Gesicht Gienias und die Gesichter der anderen. Und an die verzweifelten, unsere Blicke suchenden Augen. Ich fühle den stummen Druck der erlöschenden Hand auf meinem Arm und ebenso den stummen Mund, der nicht mehr wusste, was er noch fragen sollte. Ferner herrschte bereits jene gänzlich hoffnungslose Leere vor, durch die keinerlei Worte vordringen können.
Dass Gienia so oft an die Grenze des Zerfalls geriet – und so oft wieder zurückkam –, grenzte an ein Wunder. Man sieht, Wunder geschehen, ich selbst kann es bezeugen. Unabhängig davon spürte ich – trotz der glücklichen Rückkehr –, dass etwas, irgendeine Welt, zu Ende ging. Dass diese neue Welt, nach dem momentan aufgeschobenen Tod, ein wenig anders war. Die Leere nach dem Tode der Tante musste noch niemand füllen, aber leichte Verschiebungen waren zu bemerken. Jedes Mal übernahm einer der Hausgenossen einen Bruchteil ihrer vorherigen Anwesenheit. Die Erste war die schwächliche Sabina, danach der sich nicht nur um seine Dinge kümmernde Iryś und schließlich, nach dem Tode Sabinas, Aloch, der wie im Scherz – aber trotz allem – diese neuen Grenzen absteckte. Das Herrschaftsgebiet von Gienia Koperwas begann zu schrumpfen.