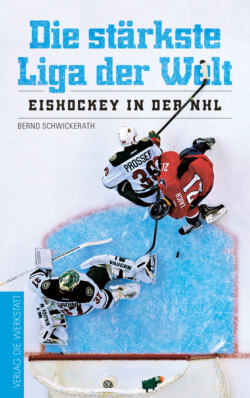Читать книгу Die stärkste Liga der Welt - Bernd Schwickerath - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1917 bis 1942
Eine Liga kämpft ums Überleben
Die NHL war mitnichten von Beginn an eine Erfolgsgeschichte. Nach wenigen Wochen waren nur drei Teams übrig, die neue Liga stand gleich wieder vor dem Aus. Auch danach gab es trotz zwischenzeitlicher Erfolgsphasen und neuen Teams in den USA immer wieder Probleme. Wirtschaftskrisen und Weltkriege brachten sie mehrmals an den Rand ihrer Existenz.
Ganze 16 Tage war die National Hockey League (NHL) alt, da standen die Zeichen bereits auf Abschied. Hätten die Funktionäre die neue Liga gleich wieder begraben, es hätte ihnen wohl niemand verübelt. Nicht nur, weil es damals ohnehin an der Tagesordnung war, dass professionelle Eishockey-Ligen kamen, gingen und schnell von der nächsten abgelöst wurden, sondern weil eine Liga wohl selten unter so schlechten Vorzeichen gestartet ist wie die NHL.
Die neue Eliteliga war ja alles andere als von langer Hand geplant und in Ruhe vorbereitet worden, sie war aus der Not geboren, um nach dem Ausscheiden des Armeeteams aus der alten National Hockey Association (NHA) neu anzufangen. Und natürlich um den verhassten Teambesitzer Eddie Livingstone loszuwerden. Ein erfolgreiches Unterfangen, denn in der NHL hatte der streitbare Mann aus Toronto nichts zu melden. Was allerdings nicht bedeutete, dass er sich geschlagen gab.
Nachdem ihn die übrigen Teambesitzer aus der NHA ausgetrickst und ihre eigene Liga ohne ihn gegründet hatten, zog sich Livingstone nicht etwa zurück, er begann eine Klagewelle, die die NHL über Jahre beschäftigen und an den Rande des Ruins treiben sollte. Und das alles, während die Funktionäre darum bemüht waren, die neue Liga zu etablieren. Was schwieriger war als gedacht, die ersten Bewährungsproben für Frank Calder, den Boss der neuen Liga, ließen nicht lange auf sich warten.
Calder, nach dem heute die Trophäe für den besten Rookie der Saison benannt ist, entwickelte sich zu einem Glücksfall für die Liga. Schnell erarbeitete er sich den Ruf, ein regelrechter Workaholic zu sein. Über Jahre war er der einzige Angestellte der NHL, er hatte nicht mal eine Bürohilfe. Trotzdem navigierte er die Liga durch die stürmischen ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts mit ihren Weltkriegen und Wirtschaftskrisen.
Dabei hatte Frank Calder mit Eishockey ursprünglich gar nichts am Hut. Als er 1900 als Engländer mit schottischen Wurzeln nach Kanada übersiedelte, gab es für ihn lediglich Fußball, Rugby und Cricket. Während seiner Zeit als Privatlehrer und später als investigativer Journalist für den „Montreal Witness“ und den „Montreal Herald“ war er bei diversen Teams und Ligen in den Sportarten aus seiner alten Heimat aktiv. Erst 1914 wurde er von den NHA-Bossen verpflichtet, die Finanzen der Liga im Auge zu behalten. Das tat er so umsichtig, dass ihn die neue NHL als Präsident verpflichtete. Für 800 Dollar pro Saison, wie D’Arcy Jenish in seinem Buch über die NHL schreibt.
Für die musste er mächtig rackern. Als Erstes ging es darum, das Fehlen des verhassten Eddie Livingstone und seiner Mannschaft aus Toronto zu kompensieren. Ohne einen Verein aus einer der wichtigsten Städte Kanadas brauche die NHL gar nicht erst an den Start gehen, hieß es. Also installierte Calder mithilfe der Besitzer der örtlichen Arena einen neuen Verein in Toronto, der sich wenig kreativ Toronto Arenas nannte. Doch das nächste Problem ließ nicht lange auf sich warten: Das Team aus Québec verabschiedete sich noch vor dem ersten Bully. Die Bulldogs hatten finanzielle Probleme und gaben bekannt, gleich in der ersten Spielzeit auszusetzen.
So blieben nur noch vier Teams übrig, die jeweils 24 Spiele absolvieren sollten, bis der Sieger der Hinrunde im Finale auf den Sieger der Rückrunde trifft: die Montréal Canadiens, die Montréal Wanderers, die Ottawa Senators und die neuen Toronto Arenas. Das waren zwar nicht viele, für die Premierensaison sollte das aber reichen. Zumal sich der Saisonstart am 17. Dezember 1917 verheißungsvoll anließ. Volle Hallen, große Medienaufmerksamkeit und eine Leistung für die Ewigkeit: Joe Malone von den Montréal Canadiens schoss gleich am historischen ersten Spieltag fünf Tore beim 7:4-Sieg über die Senators. Am Ende der Saison hatte Malone sogar 44 Treffer in 20 Spielen erzielt. Die bis heute beste Torquote und eine absolute Zahl, die Maurice Richard erst 25 Jahre später knacken sollte. Für seine 50 Tore brauchte er allerdings 50 Spiele.
Gehasst, gefürchtet, ausgetrickst: Eddie Livingstone war der umstrittenste Funktionär der NHL.
Montréals Halle brennt ab – da waren es nur noch drei
Doch die gute Laune in der neuen NHL hielt nicht mal drei Wochen. Am 2. Januar 1918 passierte das Undenkbare: Am Morgen des Derbys zwischen den Montréal Canadiens und den Montreal Wanderers brach ein Feuer in einer Kabine der Westmound Arena aus, die bis auf die Grundmauern niederbrannte. Das Stadion, Heimat von Wanderers und Canadiens, war 1898 extra für Eishockey konzipiert worden, bot 10.000 Zuschauern Platz und hatte als erste Halle überhaupt einen knapp 1,20 Meter hohen Zaun um das Spielfeld gespannt, was stilbildend wurde und das Eishockey-Spiel für immer veränderte, weil jetzt über Bande gespielt werden konnte. Nun war das Stadion binnen weniger Stunden Geschichte. Und mit ihm die Wanderers. Vergeblich baten sie die Konkurrenz um finanzielle Hilfe.
1898 extra für Profi-Eishockey gebaut: die Westmount Arena in Montréal. (Foto: Arthur Farrell)
Am 2. Januar 1918 brannte die Westmound Arena bis auf die Grundmauern nieder. (Foto: Alfred Walter Roper)
Für die Liga war das eine mittelschwere Katastrophe. Nicht nur, weil nun nur noch drei Teams übrig waren, was nicht mal für zwei Partien pro Spieltag reichte, sondern weil die Wanderers eine Institution waren. Heute sind sie fast vergessen, damals waren sie das erfolgreichste und berühmteste Eishockey-Team der Liga, ja vielleicht ganz Kanadas. Die Wanderers waren eine der ersten Profimannschaften des Landes und hatten nicht nur diverse Ligen durchlaufen und überlebt, sondern zwischen 1906 und 1910 auch viermal den Stanley Cup gewonnen. Während die Canadiens von den französischsprachigen Einwohnern in Montréal geliebt und gefeiert wurden, waren die Wanderers das Team, das die englischsprachigen Fans weit über die Stadtgrenzen hinaus begeisterte.
Zwar hatten die Wanderers spätestens seit Beginn des Ersten Weltkriegs wichtige Spieler und den Anschluss an die Konkurrenz verloren, ihr Name stand aber weiterhin für Erfolg und Glanz. Folglich spielten sie in den Planungen der NHL eine Hauptrolle: Sie sollten das Zugpferd für die neue Liga werden. Doch kaum hatte die begonnen, waren die Wanderers auch schon wieder weg. Nicht jedoch, ohne sich auf ewig einen Platz im Geschichtsbuch der NHL gesichert zu haben. Einen, der ihnen nicht mehr genommen werden kann: War es doch Dave Ritchie von den Wanderers, der das historische erste Tor der NHL-Geschichte erzielte.
Parallel dazu standen auch die Canadiens und damit gleich die ganze Liga vor dem Aus. Hätten die Macher den Stecker gezogen, die NHL wäre heute kein Synonym für Weltklasse-Eishockey, sie wäre als die größte Pleitengeschichte in die Historie der Sportart eingegangen. Doch dazu kam es nicht, weil die Canadiens einen Mann hinter sich hatten, der das Team sowie die Liga rettete: George Kennedy.
Als Aktiver war Kennedy Ringer, später organisierte er im französischen Teil Montréals Ringerkämpfe mit Athleten aus aller Welt. Selbst aus der Türkei ließ er sie kommen. Zudem bildete er Boxer aus und ließ sie vor Publikum antreten. Zum Eishockey war er erst später gekommen, verliebte sich aber sogleich in den Sport und kaufte 1910, nur wenige Monate nach deren Gründung, die Montréal Canadiens. Gleich darauf änderte er ihre Farben, kreierte ein neues Wappen und brachte die französischsprachige Arbeiterklasse, die sich jahrelang seine Ringer- und Boxkämpfe angesehen hatte, dazu, auch die Canadiens zu unterstützen. Zudem sorgte er dafür, dass sie in der kleinen Jubilee Arena tief im französischen Teil der Stadt unterkamen. Zwar konnten sie dort nur noch etwas mehr als 4000 Zuschauer begrüßen, hatten nur drei Tage nach dem Brand aber ein neues Zuhause. So kam frisches Geld in die Kasse, die Canadiens lebten im Gegensatz zu den Wanderers weiter. Und so legte Kennedy das Fundament, auf dem der berühmteste Eishockey-Verein der Welt seit nun mehr als 100 Jahren steht.
Das konnte damals allerdings niemand ahnen. Vielmehr stand die komplette NHL vor dem Aus. Ganze 16 Tage nach dem Saisonstart gab es eine Halle weniger, von den ursprünglich angedachten fünf Teams waren nur noch drei übrig, wovon eins eine viel zu kleine Halle hatte, und nebenbei gab es noch Rechtsstreitigkeiten mit Eddie Livingstone. Zudem waren diverse Spieler auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs in Europa oder längst gestorben. Der „Toronto Globe“ schrieb nicht umsonst: „Das professionelle Eishockey pfeift aus dem letzten Loch.“
Trotzdem schafften es die drei Teams irgendwie, die erste NHLSaison hinter sich zu bringen. Am Ende standen sich die Montréal Canadiens und die Toronto Arenas im Finale gegenüber, das die Arenas gewannen und sich so für das Stanley-Cup-Finale gegen den Meister der Pacific Coast Hockey Association (PCHA) qualifizierten. Die Liga aus dem Westen bereitete der NHL zusätzliche Sorgen, warb sie doch weiter gute Spieler ab und drehte an der Gehaltsschraube. Trotzdem setzten sich die Arenas gegen die Vancouver Millionaires durch und gewannen den Stanley Cup. Für die NHL die erste gute Nachricht dieser so schwierigen Premierensaison. Und ein Zeichen nach innen und außen, dass es weitergehen sollte.
Es ging dann auch weiter. Obwohl Livingstone ernst machte. Er hatte schließlich immer noch kein Geld für die Spieler erhalten, die ursprünglich bei seinem NHA-Team gespielt hatten, nun in der NHL aktiv waren und teilweise mit den Arenas Meister geworden waren. Knapp 20.000 Dollar forderte er, bekam vom Arenas-Management aber lediglich ein Angebot über 7000, was er ablehnte. Stattdessen gründete er neue Ligen, die der NHL Konkurrenz machen sollten. Zunächst versuchte er, die NHA wiederzubeleben, dann gründete er die Canadien Hockey Association und verbot einigen seiner Ex-Spieler, weiter in der NHL zu spielen. Stattdessen sollten sie in seiner neuen Liga aufs Eis gehen. Was sie aber nicht taten.
Trotzdem ging es mit den Toronto Arenas bergab. Sportlich und wirtschaftlich, da die Zuschauer des ersten NHL-Meisters ausblieben. Teilweise kamen nicht mal mehr 3000. Bereits zwei Wochen vor dem Ende der zweiten Saison zogen die Besitzer ihr Team zurück, was Liga-Boss Frank Calder wieder mal seine Flexibilität beweisen ließ: Er legte fest, dass die Finalserie zwischen den übrig gebliebenen Teams aus Montréal und Ottawa einfach verlängert wurde, indem man sie im „Best of seven“-Modus (d. h.: vier Siege sind notwendig) ausspielen ließ. Montréal gewann, konnte den Erfolg der Arenas im Stanley-Cup-Finale gegen den Sieger der PCHA aus dem Westen aber nicht wiederholen. Während der Serie gegen die Seattle Metropolitans brach die Spanische Grippe aus. Diverse Spieler erkrankten, Canadiens-Verteidiger Joe Hall starb gar, beim Stand von 2:2 wurde die Serie abgebrochen, es gab keinen neuen Stanley-Cup-Sieger.
Im dritten Jahr geht es bergauf
Im Sommer vor der dritten Saison stand es also erneut nicht gut um die NHL. Von den ursprünglichen fünf Teams waren nun nur noch zwei übrig. Gerüchte um das Ende der Liga machten wieder mal die Runde. Doch Calder schaffte es erneut, sie zu retten. Erst verkauften die Arenabesitzer aus Toronto ihr Team, das von den neuen Bossen in Toronto St. Patricks umbenannt wurde, um die irisch-stämmigen Einwohner Ontarios anzulocken. Parallel bauten die Canadiens in Montréal eine neue Halle für 6500 Zuschauer, während die Québec Bulldogs bekanntgaben, endlich am Spielbetrieb teilzunehmen – und plötzlich lief es.
Das Land erholte sich langsam vom Weltkrieg, die Menschen interessierten sich wieder mehr für den Sport. Zeitungsartikel aus der damaligen Zeit beschreiben Spiele, bei denen die Polizei einschreiten musste, um die Fans abzuhalten, ins Stadion zu stürmen, weil es keine Tickets mehr gab. Hunderte harrten stundenlang in der Kälte vor den Hallen aus, um wenigstens etwas von der Atmosphäre mitzubekommen. Es gab sogar erste Sonderzüge für Auswärtsfans, die ihren Teams nachreisten. „Montréal ist wie Ottawa und Toronto verrückt nach Eishockey“, fasste der „Montreal Citizen“ die neue Euphorie um die NHL zusammen.
Der neue starke Mann: NHL-Präsident Frank Calder.
Doch wie immer in der Frühphase der neuen Liga: Lange hielt die gute Stimmung nicht an. Québec gab nach nur einem Jahr wieder auf – trotz der 39 Tore, die Rückkehrer Joe Malone für die Bulldogs erzielt hatte. Zudem machte Eddie Livingstone nun ernst mit seiner Canadien Hockey Association. Er plante, zwei Teams in Toronto zu installieren, eins im Norden der USA und eins in Hamilton. Vor allem Letzteres bereitete der NHL Sorgen, Hamilton war eine wichtige Stahlstadt mit einer Eishockey-begeisterten Bevölkerung, erfolgreichen Amateurteams und den fünftmeisten Einwohnern Kanadas. Zudem gab es dort eine brandneue Halle für 7500 Zuschauer.
Diesen Markt wollte NHL-Boss Frank Calder nicht Eddie Livingstone überlassen. Doch anstatt direkt über Hamilton zu verhandeln, ging er den Umweg über Toronto. Dort sah zunächst alles nach einem Sieg für Livingstone aus, der nach einer weiteren Klage endlich Recht und von den Arena-Besitzern 20.000 Dollar als Kompensation für seine Spieler zugesprochen bekam, die in der NHL gespielt hatten. Weil die Arenabesitzer das nicht zahlen konnten, meldeten sie Konkurs an, was Livingstone dazu veranlasste, einen weiteren Rechtsstreit zu riskieren: Nun wollte er als Kompensation gleich die ganze Arena haben. Dort hätte er seine Klubs spielen lassen und die der NHL ausschließen können.
Doch den zweiten Rechtsstreit verlor er, der Richter sah ihn als einen von vielen Gläubigern der Konkurs gegangenen Arenabesitzer an, nicht als den wichtigsten. So behielt der Konkursverwalter weiter die Kontrolle über die Arena. Und mit dem hatte NHL-Boss Frank Calder längst einen Vertrag geschlossen. So stand Livingstone plötzlich ohne Eis in Toronto da, was seine komplette Liga scheitern ließ. Der gewiefte Frank Calder wiederum nutzte die Gunst der Stunde und verlegte sein kurz zuvor gescheitertes Franchise aus Québec nach Hamilton, wo es sich fortan Tigers nannte. Ein Sieg auf ganzer Linie für die NHL, die danach für ein paar Jahre Ruhe hatte.
Sportlich dominierten nun die Ottawa Senators, die binnen fünf Jahren drei Stanley Cups gewannen. Gleichzeitig waren es die letzten Jahre, in denen es für Frank Calder und die Besitzer der NHL-Teams ausschließlich darum ging, irgendwie zu überleben. Mit vier soliden Teams und einer gewachsenen Fanbasis sollte nun das nächste Kapitel aufgeschlagen werden. Eins, das die NHL für immer veränderte: der Gang über die Grenze in die USA.
Von vier auf zehn: Es geht in die USA
Bereits während der Saison 1923/24 wurden die Pläne, in den Süden zu expandieren, konkret. Nur brauchte es dafür reiche Geschäftsleute, die willens waren, Teams in ihren Städten zu unterhalten. NHL-Boss Frank Calder hatte sofort ein Auge auf Charles Adams geworfen, einen sportverrückten Millionär aus der Gegend um Boston. Adams, der aus einfachen Verhältnissen stammte, hatte sich über seine Jobs in einer Ahornsirup-Fabrik und in einer Bank zum Besitzer der größten Lebensmittelmarkt-Kette in New England hochgearbeitet. Und da er ein ausgemachter Freund von Pferderennen, Baseball und Eishockey war, lud ihn die NHL im März 1924 zum Finale nach Montréal ein. Zu sehen gab es das Spiel zwischen den heimischen Canadiens und den Ottawa Senators. Was es aber vor allem zu sehen gab: den ebenso jungen wie aufregenden Torjäger Howie Morenz. Adams soll sogleich begeistert gewesen sein, nur sorgte er sich, ob es wirklich so einfach sei, „diesen kanadischen Sport“ in den USA zu verkaufen.
Adams war längst nicht der einzige Interessent, der ein neues NHLTeam an den Start bringen wollte. Während derselben Finalserie meldete sich der New Yorker Boxpromoter Tex Rickard zu Wort, er habe mit der Liga verhandelt und werde für die kommende Saison ein Team im Madison Square Garden mitten in Manhattan installieren. Auch aus Providence in Rhode Island, nicht mal 100 Kilometer südlich von Boston, schlug ein Geschäftsmann beim Finalspiel auf und bekundete Interesse. Zudem gab es eine Gruppe Investoren aus Montréal, die ein neues Team für die englischsprachige Bevölkerung der Stadt gründen wollten. Die nötige Halle würden sie gleich selbst bauen, sagten sie. Und als wäre das nicht schon genug, meldeten sich auch noch mögliche Finanziers für ein zweites Team in Toronto sowie eins in Philadelphia.
Spätestens da wurde es Ligaboss Calder zu bunt, er berief eine Sondersitzung der Teambesitzer ein. Die erteilten ihm die Erlaubnis, mit den vielen potenziellen Investoren zu reden, bevor diese auf die Idee kämen, ihre eigene Liga zu gründen und der NHL vor der Haustür Konkurrenz zu machen. Eine Situation wie im Westen Kanadas, wo sich mit der Pacific Coast Hockey Association und der 1921 gegründeten Western Canada Hockey League zwei große Profiligen um die Vorherrschaft in einer Region stritten, wollten sie im Osten vermeiden.
Trotzdem wuchs die NHL zur Saison 1924/25 zunächst nur um zwei Teams. Das mögliche neue aus New York musste seinen Start verschieben, weil sich die Besitzer des Madison Square Gardens dazu entschieden, die Halle abzureißen und für knapp 18.000 Zuschauer eine neue zu bauen. Andere Investoren zogen ebenfalls vorerst zurück. Ernst machten lediglich Charles Adams aus Boston und die Gruppe steinreicher Männer aus Montréal. Am 12. Oktober 1924 bekamen sie offiziell den Zuschlag, die NHL bestand nun aus sechs Teams, eins davon kam erstmals aus den USA.
Die Mannschaft aus Boston verpflichtete gleich den erfahrenen Ex-Spieler Art Ross, der für die folgenden 30 Jahre die sportlichen Geschicke der neuen Bruins bestimmen sollte. Heute ist nach ihm die Trophäe für den besten Scorer der Regular Season benannt. Das neue Team aus Montréal wollte zunächst ohne Spitznamen auskommen und nannte sich schlicht Montreal Professional Hockey Club, wegen der kastanienbraunen (Englisch: maroon) Trikots setzte sich aber schnell der Name Maroons durch.
Während eben jene Maroons sofort ein Publikumsmagnet für die englischsprachige Bevölkerung Montréals wurden und vor allem die Fans der ehemaligen Wanderers anzogen, hatten die neuen Bruins im knapp 500 Kilometer entfernten Boston große Probleme. Nicht nur sportlich wollte es nicht klappen, es kamen auch kaum Zuschauer. Was daran lag, dass die Halle nur montags frei war, die Begegnungen also zu wenig attraktiven Zeiten stattfanden. Manches Amateurspiel, das am Wochenende in derselben Halle ausgetragen wurde, lockte weit mehr Fans an. Bereits während ihrer ersten NHL-Saison gab es Gerüchte, die Bruins würden nach dem einen Winter gleich wieder aufgeben.
Doch die Probleme in Boston wurden schnell von weitaus größeren überschattet. Und das ausgerechnet beim Überraschungsteam der Saison. Nach Jahren am Tabellenende standen die Hamilton Tigers plötzlich ganz oben und sorgten für eine wahre Euphorie rund um das Team. Bis ins Finale kämpfte sich die Mannschaft aus der Stahlstadt. Doch kurz vor den wichtigsten Spielen der Vereinsgeschichte gingen die Spieler in den Streik. Sie verlangten ein höheres Gehalt. 200 Dollar mehr sollten es sein, weil sie wegen der beiden neuen Teams nun nicht mehr 24 Spiele wie in den Jahren zuvor, sondern 30 Spiele absolvieren mussten – ohne dafür besser bezahlt zu werden. Das Management lehnte ab und bekam Unterstützung von NHL-Boss Frank Calder. Der Vertrag der Spieler gelte von Dezember bis März, eine konkrete Anzahl Spiele stehe dort nicht drin, ließ er verlauten. Es liege an den Spielern, ob sie antreten, er habe kein Problem damit, wenn sie es nicht täten, sagte Calder.
48 Stunden später machte er ernst: Er kürte die Montréal Canadiens, die die Toronto St. Patricks im Halbfinale besiegt hatten, zum Meister.
Glamour und Mafia – die NHL zieht nach New York
Für die Fans und Spieler in Hamilton kam es noch dicker: Wenige Wochen später war ihr ganzes Team Geschichte. Das Management der Tigers hatte bereits während des Streiks angekündigt, als Vergeltung jeden einzelnen Spieler verkaufen zu wollen. Nun tat es das – für 75.000 Dollar an das neue Team aus New York, das kurz zuvor aus zwei Gründen eine Lizenz aus dem NHL-Büro erhalten hatte: Weil der neue Madison Square Garden fertig war und weil ein alter Bekannter mal wieder auf der Bildfläche auftauchte: Eddie Livingstone.
Der ließ, all den gescheiterten Versuchen zum Trotz, immer noch nicht locker und wollte erneut seine eigene Eishockey-Liga gründen. Dieses Mal habe er Investoren für Teams in New York, Toronto, Montréal, Pittsburgh und Philadelphia an der Hand, behauptete er. Doch bevor Livingstone Nägeln mit Köpfen machen konnte, nahm die NHL selbst ein Team aus New York auf und begoss das mit einer exklusiven Gala für 300 geladene Gäste im legendären Biltmore Hotel. Dafür schickte jedes Team diverse Repräsentanten nach New York, zudem reisten Dutzende Journalisten an. Nur der Besitzer des neuen Teams kam nicht.
Der hieß nun doch nicht Tex Rickard. Der Boxpromoter, der den Garden umgebaut hatte, verkaufte die neuen New York Americans noch vor ihrem ersten Spiel an William Dwyer. Dwyer hieß allerorten nur „Big Bill“, und das nicht nur, weil er in der Tat ein großer Mann war. Dwyer galt als eine der bekanntesten Unterweltgrößen New Yorks und war während der Prohibition mit Alkoholschmuggel stinkreich geworden. Er importierte Hochprozentiges aus Europa, Kanada und der Karibik – mit Schnellbooten, die denen der Küstenwache spielend leicht davonrasten. Sein Geld investierte er gern in den Sport. Vor den Americans gehörte ihm eine Rennstrecke, später weitere Eishockeyund Football-Teams.
Bei einem prunkvollen Abend gegründet, geführt von einer Unterweltgröße: die New York Americans.
Boxpromoter Rickard half trotzdem mit, den Sport populärer zu machen. Wegen seiner Kontakte veröffentlichte die „New York Times“ zwei Tage vor dem ersten Spiel die Eishockey-Regeln. Rickard selbst ließ draußen vor der Halle extra ein paar Krankenwagen aufstellen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Seht her, dort drin wird es heute blutig, sollte das heißen. Der Vermarktungsprofi drückte dieselben Knöpfe, die es schon im alten Rom gegeben hatte: Der Kampf um Leben und Tod zog die Massen schon immer in ihren Bann.
Die Americans blieben nicht das einzige US-Team, das im Sommer 1925 dazukam. Noch am Abend der rauschenden Gala in New York bekam James Callahan, ein Anwalt aus Pittsburgh, dem die örtlichen Yellow Jackets gehörten, die Genehmigung, ebenfalls in der NHL zu starten. Das gefiel zwar nicht jedem, die Delegation aus Ottawa warnte vor zu schnellem Wachstum, konnte sich aber nicht durchsetzen. Pittsburgh war nicht nur einer der Märkte, in denen sich Eddie Livingstone mit seiner Konkurrenzliga tummeln wollte, sondern galt früh als Eishockey-verrückt, außerdem gab es dort eine große Halle. Bereits kurz nach der Jahrhundertwende kamen in Pittsburgh 10.000 Fans, um Testspiele eines Teams aus Toronto zu sehen. Später beheimatete die Stahlstadt eine der ersten Profimannschaften der USA. Nun wurde Pittsburgh der dritte US-Standort der NHL, noch vor dem erstem Spiel änderte Callahan den Namen seines Verein in Pirates, als Hommage an das große Baseball-Team der Stadt.
Das große Geld
Mit dem Einstieg der US-Teams Nummer zwei und drei zur Saison 1925/26 änderte sich die Kultur der Liga schlagartig. Noch im selben Sommer begann das große Feilschen um die Spieler. Die Funktionäre aus New York, Boston und Pittsburgh lockten die kanadischen Spieler mit unverschämt wirkenden Summen über die Grenze. 5000, 6000 oder gar 7000 Dollar für die viermonatige Saison waren nun an der Tagesordnung. Ein durchschnittlicher Arbeiter verdiente im ganzen Jahr keine 1500 Dollar. Auch Ablösesummen stellten kein Hindernis dar. Die US-Teams boten einfach 25.000 bis 30.000 Dollar für einen Topspieler, den Kanadiern blieb kaum etwas übrig, als zu verkaufen.
Schnell kamen in den Zeitungen nördlich der Grenze erste Klagen auf, das alte kanadische Spiel werde amerikanisiert, der Gang in die USA sei ein großer Fehler gewesen, den die NHL noch bereuen werde. Es war der Anfang der Eishockey-Rivalität zwischen den beiden Nationen. Bis heute beschweren sich die Kanadier darüber, die US-Amerikaner würden ihnen die besten Spieler wegnehmen und mit ihnen dafür sorgen, dass die Teams aus dem Mutterland des Sports keinen Stanley Cup mehr feiern dürfen. Erste Rufe nach einer Gehaltsobergrenze wurden laut. Sie blieben ungehört.
Sportlich reichte es dennoch nicht für den großen Wurf eines US-Teams. Zwar ließen alle drei sofort die Montréal Canadiens und die St. Pats aus Toronto hinter sich, gegen die Montreal Maroons und die Ottawa Senators hatten sie aber keine Chance. Am Ende gewannen die Maroons die Meisterschaft und holten gegen die Victoria Cougars aus der PCHA auch den Stanley Cup.
Doch was den Glamour-Faktor angeht, standen die Americans ganz oben. Eine Halle wie den von Boxpromoter Tex Rickard umgebauten Madison Square Garden hatte die Welt noch nicht gesehen. Spiel für Spiel traf sich die Prominenz der Stadt auf den Tribünen. Für die wurde der Garden extra auf 15 Grad geheizt, man wolle ja nicht, dass „die Damen frieren, wenn sie hier in ihren luftigen Abendkleidern sitzen ohne einen Umhang auf den Schultern“, hieß es. Das machte sich allerdings in Sachen Eisqualität bemerkbar, was die Spieler immer wieder kritisierten, erst spät lenkte Rickard ein. Trotzdem wurden die Americans, die zu einem Großteil aus dem Hauptrunden-Meisterteam aus Hamilton aus dem Vorjahr bestanden, nur Fünfte in der auf sieben Teams angewachsenen NHL.
Tragisch verlief die Saison derweil für die Canadiens aus Montréal. Nicht nur, dass sie den letzten Platz belegten und mitansehen mussten, wie ihr neuer Konkurrent aus der eigenen Stadt den Titel gewann, sie verloren auch ihren Startorhüter Georges Vézina. Der infizierte sich mit Tuberkulose und starb während der Saison. Ihm zu Ehren ist bis heute die Trophäe für den besten Goalie der Saison benannt.
Finanziell ging es der Liga trotzdem immer besser. Der Gang in die USA war ein Erfolg für die NHL und die Vereine an sich. Da überraschte es wenig, dass im folgenden Sommer 1926 die nächsten Investoren anklopften, um in die Liga zu kommen. Die 1920er, „das goldene Zeitalter des Sports“, wie sie in Nordamerika genannt werden, waren in vollem Gange. Der gestiegene Wohlstand der Bevölkerung sorgte für volle Stadien, die immer populärer werdenden Medien – vor allem Radio und Zeitungen – taten ihr Übriges. In zahlreichen Sportarten wuchsen Helden heran, erste Legenden und Mythen entstanden, allerorten wurden neue Stadien gebaut und Teams gegründet. Allein im Madison Square Garden fand fast jeden Abend etwas anderes statt: Boxkämpfe, Rad- und Motorradrennen, Basketball- und Eishockey-Spiele.
Selbst die 50.000 Dollar, die die NHL von neuen Teams mittlerweile als Eintrittsgeld verlangte, schreckten niemanden mehr ab. Obwohl das im Vergleich zu den 15.000 Dollar, die die jüngsten Mitglieder des exklusiven Eishockey-Zirkels zahlen mussten, mehr als dreimal so viel war. Trotzdem kamen Anfragen aus New Jersey, Hamilton, Cleveland, Windsor, Detroit und Chicago. Auch Garden-Besitzer Rickard wollte plötzlich wieder mehr sein als nur der Mann, dem die Halle gehörte. Die Americans waren ein so großer Erfolg, dass er überlegte, ein zweites Team in Manhattan zu installieren. Und so kam es dann auch: Die New York Rangers waren geboren.
Weitere Zuschläge sollten nur noch zwei andere Städte erhalten: Detroit und Chicago, die Metropolen an den großen Seen im Zentrum des Landes. Wieder gab es Kritiker, die Liga übernehme sich, wenn sie gleich die nächsten drei Teams dazu hole. Doch erneut zog das alte Argument, dass sich sonst eine andere Liga die wichtigen Märkte sichern würde. Also bekamen auch Chicago und Detroit den Zuschlag. Black Hawks und Cougars wurden die NHL-Teams neun und zehn. Erstmals gab es mehr Teams aus den USA als aus Kanada. Ein Umstand, der sich bis heute nicht geändert hat.
West-Ligen geben auf – die NHL setzt sich endgültig durch
Ein Problem war allerdings nicht wegzudiskutieren: Wo sollen all die Spieler herkommen? Gibt es überhaupt genügend Talente? Helfen sollten ausgerechnet die zwei Brüder, die der NHL in den Jahren zuvor so viel Kopfzerbrechen bereitet hatten: Frank und Lester Patrick und ihre Profiliga im Westen. Die beiden Funktionäre hatten längst erkannt, dass sie den Kampf gegen die Teams aus den einwohner- und wirtschaftsstarken Metropolen aus dem Osten nicht gewinnen konnten. Bereits 1924 hatten sie ihre Pacific Coast Hockey Association aufgelöst und die übrigen beiden Teams in die 1921 gegründete Western Canada Hockey League integriert. Doch auch das half nichts, die Spieler verlangten NHL-Gehälter, die die Teams der mittlerweile in Western Hockey League umbenannten Liga nicht zahlen konnten. Nun stand auch die WCHL vor dem Aus.
Bereits während des Stanley-Cup-Finals 1926, das die Montreal Maroons gegen die Victoria Cougars gewannen, kontaktierten die Pat-rick-Brüder ihren alten Freund Art Ross von den Boston Bruins. Ross vermittelte ein Treffen mit Bruins-Besitzer Charles Adams, der nicht lange zögerte und für 250.000 Dollar gleich die ganze West-Liga kaufte. Einige Spieler behielt er für sein Team, den Rest versteigerte er, vor allem unter den neuen Teams aus Chicago und Detroit. So wechselten Spieler wie George Hainsworth, Herb Gardiner, Eddie Shore, Dick Irving, Frank Frederickson oder Frank Boucher Richtung Osten. Die NHL hatte erneut auf ganzer Linie gesiegt.
Symbolisch dafür stand der Stanley Cup. Ab 1927 musste ihr Meister nicht mehr mit dem einer anderen Liga um die berühmte Trophäe spielen, nun bekam sie der NHL-Sieger automatisch. Zehn Jahre nach ihrer Gründung hatte sie den Verlust mehrerer Teams, eine abgebrannte Halle, den Stress mit Eddie Livingstone und die Kämpfe mit Konkurrenzligen überlebt, sie war auf zehn Teams angewachsen und in vielen der wichtigsten Städte Kanadas und der USA zu Hause.
Mit der neuen Größe änderte sich erstmals auch das Format der Liga. Ab der Saison 1926/27 sollte es zwei regionale Gruppen geben: die „Canadien Divison“ mit Ottawa, den beiden Teams aus Montréal, Toronto und den New York Americans sowie die „American Division“ mit den Rangers, den Bruins sowie den Teams aus Pittsburgh, Chicago und Detroit. Um mehr Geld zu verdienen, wurde mal wieder die Anzahl der Spiele erhöht. 44 Spiele hatte nun jedes Team, deswegen ging es erstmals bereits im November los.
Das ließ sich auch gut an, vor allem in Chicago, wo das neue Team eine Attraktion wurde. Ebenso in New York, wo es mittlerweile normal war, dass Filmstars und sonstige Prominente das symbolische erste Bully ausführten. Probleme gab es eher nördlich der Grenze. Und das ausgerechnet beim Serienmeister und Topteam aus Ottawa. Während die Senators auswärts eine Attraktion waren, lockten sie zu Hause kaum noch mehr als 3500 Zuschauer an. Also forderten sie von der Liga, den Satz, der das Auswärtsteam an den Ticketverkäufen beteiligt, von 3,5 auf 15 Prozent zu erhöhen, doch das lehnten die anderen Teambesitzer ab. Zuschauer- und dadurch finanzielle Probleme gab es auch in Toronto.
Die aktuellen Besitzer der St. Pats hatten nach Jahren des sportlichen Misserfolgs genug gesehen und waren kurz davor, das Team für 200.000 Dollar nach Philadelphia zu verkaufen. Wäre da nicht der umtriebige Conn Smythe gewesen, 1926 für einige Monate Trainer der New York Rangers. Smythe trommelte öffentlich für den Erhalt des Teams, verhandelte mit den aktuellen Besitzern und versprach nicht nur, neue Investoren zu finden, sondern sich persönlich um die sportlichen Geschicke des Teams zu kümmern. Ende Januar 1927 hatte er das Geld beisammen.
Als Zeichen des Neuanfangs änderte er gleich auch noch Namen und Wappen, um nicht nur die irisch-stämmigen, sondern alle Einwohner zu erreichen. Außerdem klang ihm der alte Name zu katholisch, was nicht gut ankommen würde unter den sich überlegen fühlenden Protestanten. Um an deren Patriotismus zu appellieren, sollte das Trikot künftig das kanadische Ahornblatt zieren, was auch auf Landesfahne und Soldatenuniform zu sehen ist. So wurden aus den grünen St. Patricks die blauen Maple Leafs – der bis heute wohl aufregendste Eishockey-Verein der Welt war geboren.
Die Zeit der Riesenarenen
Es folgte eine kurze Phase der Stabilität. Über drei Jahre kam kein neues Team dazu, kein bestehendes musste aufgeben. Zudem eröffneten ständig neue Hallen, bei deren Planung Eishockey eine große Rolle gespielt hatte: Nach dem Neubau Ende 1925 in New York (17.500 Plätze) folgten Ende 1927 Detroit (16.700 Plätze), im Herbst 1928 Boston (13.900), ehe im Frühling 1929 die spektakulärste Halle von allen kam: das Chicago Stadium für 20.000 Zuschauer, größer als der Madison Square Garden und mit allem Komfort ausgestattet, den man sich nur vorstellen kann. Während in Europa selbst Jahrzehnte später meist pragmatische Hallen mit nichts als Tribünen gebaut wurden, entstanden in Nordamerika bereits solche, die an heutige Multifunktionsarenen erinnern. Mit Polstersesseln, exklusiven Bereichen für die Betuchten, aufwendigen Licht- und Soundanlagen sowie Anzeigetafeln.
Die Fans liebten die neuen Hallen vom ersten Tag an und strömten zu den Spielen. In Chicago rettete das die Black Hawks, die in ihrer alten Halle jedes Jahr Verluste gemacht hatten. Nun konnten sie ihre Einnahmen pro Heimspiel mehr als verdoppeln.
In Boston kam es am Eröffnungsabend der Bruins gegen die Canadiens sogar zu chaotischen Szenen: „Tausende wilde Eishockey-Fans, die keine Tickets ergattern konnten, stürmten die Türen, fegten die Polizeiketten beiseite, strömten in das Gebäude, füllten jeden Stehplatz aus und quollen fast aufs Eis. Fenster gingen zu Bruch, Türen brachen bei diesem wilden Sturm auf die Halle auseinander“, hieß es in einem Zeitungsbericht. Andere Artikel aus der Zeit lesen sich wie aus einem Krisengebiet. Denn die Fans, die Tickets hatten, kamen nicht auf ihre Plätze und fingen irgendwann an, sich den Weg freizuprügeln. Obwohl das Eröffnungsspiel um 25 Minuten verschoben wurde, kamen längst nicht alle pünktlich in den neuen Boston Garden. Das ganze Spiel über gab es Tumulte.
Auch sportlich waren die Bruins eine Attraktion. Dank der klugen Politik von Trainer und Manager Art Ross hatten sie es 1927 als erstes US-Team ins Finale geschafft, 1929 holten sie ihren ersten Titel – gegen die dank Manager Lester Patrick ebenfalls erfolgreichen New York Rangers, die im Jahr zuvor Meister geworden waren. Höhepunkte auf dem Eis waren allerdings rar gesät. Durch die immer besser werdenden Abwehrreihen und Torhüter fielen kaum noch Tore, im Schnitt nicht mal 1,5 pro Spiel. Also übernahm die NHL eine Regel, die es in den westlichen Profiligen schon lange gegeben hatte: Ab der neuen Saison waren auch Pässe nach vorne erlaubt, das Spiel bekam eine ganz andere Dynamik. Die Topteams blieben allerdings dieselben. Auch 1930 dominierte der Titelverteidiger aus Boston die Hauptrunde und kam erneut ins Finale, verlor dort aber überraschend gegen die Montréal Canadiens. Die bis heute größte Rivalität der NHL war geboren.
Das neue Chicago Stadium war die modernste und größte Halle ihrer Zeit.
Weniger zu lachen hatten sie derweil in Pittsburgh. Ohne eine moderne Halle und sportlichen Erfolg – keine einzige Halbfinalteilnahme, im letzten Jahr nur fünf Siege aus 44 Spielen – blieben die Fans weg. Nicht mal der Verkauf an die New Yorker Unterweltgröße „Big Bill“ Dwyer brachte die Wende. Im Sommer 1930 stand das Team aus der Stahlstadt zum Verkauf. Was zunächst aber niemanden nervös machte. Doch was als Ausrutscher in einer ansonsten stabilen Liga angesehen wurde, war nur der Anfang schwieriger Jahre, die durch die weltweite Wirtschaftskrise immer härter wurden. Der Kampf ums Überleben der NHL ging von Neuem los.
Von zehn auf sechs: Die große Depression
Fünf Jahre lang war es mit der NHL stets bergauf gegangen, aus der kleinen kanadischen Eishockey-Liga mit drei Vereinen war eine geworden, die in vielen der wichtigsten Städte des Kontinents zu Hause war. Sie war von vier auf zehn Mannschaften gewachsen, spielte in den größten Hallen, kannte Stars auf sowie neben dem Eis und hatte sich ihren Platz im nordamerikanischen Sportkalender erkämpft. Es schien immer weiter bergauf zu gehen, doch gegen Ende der 1920er Jahre bröckelte die Fassade, die Zeit der Stabilität war vorbei.
Das galt vor allem für den ehemaligen Serienmeister aus Ottawa, der sich vom Schwergewicht zum Sorgenkind gewandelt hatte. Da konnte das Management noch so viele Leistungsträger verscherbeln, Ticketpreise senken oder Heimspiele in andere Städte verkaufen, am Ende jeder Saison stand stets eine rote Zahl in der Bilanz.
Bereits im August 1929 hatten die Besitzer das Team verkauft, zwei Monate später brach die New Yorker Börse zusammen, die Weltwirtschaftskrise begann. Da half den Senators auch nicht mehr, dass das neue Management es geschafft hatte, wieder mehr Zuschauer anzulocken. Am Ende der Saison 1929/30 hatte es 25.000 Dollar Verlust gemacht. Kurz darauf verkauften die Senators ihren Star-Spieler Frank „King“ Clancy zu den Maple Leafs sowie ihre drei aussichtsreichen Nachwuchstalente zum neuen Team nach Philadelphia. Jeweils für 35.000 Dollar, was sie eine Zeitlang über Wasser hielt, sportlich bedeutete das allerdings ihren Ruin. Die Senators landeten mit nur zehn Siegen aus 44 Spielen auf dem letzten Platz der Canadien Division.
In Philadelphia war die Freude indes groß. Ursprünglich sollten die kriselnden Pittsburgh Pirates nach Atlantic City verkauft werden, doch der Deal platzte, also ging es nach Philadelphia, fortan nannte sich das Team Quakers und spielte in einer für NHL-Verhältnisse eher kleinen Halle mit nur 6000 Plätzen. Als Trainer verpflichteten die Quakers nicht etwa einen erfahrenen Mann, sondern Cooper Smeaton, der zwar durchaus Bezug zum Profi-Eishockey hatte, allerdings nicht als Coach, sondern als bisheriger Chef der NHL-Schiedsrichter. Trotz der drei neuen Talente aus Ottawa waren die Quakers in ihrer Premierensaison noch schlechter, als es die Pirates in ihrer letzten gewesen waren. Aus den sehr übersichtlichen fünf Siegen aus 44 Spielen wurden vier. Der letzte Platz in der American Divison überraschte niemanden. Schnell war auch das Publikum ernüchtert, zwischendurch lockten die Philadelphia Arrows aus einer der vielen Minor Leagues mehr Zuschauer an als die Quakers aus der großen NHL.
Auch Toronto braucht eine neue Halle
Im September 1931 trafen sich die Ligabosse zu ihrem alljährlichen Meeting in New York, um vor allem über die Probleme der beiden Tabellenletzten zu sprechen. Doch es gab weder Käufer vor Ort noch welche in anderen Städten noch sonstige Lösungen. Lediglich für die berühmten Senators gab es eine Idee: Sie sollten für 300.000 Dollar an jemanden verkauft werden, der sie als zweites Team nach Chicago verfrachten wollte, was die Besitzer der Black Hawks allerdings ablehnten, weil sie keine Konkurrenz in der eigenen Stadt wollten. Am Ende des Treffens hatte die NHL nur noch acht Teams. Die Quakers wurden abgewickelt, die Senators setzten aus.
Die Probleme waren damit aber längst nicht gelöst. Finanzielle Sorgen gab es auch bei den Detroit Cougars. Und selbst die Toronto Maple Leafs mit ihrer aufregenden Mannschaft um Starverteidiger „King“ Clancy und den Stürmern Jackson Busher und Charlie Conacher konnten kaum die Kosten decken. Schuld war ihre Halle. Während die Teams aus Montréal, Boston, Detroit, New York und Chicago in den Jahren zuvor neue große Hallen bekommen hatten, spielten die Leafs noch immer in der kleinen und wenig komfortablen Mutual Street Arena für maximal 7500 Zuschauer.
Also war mal wieder Conn Smythe gefragt, der es sich mitten in der Wirtschaftskrise zur Aufgabe gemacht hatte, 1,5 Millionen Dollar einzusammeln, um eine prächtige Halle zu bauen. Toronto war in den Jahren zuvor eine Boomtown geworden. Zahlreiche neue Hochhäuser entstanden, zudem das größte Hotel des britischen Empires sowie ein neuer Hauptbahnhof. Doch der Börsencrash hatte alles geändert. Monatelang rannte Smythe quer durch die Stadt, sprach mit Bankern, Industriellen, Medienvertretern und sonstigen einflussreichen Menschen. Doch wo er auch hinkam, überall begegneten ihm Skepsis und Ablehnung.
In Zeiten, in denen die Regierung knapp 100 Millionen Dollar investierte, um Jobs zu schaffen, war niemand bereit, Geld für die neue Halle eines privaten Eishockey-Vereins auszugeben. Für zahlreiche Menschen im Land hatte sich das Leben durch die Krise binnen weniger Monate schlagartig verändert, Millionen waren arbeitslos geworden, für sie ging es schlicht darum, etwas zu essen auf dem Tisch zu haben. Nicht wenige schafften das nur, indem sie sich bei den vielen Armenspeisungen in die Schlange stellten.
Der entscheidende Mann eines der wichtigsten Franchises der NHL: Conn Smythe rettete die Maple Leafs.
Smythe ließ dennoch nicht locker. Er war schon immer ein Mann der verrückten Ideen gewesen. Abwehrchef „King“ Clancy hatte er vor Jahren nur aus Ottawa zu den Maple Leafs locken können, weil er sein Geld in Sportwetten investiert und gewonnen hatte. Nun sollte der nächste Schritt für die Leafs auf dem Weg an die NHL-Spitze klappen: der Bau der neuen Halle. Dafür tat er alles und konnte im Frühjahr 1931 trotz aller Probleme erste Erfolge verzeichnen.
Als er mehrere Hunderttausend Dollar zusammenhatte, gründete er die Maple Leafs Gardens Ltd., wohl wissend, dass ihm noch mehrere Hunderttausend Dollar fehlen. Also hatte er erneut eine Idee und verkaufte 70.000 Anteilsscheine zu je zehn Dollar. Weitere 35.000 Anteile gab er mit unbestimmtem Wert heraus. Zugleich verpflichtete Smythe seinen Assistenten Frank Selke, nach dem heute die Trophäe für den besten Defensiv-Stürmer benannt ist, sowie Kapitän Ace Bailey zur Mithilfe. Die beiden mussten sich ans Telefon hängen und die Dauerkartenbesitzer abtelefonieren.
Einige Wochen später waren zwar sämtliche Anteilsscheine verkauft, trotzdem reichte es noch nicht, das ganze Projekt drohte zu platzen. Da kam Smythe auf die nächste Idee. Und diese Idee sorgte schließlich dafür, dass eine der legendärsten Arenen der NHL-Geschichte gebaut werden konnte. Die Bauarbeiter sollten auf 20 Prozent ihres Lohns verzichten und diese in Anteilsscheinen bekommen. Smythe war allerdings klug genug, nicht selbst mit ihnen zu verhandeln, er schickte Selke vor, der als gelernter Elektriker und geschätzter Arbeitgeber in der Stadt einen Draht zur Gewerkschaft hatte. Am Ende willigten die Arbeitervertreter ein, weil sie froh waren, dass es für viele ihrer durch die Krise arbeitslos gewordenen Gewerkschaftsmitglieder überhaupt etwas zu tun gab. Die Halle konnte nach den Plänen der prominenten Architekten Ross und Macdonald aus Montréal gebaut werden.
Am 31. Mai 1931 begannen die Abbrucharbeiten des vorherigen Gebäudes, nach nur fünf Monaten waren die 1300 Arbeiter gar komplett fertig. Und noch besser für Smythe: Durch die wegen der Weltwirtschaftskrise immer weiter fallenden Preise für Baumaterialien sparte er 30 Prozent der veranschlagten Baukosten. Einen Tag vor der neuen Saison, am 11. November, war der Maple Leafs Garden fertig. Die Besucher schwärmten von der Architektur, die an eine Kathedrale erinnern würde. Bis heute gilt Smythe deswegen als genialer Strippenzieher und Vater der Maple Leafs. „Conn Smythe hat eine Arena gebaut in einer Zeit, in der es kein Geld gab, um eine Arena zu bauen. Und er baute sie in fünf Monaten, das ist unglaublich. Aber er war einfach dieser stolze Charakter, er war unaufhaltsam“, sagt Ken Dryden, der ehemalige Canadiens-Goalie, der nach seiner aktiven Karriere zahlreiche Bücher über Eishockey und die Gesellschaft schrieb und für die liberale Partei in die Politik ging.
Zum Eröffnungsspiel des Gardens gegen die Black Hawks waren die Straßen rund um die Halle schon Stunden vor dem Spiel verstopft. Drinnen waren schließlich mehr als 12.500 Zuschauer, darunter auch sämtliche Bauarbeiter und die Prominenz der Stadt. Auf den teuren Plätzen „waren genügend Seidenhüte zu sehen, um alle Hochzeiten von jetzt bis Ende Juni auszustatten“, schrieb die Zeitung „Mail“. Und auch wenn das Spiel gegen Chicago mit 1:2 verloren ging, feierten die Maple Leafs am Ende der Saison ihren ersten Stanley Cup. Im Finale gegen die New York Rangers, die Smythe einst entlassen hatten, weswegen er sie wie kein anderes Team hasste. Spätestes jetzt war er endgültig eine Legende in Toronto.
Die Wirtschaftskrise macht der Liga zu schaffen
Die Cinderella-Story der Maple Leafs blieb allerdings eine der wenigen schönen NHL-Geschichten der frühen 1930er. Der Liga insgesamt ging es weniger gut. Die Wirtschaftskrise war längst nicht überwunden, vielen Fans fehlte das Geld, um NHL-Spiele zu besuchen. Also mussten Einsparungen her. Die Kader wurden von 16 auf 14 Spieler verkleinert, zudem wurde der Salary Cap eingeführt, die Gehaltsobergrenze. Kein Team durfte insgesamt mehr als 70.000 Dollar ausgeben, für einzelne Spieler nicht mehr als 7500 – was für manche NHL-Stars eine Kürzung von mehr als 30 Prozent bedeutete. Doch wechseln konnten sie nicht, in anderen Ligen gab es fast gar nichts mehr zu verdienen. Hunderte Spieler packten im Winter deswegen ihre Sachen und gingen nach Europa, wo sie mit Showteams durch die Gegend reisten oder sich als Trainer sowie Entwicklungshelfer versuchten. In zahlreichen europäischen Ländern leisteten sie wichtige Starthilfe für den Eishockey-Sport. Auch in Deutschland und der Schweiz waren zahlreiche Kanadier unterwegs.
Die größte Liga in der alten Heimat kämpfte derweil ums Überleben, obwohl die Wirtschaftskrise gleichzeitig für einen regelrechten Eishockey-Boom im Land sorgte. Vor allem unter den Kindern. „Es gab nichts zu tun, es war die Depression, die Kinder verstanden nicht, was da passiert war. Es gab auch nichts mehr zu träumen, außer davon, das nächste Spiel zu gewinnen“, hat der Autor Roch Carrier einmal recht pathetisch gesagt. Doch in der Tat: Durch das fehlende Geld in den meisten Familien blieb den Kindern in den kalten Monaten meist nichts anderes übrig, als nach der Schule nach draußen zu gehen und Eishockey zu spielen. Auch Canadiens-Legende Jean Béliveau (Jahrgang 1931) hat sich später daran erinnert, bereits als kleiner Junge ständig mit Schläger und Puck auf Natureis gestanden zu haben, weil es kaum andere Freizeitoptionen gab.
Vergrößert wurde die Begeisterung für den Sport durch die neuen Radioübertragungen. 1931 strahlte das Canadian National Railway Radio Network zum ersten Mal seine neue Sendung „General Motors Hockey Broadcast“ aus. Von nun an war es für Millionen Familien in ganz Kanada Standard, am Samstagabend daheim vor dem Radio zu sitzen und den Reportagen aus den Stadien zu lauschen. Vor allem für solche, die es sich durch die Krise nicht leisten konnten auszugehen. Was die Kinder samstagabends über ihre Idole hörten, spielten sie sonntags auf dem Weiher nach. Der Grundstein für die nächsten Jahrzehnte Eishockey-Begeisterung war gelegt. Und noch mehr: Waren die Fans der ersten NHL-Jahre meist nur als Zuschauer zu dem für viele neuen Sport gekommen, hatten die folgenden Generationen das Spiel als Kinder und Jugendliche selbst gespielt. Die Verbindung der Kanadier zu ihrem Sport wurde immer tiefer.
Aus der Radiotradition der 1930er und 1940er Jahre entstand knapp zwei Jahrzehnte später die TV-Sendung „Hockey Night in Canada“, die sich zum nationalen Mythos mauserte. Nun saßen die, die als Kinder mit ihren Eltern vor dem Radio gehangen hatten, mit dem eigenen Nachwuchs vor dem Fernseher. Bis heute hat die Sendung ihren festen Platz in der kanadischen Kultur. Wie in Deutschland die Sportschau mit ihren Zusammenfassungen der Fußball-Bundesliga zum Samstag gehört, ist es in Kanada „HNIC“ mit seinen Liveübertragungen der NHL.
Zurück in die frühen 1930er Jahre: Der immer größer werdenden Begeisterung rund um die NHL zum Trotz hatten die Teams dennoch ihre Probleme. An den Radioübertragungen verdienten sie nichts, Merchandise wurde noch nicht wirklich verkauft, die Klubs machten ihr Geld mit Eintrittskarten. Und die wurden immer weniger verkauft. Auch in Detroit, dem US-Markt, der sich seit der Liga-Erweiterung in Richtung Süden am schlechtesten entwickelt hatte. Die sportliche Misere – nur zwei Play-off-Teilnahmen in sechs Jahren – und die finanziellen Sorgen wegen der fehlenden Zuschauer gingen Hand und Hand. Also suchte Neu-Coach Jack Adams bereits 1930 nach neuen Wegen: Der ehemalige Meisterspieler der Senators schrieb eine Kolumne in einer örtlichen Tageszeitung, in der er das Spiel erklärte. „Following the Puck“ nannte die sich. Zudem putzte Adams, nach dem heute die Trophäe für den Trainer des Jahres benannt ist, persönlich Klinken, ging von Haus zu Haus und bat die Menschen aus Detroit, zu den Spielen der Cougars zu kommen. Doch sie kamen nicht, was auch daran lag, dass die Automobilindustrie böse von der Krise betroffen war. Die Leute hatten andere Sorgen als ein Verliererteam aus einer Sportart, deren Regeln sie nicht verstanden.
Norris rettet Detroit
Anstatt umzuziehen, versuchten es die Besitzer mit einer Neuausrichtung des Teams und nannten es fortan Falcons. Doch auch das half nicht. Das Team war weiterhin Letzter, die Zuschauer kamen nicht, die Schulden bei der Stadt und anderen Gläubigern wurden immer größer. Adams gab gar ein Interview, in dem er erzählte, dass er die Spieler teilweise selbst bezahlen würde und es auf Auswärtstouren nur noch Sandwiches gab, weil sich das Team nichts anderes leisten könne. Und nicht nur das: „Ich hoffe, uns brechen keine Schläger mehr, wir sind an einem Punkt, an dem wir keine neuen mehr bezahlen können“, klagte der Coach, der jeden Tag damit rechnete, dass die Besitzer den Stecker ziehen. Doch es kam anders.
Zu Beginn der Vorbereitung auf die Saison 1932/33 landete plötzlich ein unverhoffter Anruf in Adams’ Büro. Am anderen Ende der Leitung war James Norris, ein schwerreicher Industrieller aus Chicago, dessen Familie ursprünglich aus Montréal kam und seit Generationen Geld sowie Einfluss besaß. Norris, nach dem heute die Trophäe für den besten Verteidiger benannt ist, war selbst nie Profi. Obwohl er die legendäre McGill-Universität besuchte und leidenschaftlich Sport trieb. Jeden Winter soll es auf seinem Anwesen eine Eisfläche gegeben haben, auf der er gegen seine vielen Bediensteten spielte.
Norris war aber auch am Profi-Eishockey interessiert, war einer der Investoren des neuen Stadions in Chicago und besaß die Chicago Shamrocks in der Parallel-Liga American Hockey Association (AHA). Als klar wurde, dass die AHA der NHL keine Konkurrenz würde machen können, sich in American Hockey League umbenannte und eine Minor League wurde, verabschiedete sich Norris. Er wollte in die Topliga. Also versuchte er es mit einem Team in St. Louis, hatte aber keinen Erfolg – die Wege waren den anderen Teams schlicht zu weit. Weil die Liga den Multimillionär aber gern in ihren Reihen begrüßen wollte, bot sie ihm die kriselnden Detroit Falcons an – Norris war endlich am Ziel.
Noch vor dem Saisonstart 1932 nannte er das Team in Red Wings um und ließ ein Wappen kreieren, das der Autostadt gerecht wurde: den berühmten Reifen mit dem Flügel. Zudem holte er die besten Spieler der Shamrocks rüber und gab Trainer Adams ein Ultimatum: Entweder du machst das Team besser oder du fliegst raus. Adams tat wie ihm geheißen, krempelte das Team komplett um, kam auf Rang zwei der Vorrunde und in den Play-offs bis ins Halbfinale. Die letzten Spiele waren binnen Minuten ausverkauft, Detroit hatte sich endlich in sein Eishockey-Team verliebt.
Hinzu kam eine weitere gute Nachricht: Die Ottawa Senators waren zurückgekehrt, die Liga hatte wieder neun Teams. Doch besser wurde es nicht. Nach nur zwei Jahren verließen die Senators die kanadische Hauptstadt endgültig und wechselten nach St. Louis. Also in die Stadt, die den NHL-Bossen einige Jahre zuvor noch zu abgelegen war. Das neue Team nannte sich Eagles, hatte aber keinen Erfolg. Im ersten Jahr wurde es sang- und klanglos Letzter. Weil es auch finanziell nicht klappte, löste man das Team gleich wieder auf. Die ruhmreiche Geschichte des siebenfachen Stanley-Cup-Siegers aus Ottawa war ohne einen Funken Glamour zu Ende gegangen. Und schon bestand die NHL nur noch aus acht Teams.
Ähnliche Probleme gab es ein Jahr später in New York und Montréal. Während sich die Teams aus Detroit und Chicago etablierten und erste Meisterschaften gewannen – die Black Hawks holten 1938 bereits ihre zweite –, ging es dort, wo sich zwei Teams eine Stadt teilen mussten, bergab. Die größten Probleme hatten die New York Americans. Das lag nicht nur daran, dass die Rangers längst die Nummer eins der Stadt waren, sondern auch daran, dass die Prohibition fiel und Besitzer William „Big Bill“ Dwyer die Einnahmen aus seinen illegalen Alkoholgeschäften wegbrachen. Zudem hatte er Steuerschulden in Millionenhöhe, die das Finanzamt nun scharfstellte. Teilweise wurden die Spieler von New Yorks erstem NHL-Klub nicht mal mehr bezahlt. Also musste der Unterweltboss das Team schweren Herzens aufgeben, die Liga selbst übernahm die Geschicke der Americans.
In Montréal ist nur noch Platz für ein Team
In Montréal standen lange Zeit eher die Canadiens vor dem Aus. Die Maroons waren 1935 sogar noch mal Meister geworden. Trotzdem wurden die Stimmen immer lauter, die sagten, für zwei Teams sei kein Platz in der Stadt. Alles rechnete mit dem Aus der französischsprachigen Canadiens, deren Besitzer öffentlich über seine hohen Verluste klagte. Zudem waren die Frankokanadier ohnehin strukturell benachteiligt in der Gesellschaft. Ihnen das Team wegzunehmen, hätte in den höheren Kreisen der Stadt für weniger Probleme gesorgt. Doch die Habs wurden gerettet, ganz zur Freude der Arbeiterschaft in den ärmeren Gebieten der Stadt, die seit jeher die Basis des Vereins gebildet hatte.
Anders erging es den Maroons: 1938, nur drei Jahre nach ihrem zweiten Stanley-Cup-Gewinn spielten sie ihr letztes Spiel. Im Sommer desselben Jahres beschloss die NHL auf ihrem üblichen Treffen das Aus des Teams. Die Besitzer hatten zwar noch versucht, die Maroons zu verkaufen, es soll auch Interessenten aus Cleveland und erneut aus St. Louis gegeben haben, aber letztlich wurde nichts davon konkret. Die Maroons mussten aufgeben, sie waren sportlich abgesackt und nicht mehr zu finanzieren.
So endete die Geschichte der englischsprachigen NHL-Teams aus Montréal. Und mit ihr die zeitweise wilden Derbys, die nicht nur auf dem Eis hoch hergingen. Immer wieder hatte es wüste Ausschreitungen zwischen den Fangruppen gegeben, die das Spiel als Kampf der Kulturen definierten. Die beiden Bevölkerungsgruppen hatten im Alltag wenig bis keine Berührungspunkte, die Englischsprachigen fühlten sich überlegen, die Französischsprachigen sahen über den Sport eine Möglichkeit, es den anderen zu zeigen. Trafen sie nun in der Halle aufeinander, konnten sich die gesellschaftlichen Spannungen schnell entladen. Doch als beide Klubs sportlich immer schlechter wurden und selbst von den Emporkömmlingen aus Chicago und Detroit abgehängt wurden, blieben die Zuschauer weg. Es konnte nur eine Mannschaft überleben, und das waren überraschenderweise die Canadiens. Als die NHL im Herbst 1938 auf ihre 22. Saison zusteuerte, waren nur noch sieben Vereine übrig, was eine Neuorganisation der Liga zur Folge hatte.
Die kanadische Regionalgruppe war nach dem Aus von Senators und Maroons obsolet geworden. Folglich spielten die sieben übrig gebliebenen Teams gemeinsam in einer Division, die die Boston Bruins von Beginn an dominierten und letztlich souverän gewannen. „Sie waren das beste Team, das ich je gesehen habe“, hat Trainer und Manager Art Ross einmal gesagt. Doch eben jener Ross zog trotzdem den Hass der Leute auf sich. Er hatte Startorhüter Cecil Thompson, einen vierfachen Goalie des Jahres, für 15.000 Dollar nach Detroit verkauft. Wochenlang verging kein Tag ohne Dutzende Leserbriefe an die lokalen Zeitungen, in denen Ross beschimpft wurde. Manche störten sich gar an der Herkunft von Thompsons jungem Nachfolger Frank Brimsek. „Slawen haben nicht das Temperament, um Torhüter zu sein“, schrieb ein erboster Fan.
Den rassistischen Angriffen zum Trotz entwickelte sich Brimsek binnen weniger Wochen zum neuen Publikumsliebling. Möglich machten das sechs Shutouts in Folge. „Schnell wie eine Katze“ sei dieser Rookie-Goalie, sagte Rangers-Trainer Lester Patrick staunend, „ihn zur ersten Bewegung zu bringen ist wie der Versuch, das Washington Monument zu verschieben“. Fortan trug der angeblich nicht zum Goalie taugende Slawe Brimsek den Spitznamen „Mr. Zero“.
Weniger Monate später reckten die Bruins ihren ersten Stanley Cup seit mehr als zehn Jahren in die Höhe. Möglich machten das Mel „Sudden Death“ Hill, der alleine im Halbfinale gegen die Rangers drei Overtime-Tore erzielte, und eben jener Frank Brimsek. Nach dem entscheidenden Sieg über Toronto stürmten die Zuschauer im Boston Garden auf das Eis und trugen ihren neuen Torwart auf den Schultern durch die Halle.
Aber wie immer in den wilden ersten Jahrzehnten der NHL folgte nach der Party der Kater. Nur wenige Wochen später war es wieder vorbei mit der guten Laune, und erneut waren es die weltpolitischen Umstände. Das deutsche Terrorregime hatte seine Armee in Polen einmarschieren lassen und damit begonnen, ganz Europa ins Chaos zu stürzen. Kanada als Teil des britischen Commonwealth befand sich fortan im Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland, was vor allem das wirtschaftliche Leben des Landes prägen sollte, das langsam auf Kriegsindustrie umstellte. Die NHL entschied auf ihrem jährlichen Treffen dennoch, die Saison ganz regulär starten zu lassen, die USA, wo fünf der sieben Klubs beheimatet waren, waren ja noch nicht in den Krieg eingetreten.
Traurige Nachrichten anderer Art gab es für die Montréal Canadiens: den überraschenden Tod von Babe Siebert. Der ehemalige Spieler, der nun zum ersten Mal Trainer sein sollte, starb in der Sommerpause bei einem Badeunfall. Er wurde nur 35 Jahre alt. Also veranstaltete die NHL zum dritten Mal ein Allstar-Game, die Einnahmen schickte die Liga an Sieberts Familie. Sportlich war den Canadiens allerdings nicht zu helfen, sie erlebten die bitterste Saison ihrer Geschichte und wurden abgeschlagen Letzter. Zwischendurch blieben sie 15 Heimspiele in Folge ohne Sieg, zum Ende verloren sich kaum noch 4000 Zuschauer in ihrer Halle. Es war der Tiefpunkt nach Jahren des Niedergangs. Nicht nur das Management wechselte zu häufig, auch auf und hinter der Trainerbank gab es keine Konstanz.
Howie Morenz, die Ikone der Montréal Canadiens, starb mit nur 34 Jahren.
Bereits 1937 war Superstar Howie Morenz gestorben. Das jahrelange Gesicht des Vereins war in einem Spiel gegen Chicago gegen die Bande gekracht und hatte sich das Bein mehrmals gebrochen. Wochenlang lag er im Krankenhaus. Er verließ es nicht mehr und starb an einem Herzinfarkt nach einer Embolie. Ganz Montréal trug Trauer, 250.000 Menschen standen am Straßenrand, als der Sarg durch die Stadt gefahren wurde. Es dauerte Jahre, ehe sich die Canadiens davon erholten. Mehrmals wurde gar über das Ende des letzten Gründungsmitglieds diskutiert, weil teilweise weniger als 2000 Zuschauer kamen. Erst mit der Verpflichtung des jungen Toe Blake ging es langsam wieder bergauf.
Ganz anders war die Laune bei ihrem größten Konkurrenten. Seit dem Ende der Maroons wurde die Rivalität zu den Bruins immer größer. Da passte es ins Bild der leidenden Canadiens-Fans, dass das verhasste Team aus Boston am Ende der Regular Season zum dritten Mal in Folge ganz oben in der Tabelle stand. Das lag vor allem an ihrer gefürchteten Sturmreihe mit Milt Schmidt, Woody Dumart und Bobby Bauer, die die Plätze eins, zwei und drei der Scoringliste belegten. Die drei Jungs aus Kitchener in Ontario hatten deutsche Wurzeln und wurden als „Kraut Line“ berühmt. Im Laufe des Kriegs, als die Stimmung gegen Nazi-Deutschland kippte, nannten sie sich in „Kitchener Kids“ um, erst nach dem Krieg, in dem sie auf kanadischer Seite gegen das Land ihrer Vorfahren kämpften, wurden sie wieder die „Kraut Line“.
Für die Titelverteidigung reichte es dennoch nicht. Am Ende der Saison 1939/40 jubelten die New York Rangers zum dritten Mal nach 1928 und 1933. Goalie Dave Kerr, Kapitän Art Coulter und Topscorer Bryan Hextall, ein eisenharter Flügelstürmer, führten das Team aus Manhattan zu einem 4:2-Finalsieg über die Maple Leafs. Und das, obwohl sie die letzten vier Spiele der Serie allesamt auswärts bestreiten mussten, weil ein Zirkus tagelang im Madison Square Garden zu Gast war. Gefeiert werden konnte erst, als das Team per Zug an der Central Station ankam. Aber es sollte für lange Zeit die letzte Party für die Rangers-Fans sein, die nächste Meisterschaft ließ mehr als 50 Jahre auf sich warten.
Die Americans verabschieden sich
Immer größere Sorgen hatte derweil der Lokalrivale. Die NHL, die das Team nach dem Aus von Unterweltgröße William Dwyer übernommen hatte, fand keinen Käufer für die Americans. In der Saison 1940/41 war das Team auch sportlich im freien Fall. Ohne den zweimaligen NHL-Topscorer Sweeney Schriner, den sie aus Geldnot nach Toronto verkauft hatten, ging nichts mehr. Ganze neun Siege gab es noch zu bejubeln. Auf der jährlichen Sommersitzung der Liga wurde es ernst: Es ging um die Zukunft des ganzen Vereins.
Bostons Art Ross machte keinen Hehl aus seiner Sicht der Dinge und forderte das Ende des Klubs. Die sportlich nicht konkurrenzfähigen und wirtschaftlich nicht profitablen Americans weiter mitspielen zu lassen, wäre ein „schrecklicher Fehler“, sagte Ross. John R. Kilpatrick von den Rangers sah das ähnlich. Allerdings nicht ganz uneigennützig. Er wollte die Wochenendtermine, die im Madison Square Garden für die Americans geblockt waren, für sein Team haben. Die Americans seien ja nicht mal in der Lage, die Hallenmiete zu zahlen, ärgerte er sich. James Norris, Besitzer der Red Wings, hatte andere Sorgen: Wenn die Liga noch ein Team verlöre, schade das ihrem Ansehen, „wir können nicht immer weiter schrumpfen“. Andererseits könne sich die NHL auch keinen Klub im Zustand der Americans erlauben. Die Sitzung wurde ergebnislos abgebrochen.
Im Oktober 1941 kam Rangers-Mann Kilpatrick mit einer anderen Idee: Die Besitzer des Football-Teams Brooklyn Dodgers seien daran interessiert, die Americans zu übernehmen, ebenfalls Dodgers zu nennen und eine Halle in Brooklyn zu bauen. Es gäbe auch noch den gleichnamigen Baseball-Klub, die Fanbase der beiden bestehenden Dodgers-Teams müsse man doch nutzen können. Bis zum Umzug sollte das Team weiter im Garden in Manhattan spielen, wurde vorsorglich aber schon mal in Brooklyn Americans umbenannt. Das war ganz nach dem Geschmack von Americans-Manager Red Dutton: „Die Art und Weise, wie die Fans die Baseball- und Football-Dodgers unterstützen, hat mich schon vor langer Zeit davon überzeugt, dass sie das genauso fantastisch für Eishockey tun würden“, sagte er in jedes Mikrofon. Sportlich ging es danach sogar etwas bergauf, die Americans verdoppelten ihre Siege auf 18. Am Ende waren sie dennoch Letzter und noch schlimmer: In Brooklyn interessierte sich niemand für sie.
Im Sommer 1942 war es dann endgültig vorbei. NHL-Boss Frank Calder versuchte zwar noch einmal, einen günstigeren Vertrag mit den Besitzern des Madison Square Gardens auszuhandeln, scheiterte aber, am 25. September sperrte die Liga die Americans schließlich aus. Die NHL hatte ihre nächste Negativmeldung, obwohl die Zeit günstig gewesen wäre, eine ganz andere Geschichte zu erzählen: die der größten Aufholjagd der Play-offs-Geschichte einer der großen vier US-Ligen. 3:0 hatten die Detroit Red Wings im Stanley-Cup-Finale 1942 gegen die Toronto Maple Leafs geführt. Die Meisterschaft schien nur noch Formsache zu sein, doch dann kamen sie in Toronto auf die eigentlich verrückte Idee, ihre schwächelnden Topspieler komplett draußen zu lassen. Plötzlich ging der berühmte Ruck durch die Mannschaft, die Leafs gewannen sensationell vier Spiele in Folge und damit die Finalserie mit 4:3. Bis heute hat nie wieder eine Mannschaft die Meisterschaft geholt, wenn sie im Finale mit 0:3 Spielen zurücklag.
Helfen konnte das der Gesamtverfassung der NHL indes nicht. Es ging gar die Angst um, die ganze Liga könnte dichtmachen. Mittlerweile waren auch die USA in den Weltkrieg eingetreten, 74 Spieler aus allen sechs Mannschaften kämpften auf den Schlachtfeldern Europas gegen die Nazis. Nicht nur das sportliche Niveau sank rapide, es gab auch immer mehr moralische Bedenken, ob man weiter fröhlich Eishockey spielen dürfe, während die Kollegen um ihr Leben kämpften.
Verstärkt wurde die Debatte nach dem „Desaster von Dieppe“, einer der größten Niederlagen der Alliierten. Mehr als 6100 britische und kanadische Soldaten landeten im August 1942 in Frankreich und wurden während der neunstündigen Schlacht vernichtend geschlagen. Fast 1000 starben, weitere 2000 wurden in Gefangenschaft genommen. Die Nachricht darüber, illustriert mit Bildern der Toten in den Tageszeitungen, war ein Schock für Kanada. An Eishockey dachte niemand mehr, die folgende Saison stand kurz vor der Absage. Doch es kam anders: Im September gaben die Regierungen von Kanada und den USA ein Statement heraus, in dem es hieß, sämtliche Profisportligen sollen weitermachen, um die Moral in den Gesellschaften zu heben.
Einen Monat später begannen die Trainingscamps für die nächste Saison. Zwar hatten manche Teams nur noch eine Handvoll Spieler übrig, aber irgendwie bekamen sie neue. NHL-Boss Frank Calder, der die Liga seit ihrem ersten Tag 1917 geführt hatte, gab den neuen Spielplan und das Ligaformat bekannt, ehe er zusammenbrach und ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Im Frühjahr, nur einen Tag nachdem er wieder zu Hause war, starb er. Für die NHL war das eine Zeitenwende. Calder war weg, und es gab nur noch sechs Teams. Der neue Ligaboss musste, genau wie Calder 25 Jahre zuvor, in einem Weltkrieg anfangen, er blieb zwar nur drei Jahre, aber das neue Zeitalter wurde erneut eine prägende Ära, die der „Original Six“.