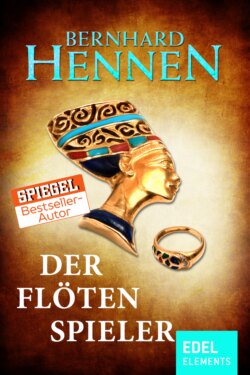Читать книгу Der Flötenspieler - Бернхард Хеннен - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. KAPITEL
ОглавлениеVerfluchte ägyptische striga! Philippos trat wütend gegen einen der angenagten Knochen, die auf dem schlammigen Weg lagen. Wie konnte sich ein intelligenter Mann wie Gabinius einer solchen Frau anvertrauen? Eine Frau als Ärztin, wo hatte man dies je gehört. Hebammen, schön … Kräuterweiber, gut, aber Ärztinnen! Nein, das war undenkbar. Der Aufenthalt in Syrien mußte Gabinius verwirrt haben. Früher hätte sich ein Mann, ein ehemaliger Konsul wie er, nicht auf so etwas eingelassen.
Vielleicht sollte er das ganze als einen Wink des Schicksals betrachten, überlegte Philippos. Nicht ganz zwei Monate war es her, daß er die Legion verlassen hatte. Gerade noch rechtzeitig, wenn man von den blutigen Kämpfen in Gallien hörte. Womöglich wäre er in dieses kalte Barbarenland verlegt worden.
Der Arzt dachte an die zwanzig Jahre, die er in der Armee verbracht hatte, an all die Feldzüge und Schlachten … Ärgerlich schüttelte er den Kopf, um die düsteren Erinnerungen zu vertreiben. Er hatte genug sterbende Legionäre auf seinem Tisch liegen gehabt. Was er jetzt wollte, waren reiche Patrizier, die sich bei einer Orgie überfressen hatten, und hübsche Damen mit harmlosen Zipperlein.
Doch das Schicksal schien sich gegen ihn verschworen zu haben! Erst sein Pech in den thermen, dann tauchte auch noch diese ägyptische Hexe auf! Gabinius zu behandeln, das hätte der Anfang seiner Karriere als seßhafter Arzt werden können. Philippos kannte ihn noch von früher und hatte gehofft, der Konsul würde sich noch an ihn erinnern. Schließlich hatte er Gabinius vor Jahren einmal während des Feldzugs in Spanien eine böse Platzwunde vernäht. Aber diese Reichen waren alle gleich! Sie hatten kein Auge für die einfachen Männer um sie herum.
Römische Barbaren! Vielleicht sollte er diese Stadt verlassen! Rom war doch ohnehin nur ein riesiges Drecksloch. Eine der verkommensten Städte, die er jemals gesehen hatte. Jedes Legionslager war da besser organisiert. Philippos dachte an seine Jugend in Athen, die prächtigen weißen Tempel auf der Akropolis und das wunderbare Meer. Was hielt ihn hier eigentlich? Er hatte sein Diplom als entlassener Legionsarzt und das Bürgerrecht. Er konnte gehen, wohin er wollte. Vielleicht war es ein Fehler gewesen, ausgerechnet hierher zurückzukommen.
Ein drohendes Knurren schreckte ihn aus seinen Gedanken auf. Aus einer der Gruben nahe dem Weg war ein großer, grauer Hund geklettert und kam steifbeinig auf ihn zugestelzt. Erschrocken tastete Philippos nach dem gefalteten Leinentuch, das er unter den Arm geklemmt hatte. In das Tuch hatte er seine chirurgischen Instrumente eingeschlagen.
Wäre er nur nicht über den Esquilin gegangen, fluchte Philippos stumm. Er wußte genau, welche Gefahren auf diesem Hügel lauerten. Es war einzig seine Bequemlichkeit, die ihm diesen Ärger eingebracht hatte. Die paar hundert Schritt, die er weniger zu laufen hatte, wenn er über diesen verfluchten Hügel ging! Bei Nacht wäre ihm diese Idee erst gar nicht gekommen, aber jetzt war ja nicht einmal Mittag, und die Sonne stand hoch am Himmel.
Seine Finger ertasteten die kalte Klinge eines seiner Chirurgenmesser. So lange er es nur mit einem Hund zu tun hatte, brauchte er sich keine Sorgen zu machen. Vorsichtig blickte der Arzt sich um, doch abgesehen von einigen wohlgenährten Raben war nichts Lebendiges zu sehen.
Der Hund blieb stehen und knurrte wieder. Vielleicht würde es ausreichen, wenn er den Weg verließ und einen weiten Bogen schlug, überlegte Philippos.
Langsam zog er das schlanke, leicht gebogene Messer aus dem Leinentuch. Sollte er nur kommen, dieser räudige Straßenköter. Einige Augenblicke lang verharrten sie beide. Dann trat der Arzt ein wenig zur Seite. Vorsichtig am Rand einer der langen Gruben entlangbalancierend, versuchte er einen weiten Bogen um den Hund zu machen.
Der Gestank, der Philippos entgegenschlug, war entsetzlich. Diese römische Barbaren, dachte er angewidert. Wie unter einem Bann mußte er in die Grube hinabblicken. Ein Fluch der Toten vielleicht, die wollten, daß er ihr Elend sah?
Er blickte in das grausig entstellte Gesicht einer halb verwesten Frau. Sie war nicht sehr alt geworden, höchstens dreißig … Ihre Glieder waren dünn und ausgemergelt, so als sei sie an einer Krankheit gestorben. Vielleicht war sie auch ein Mordopfer, das man einfach in die Grube geworfen hatte. Nicht einmal ein schlichtes Leinengewand war ihr geblieben, das im Tod ihre Blöße bedeckt hätte.
Dicht neben ihr lag der Kadaver einer Katze, deren Balg durch den Regen aufgedunsen war, so daß ihr die Beine steif wie Stöcke vom Leib abstanden. Angeekelt wandte sich Philippos ab. Der Hund belauerte ihn noch immer. Warum nur, wo es hier doch reichlich Aas gab? Auf den Esquilin schleppten die Römer die Leichen all jener, die zu arm waren, um sich ein Begräbnis leisten zu können. Achtlos, ohne daß man sich auch nur die Mühe machte, sie mit ein wenig Erde zu bedecken, wurden sie in die Gruben gestoßen. Auch Müll und die Kadaver von Haustieren brachte man hier hinauf. Was war das nur für ein Volk, das eine solche Barbarei duldete! Wie hatten sie nur jemals über das edle Griechenland triumphieren können?
Der Hund war ein paar Schritt näher gekommen. Plötzlich sprang er mit einem Satz in die Grube hinab. Erschrocken riß Philippos das Messer hoch, doch statt anzugreifen knurrte die Bestie noch einmal und machte sich dann am Leichnam der Frau zu schaffen. Gierig schlug er ihr seine Fänge in die Schulter und begann mit solcher Kraft an ihr zu zerren, daß der schlaffe Körper hin- und herschlingerte. Einen Augenblick lang sah es so aus, als würden ihre pendelnden Arme Philippos zuwinken.
Eine Tote, die ihm zuwinkte! Mit einem Schreckensschrei auf den Lippen drehte er sich um und begann zu laufen, wie er in seinem Leben noch nicht gelaufen war. Ohne weiter auf den Weg zu achten, hetzte er über die Hügelkuppe hinweg, strauchelte auf dem rutschigen Lehmboden und raffte sich wieder auf, getrieben von kopfloser Angst.
Erst als er die belebten Gassen der subura erreichte, verlangsamte er sein Tempo und blieb schließlich vor einer billigen Weinbude stehen. Was für ein schauerliches Omen! Die Tote hatte ihn sicherlich zu sich ins Grab herabwinken wollen. Erst die ägyptische Hexe und jetzt das! Er sollte diese Stadt so schnell wie nur möglich verlassen. In Rom würde er niemals sein Glück machen. Hier erwartete ihn nichts als Verderben!
* * *
Schon als Šamu den Garten jener prächtigen Villa betrat, in der Pompeius den Pharao untergebracht hatte, konnte sie das melancholische Flötenspiel hören, das Ptolemaios seinen Spottnamen eingebracht hatte. Sie wußte, daß es dem Neuen Osiris nun gleichgültig sein würde, ob sie Erfolg gehabt hatte oder nicht. Würde sie jetzt seine Gemächer betreten, müßte sie sich an den Liebesspielen des Hofes beteiligen, doch stand ihr danach nicht der Sinn.
Im atrium entließ sie Baris, und der Nubier verschwand in Richtung Küche. Ihr selbst war nicht nach Essen zumute. Obwohl sie von dem Trank, den sie Gabinius gegeben hatte, nur einen winzigen Schluck genommen hatte, fühlte sie sich müde und ein wenig schwindlig.
In Gedanken versunken blieb Šamu im atrium stehen. Es gab hier einen kleinen Brunnen und Marmorbänke, die zum Verweilen einluden. Der Boden war mit einem prächtigen Mosaik ausgelegt, das Alexander den Großen zeigte, wie er an der Spitze seiner Reiter eine Formation von Kriegselefanten angriff. Das Portrait des Königs der Makedonier war äußerst gelungen. Wer immer das Mosaik gelegt hatte, war ein Meister seines Fachs gewesen. Man konnte sehen, wie der Wind in die Haare Alexanders fuhr, und sein Blick war von erschreckender Intensität. Der Blick eines Mannes, der kein Maß fand und keine Grenze akzeptieren konnte. Die Amunpriester von Sekhetam hatten ihm offenbart, daß seine maßlose Art zu leben seinen Körper vernichten würde und daß ihm, auch wenn er der Sohn Amuns war, ein früher Tod gewiß sei.
Das rötliche Licht der Abenddämmerung ließ die blutige Schlachtszene auf beklemmende Weise realistisch erscheinen. Es schien, als habe sich der Schleier der Vergangenheit gehoben, um Šamu zur Zeugin des Sterbens Tausender Soldaten zu machen. Immer intensiver wurde der Eindruck, so daß sie sogar glaubte, das Klirren der Waffen und die Schreie der Verwundeten zu hören. Das Bild begann sich zu verändern. Sie sah jetzt einen Hafen und makedonische Soldaten, die gegen Fremde kämpften, über deren Köpfen goldene Adler mit ausgebreiteten Schwingen schwebten. Dann waren überall Flammen, und sie hatte das Gefühl, die Hitze des Feuers durch die dünnen Ledersohlen ihrer Sandalen zu spüren. Einer der Soldaten löste sich aus dem Schlachtgetümmel und kam auf sie zu. Mit hämischem Lächeln hob er seinen Speer und zielte …
Etwas berührte Šamus Arm. Erschrocken schrie sie auf.
»Entschuldige. Ich wollte dich nicht ängstigen.«
Die Stimme klang vertraut. Verschwommen nahm sie wahr, daß ein Mann vor ihr stand.
»Ich hatte den Eindruck, daß die Magie des Mosaiks einen schlechten Einfluß auf dich hat.«
Die Vision von Tod und Zerstörung verblaßte, und Šamu erkannte jetzt Rechmire, den Schreiber des Pharao. Rechmire war ein etwas beleibter, alter Mann mit einem offenen und freundlichen Gesicht. Wie bei fast allen höheren Beamten des Pharao krönte eine kunstvoll geknüpfte, nicht ganz schulterlange Perücke aus Pferdehaar sein Haupt. Obwohl es recht kühl war, trug er nur einen knielangen, weißen Rock. Schon die Tempelbilder von Schreibern aus den ersten Dynastien zeigten sie in dieser Tracht, und manchmal hatte Šamu bei Rechmire das Gefühl, er sei so zeitlos und unvergänglich wie das Gewand des Schreibers. Solange sie am Hof des Ptolemaios verkehrte, kannte sie ihn, und seine Güte und Weisheit waren ihr immer vorbildlich erschienen.
»Sag mir, was du gesehen hast.« Väterlich legte er ihr den Arm um die Schulter und führte sie zu einer der Marmorbänke des atrium.
»Das Mosaik … es schien mir plötzlich so lebendig.« Šamu war noch immer ganz verwirrt, und es fiel ihr schwer, ihre Eindrücke in Worte zu fassen. »Ich hörte plötzlich den Lärm des Kampfes, und dann veränderte sich das Bild. Alexander sah aus wie Achillas, der Offizier, der im Palast in Alexandria die Wache kommandiert. Er wirkte nur älter … und er kämpfte gegen Römer. Es war ein blutiger Krieg. Feuer erhellte den Nachthimmel Alexandrias … und dann schien das ganze Reich des Neuen Osiris in Flammen zu stehen!«
Rechmire nickte. »Auch mich hat das Mosaik schon erschreckt. Der Mann, der es geschaffen hat, war mehr als nur ein Künstler. Siehst du, in welch seltsamer Linie dem Bukephalos das Haar in die Stirn fällt?«
Der Schreiber zeigte auf das Pferd Alexanders. »Es erinnert mich an ein persisches Zauberzeichen. Wenn du das Mosaik genau betrachtest, wirst du noch mehr solcher verborgener Zeichen finden.«
»Wozu dient dieser Zauber?«
»Ich glaube, er ist im Grunde harmlos. Er soll das Mosaik interessanter erscheinen lassen und den Blick des Betrachters fesseln. Es kann aber auch passieren, daß empfindsame Menschen in einer besonderen Stimmung, wenn das Licht des Re der Dunkelheit weicht, ganz in den Bann des Mosaiks geraten. Bei einem Schlachtbild keine angenehme Erfahrung.«
»Du sprichst, als sei dir selbst schon Ähnliches widerfahren.«
Rechmire lächelte. »Ich glaube, es war doch etwas anders. Vor ein paar Tagen, nachdem ich auf einem der Empfänge ein wenig zu viel von dem kretischen Wein getrunken hatte, hat auch mich das Bild erschreckt.«
»Und was hast du gesehen?«
»Mir kam es einen Augenblick lang so vor, als habe Alexander plötzlich den Kopf von Pompeius.«
Šamu lachte leise. »Das solltest du Pompeius erzählen. Für dieses Omen würde er dich sicher reich entlohnen und es dann von seiner Klientel schnellstens in ganz Rom verbreiten lassen.«
Rechmire blieb ernst. »Das ist kein Spaß. Es ist sicher kein Zufall, daß Pompeius ausgerechnet ein Mosaik mit einer Alexander-Schlacht in dieses atrium hat legen lassen. Einer der älteren Sklaven hat mir erzählt, daß unser Gastgeber diese Arbeit kurz nach dem Ende des pontischen Krieges in Auftrag gegeben hat. Er ließ dazu extra einen Künstler aus Halikarnassos anreisen.«
»Glaubst du, Pompeius träumte damals nach seinem Sieg über Mithridates davon, so wie Alexander in den Osten zu ziehen?«
»Genau das glaube ich. Das Mosaik zeigt Alexanders Schlacht gegen Poros, und ich bin sicher, Pompeius träumt auch heute noch davon, die Parther zu besiegen und die Grenzen des römischen Reiches bis nach India auszudehnen. Er ist besessen von der Idee, ein ebenso bedeutender Feldherr wie Alexander zu sein. Das ist auch der Grund, warum er Ptolemaios so großzügig in dieser Villa aufgenommen hat und dafür sorgt, daß der Neue Osiris so viel Gold bekommt, wie er braucht, um den Senat dazu zu bringen, ihn mit einem Heer nach Ägypten zu schicken.«
»Und du glaubst, Pompeius würde dieses Heer befehligen?«
»Ganz bestimmt. Das ist sein nächstes Ziel. Du weißt doch, bevor Alexander Darius endgültig besiegte, kam er nach Ägypten, und die Priester haben ihn freundlich empfangen und zum Sohne Armins erklärt.«
Rechmires Ausführungen waren von erschreckender Logik. Trotzdem mochte Šamu nicht daran glauben. Würden die Römer Ägypten zu einer Provinz machen, wäre dies das Ende der äonenalten Geschichte des Pharaonenreichs. Das würden die Götter nicht zulassen! Doch als ihr Blick wieder auf das Schlachtenbild fiel, kam ihr ein schrecklicher Verdacht.
»Du denkst doch nicht etwa, Pompeius wird Ptolemaios ermorden, wenn er erst einmal in Ägypten ist, um dann selbst Pharao zu werden?«
Rechmire schüttelte den Kopf. »Nein, nein, Šamu. Ich sehe, du hast die Feinheiten römischer Politik noch nicht begriffen. Die Römer sind nicht wie Alexander oder die Ptolemäer. Pompeius würde sich niemals zum Pharao oder gar zum Neuen Osiris ausrufen lassen. Alexander hatte schon Schwierigkeiten mit seinen Soldaten, als er sich vergöttlichen ließ. Römer würden das niemals dulden. Außerdem ist Ptolemaios schlau genug, sich nicht mit einem Mann einzulassen, der ihn vielleicht eines Tages ermorden würde. Pompeius genügt es, wenn römische Truppen Ägypten besetzt halten und er unser Gold bekommt. Das ist das nächste, was er für seine Pläne braucht. Sehr viel Gold.«
Rechmires Worte klangen überzeugend. Als Schreiber war er bei jeder Verhandlung anwesend, die der Neue Osiris führte. Außer dem Eunuchen Potheinos gab es wohl niemanden, der so gut über die Politik des Pharao informiert war wie Rechmire.
Šamu war empört darüber, daß Ptolemaios plante, sein Reich an Pompeius zu verpfänden, nur um wieder auf dem Thron in Alexandria zu sitzen. Sie hätte niemals vermutet, daß der König sich in seiner Herrschsucht so sehr erniedrigen würde. Schließlich war er der Neue Osiris! Wie konnte der Pharao, der von göttlicher Abstammung war und der von der gesamten Priesterschaft unterstützt würde, einen so gemeinen Verrat an Ägypten planen? Obwohl Šamu dies kaum glauben mochte, erschienen ihr doch Rechmires Worte über jeden Zweifel erhaben.
Inzwischen war es dunkel geworden. Hinter einigen Fenstern der Villa leuchtete das warme Licht von Öllampen. Das Flötenspiel war verstummt, und allein das leise Plätschern des Brunnens und das Gebell eines Hundes irgendwo in der Ferne störten die Ruhe der Nacht.
»Diese Finsternis hat uns Seth geschickt«, brummte Rechmire, und es schien, als spräche er mehr zu sich selbst als zu Šamu. »Das Auge des Horus verbirgt sich hinter Wolken. Eine Nacht für Mörder und Diebe.«
»Glaubst du, der Pharao ist in Gefahr?«
Rechmire zuckte mit den Schultern. »Man hört schlimme Dinge aus Alexandria. Berenike will einen Partherprinzen heiraten, um so zu verhindern, daß die Römer unser Land nehmen. Es gibt aber auch Gerüchte, daß sie mit Crassus paktiert. Ich fürchte, allein die Götter wissen, was davon wahr ist.«
Šamu versank in tiefes Grübeln. Wenn Berenike ihre Macht noch weiter festigte, dann würde sie selbst niemals in den Isistempel von Philae zurückkehren können. Seit Šamu sich einmal geweigert hatte, der Prinzessin einen Trank zuzubereiten, der in hoher Dosierung wie ein tödliches Gift wirkte, verfolgte die Zweitälteste Tochter des Ptolemaios sie mit ihrem Zorn. Diese Abneigung basierte durchaus auf Gegenseitigkeit. Šamu hatte das launische, flatterhafte Wesen Berenikes nie gemocht. Einmal hatte die Prinzessin einen Sklaven zu Tode prügeln lassen, nur weil er versehentlich bei einem Bankett etwas Wein auf ihr Gewand geschüttet hatte.
»Du sorgst dich wegen Berenike, nicht wahr?«
Šamu blickte Rechmire verwundert an. Konnte er in ihren Gedanken lesen? Oder war es ihr so deutlich anzusehen gewesen, an wen sie gedacht hatte?
»Berenike wird nicht lange regieren. Die Priesterschaft lehnt sie ab. Die Hohepriester würden lieber sehen, daß Kleopatra Tryphaina alleine herrscht. Sie ist weiser und vor allem nicht so blutdürstig wie ihre Schwester. Doch leider läßt uns das Schicksal nur allzu selten den einfachsten Weg gehen, und wir werden wohl noch eine Weile mit Berenike und ihren Ränkespielen leben müssen.« Rechmire hatte sich bei den letzten Worten erhoben.
»Entschuldige mich jetzt. Es ist nicht gut für einen alten Mann, seine Nächte in einem kalten atrium zu verbringen. Auch muß ich noch einen Brief vollenden, bevor ich mich zur Ruhe lege. Ich hoffe, ich habe dich mit meinem Gerede nicht allzusehr gelangweilt.«
Šamu hob abwehrend die Hände. »Es war mir eine Freude, an deiner Weisheit teilhaben zu dürfen.«
Rechmire lächelte. »Und ich habe mich gefreut, jemanden gefunden zu haben, mit dem ich über die Sorgen eines alten Mannes reden konnte, der vielleicht zu viel über Politik nachdenkt.«
Ohne sich noch einmal umzudrehen, verschwand Rechmire in der Villa. Šamu blieb noch eine Weile im atrium und grübelte über die Worte des Hofschreibers. Fast hatte sie den Eindruck, er wünsche sich, daß Ptolemaios nie mehr nach Ägypten zurückkehren würde. Das wäre Hochverrat. Doch wenn Ptolemaios plante, sein Reich den Römern auszuliefern, war die einzig ehrenhafte Entscheidung, ihn zu verraten.
Šamu hatte das Gefühl, keinen klaren Gedanken mehr fassen zu können. Morgen wollte sie noch einmal mit Rechmire sprechen. Vielleicht hatte sie ihn falsch verstanden. Es war doch nicht möglich, daß der Schreiber, der einst zu den wenigen gehört hatte, denen es gestattet war, die Orakelsprüche im Isisheiligtum von Philae zu lesen, zum Verräter an Ptolemaios wurde! Sicher hatte das Opium des Heiltranks ihr die Sinne verwirrt.
Erschöpft begab sie sich zu ihrem Zimmer. Ihr war ein kleines Gemach im ersten Stock des großen Hauses zugewiesen worden, das direkt an das Zimmer der Kleopatra Philopator grenzte, der zweiten Tochter des Ptolemaios, die diesen Namen trug. Šamu war damit beauftragt, die Prinzessin in die Mysterien des Isiskultes einzuweihen. Sie warf einen kurzen Blick in das Zimmer des Mädchens, doch Kleopatra lag nicht in ihrem Bett. Vermutlich hatte der König sie gerufen, damit sie seinen Vergnügungen beiwohnte.
Müde legte Šamu ihren schweren Umhang auf die Truhe, die neben dem Fenster stand. Das silberne Licht des Horusauges hatte die Wolken durchbrochen und erhellte die kleine Kammer.
Sie streifte den Schlangenarmreif ab und legte ihn auf den Schminktisch unter dem Fenster. Dann löste sie den Knoten, der ihr langes Gewand zusammenhielt, und ließ es zu Boden gleiten.
Aus dem Garten hörte sie ein Geräusch. Sie kniff die Augen zusammen, spähte in die Finsternis und erkannte die kleine, gedrungene Gestalt des Schreibers im Garten. Rechmire schlich zu dem dichten Gebüsch nahe der Gartenmauer. Vermutlich mußte er sich erleichtern. Müde drehte sich die Priesterin um und stieg über einen Fußschemel in das hohe, römische Bett. Sie war froh, daß dieser verwirrende Tag endlich zu Ende war.