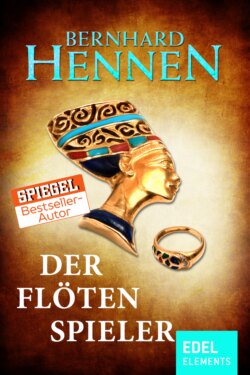Читать книгу Der Flötenspieler - Бернхард Хеннен - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. KAPITEL
ОглавлениеŠamu fuhr aus dem Schlaf hoch. Sie glaubte, einen Schrei gehört zu haben. Irgend etwas ging unten im Haus vor sich. Aufgeregtes Stimmengemurmel drang an ihr Ohr. Hastig sprang sie aus dem Bett und schlüpfte in ihr Gewand. Die Sonne war gerade erst aufgegangen.
Als sie aus ihrem Zimmer trat, konnte sie von unten lautes Wehklagen hören. Was mochte nur geschehen sein? Barfuß eilte sie die schmale Treppe zum Erdgeschoß hinab und sah, daß sich etliche Sklaven vor der Tür zu Rechmires Zimmer drängelten. Energisch befahl sie, den Weg freizugeben, und mürrisch brummend traten die Haussklaven des Pompeius zur Seite.
Rechmire lag mit dem Gesicht nach unten am Boden. Eine kleine Blutlache umgab ihn. Šamu kniete nieder und tastete nach seinem Hals. Der Körper des Schreibers war kalt, das Blut in seinen Adern pulsierte nicht mehr. Man hatte ihm die Kehle durchgeschnitten!
»Macht Platz für den Pharao!« erklang Batis' gebieterische Stimme.
Ptolemaios tauchte im Türrahmen auf.
»Was ist hier geschehen?« Hilfesuchend schaute er sich um, bis sein Blick an Šamu hängenblieb. »Was ist mit Rechmire?«
»Euer Schreiber, Majestät.« Šamu fiel es schwer, die Fassung zu wahren. »Man hat ihn ermordet.«
»Und wer ist der Mörder?« Ptolemaios runzelte die Stirn. »Wer betritt einfach unser Haus, um unseren Schreiber zu töten? Weiß das jemand?« Die Stimme des Pharao klang kalt und abweisend, ganz so, als ließe ihn der Mord unberührt.
Einige Atemzüge lang war es totenstill. »Finde es heraus, Šamu! Und unterrichte uns, wenn du weißt, wen unser göttlicher Zorn zerschmettern soll. Du bist nur uns allein Rechenschaft schuldig und wirst nur uns berichten. Und nun kümmere dich darum, daß Rechmire ein Begräbnis bekommt, das seinem Stand entspricht. Wir werden uns zurückziehen und um unseren treuen Schreiber trauern.« Ohne ein weiteres Wort drehte sich der Pharao um und verließ, gefolgt von seinem Leibwächter und einigen Sklaven, den Ort des Verbrechens.
Nachdem sie einen Augenblick wie erstarrt dagestanden hatte, sah Šamu sich im Zimmer um. Sie versuchte zu erkennen, ob es Spuren eines Kampfes gab oder irgend etwas, was auf den Täter hinweisen konnte. Doch sie konnte nichts Ungewöhnliches entdecken. Schließlich wandte sie sich wieder der Leiche zu.
Die Perücke war Rechmire vom Kopf gerutscht und lag neben ihm. Šamu bückte sich danach, hob sie auf und erblaßte. Unter der zerzausten Perücke waren mit dem Blut des Toten zwei Schriftzeichen auf den Steinfußboden gemalt. Der Tapir und der sitzende Gott, die zusammen den Namen des Seth, des Todfeindes der Isis und Mörders ihres Göttergemahls Osiris, bezeichneten.
Wer mochte den Toten auf diese makabre Art verhöhnt haben? Oder war etwa Ptolemaios, der Neue Osiris gemeint? War der Mord eine Drohung an den Pharao und Rechmire war nur zufällig zum Opfer geworden? Šamu untersuchte die Zeichen näher. Die Linien waren zittrig und offenbar mit unsicherer Hand gezogen, Doch vielleicht rührte dies auch nur von der Aufregung des Mörders her.
Rechmire konnte nicht so liegenbleiben. Man mußte ihn waschen und aufbahren.
Šamu drehte sich um und gab den Sklaven, die im Zimmer geblieben waren, einige Befehle. Dann winkte sie einen blonden, kräftig gebauten Mann herbei, von dem sie wußte, daß er die schweren Hausarbeiten zu erledigen hatte. »Hilf mir, den Toten auf sein Bett zu tragen.«
Der Sklave schlug ein Schutzzeichen mit der Linken und blieb stehen, als hätte er sie nicht verstanden.
»Hörst du nicht, du sollst mir helfen!«
»Ich … Ich kann nicht.«
»Was soll das heißen?«
»Einen Toten zu berühren, bringt Unglück. Ich …«
Šamu schüttelte ärgerlich den Kopf. Sie vergaß immer wieder, daß die Römer ein völlig anderes Verhältnis zum Tod hatten als die Ägypter. Sie fürchteten sich, einen Verstorbenen auch nur flüchtig zu berühren, bevor nicht Priester die Totenweihe vorgenommen hatten.
Resignierend bückte sich Šamu und versuchte, Rechmire wenigstens auf den Rücken zu drehen, wenn sie schon keine Hilfe bekam, um ihn auf sein Lager zu heben.
Sie packte ihn an der Schulter und rollte ihn herum.
Als sie in das Gesicht des Schreibers blickte, schlug auch sie hastig ein Schutzzeichen gegen böse Mächte. Der blonde Sklave an ihrer Seite fing laut an zu beten.
Rechmire war nicht bloß ermordet worden. Man hatte ihn regelrecht hingerichtet. Obwohl Šamu der Anblick von Toten vertraut war und sie auch schon mehrfach dem Ritual des Einbalsamierens beigewohnt hatte, dauerte es doch eine Weile, bis sie ihre Fassung wiederfand.
Der Mörder hatte Rechmire beide Augen ausgestochen. Eine große, blutige Wunde klaffte in seiner linken Brusthälfte. Vorsichtig fuhr Šamu die Wundränder mit ihren Fingerspitzen ab. Man hatte dem Schreiber das Herz aus dem Leib geschnitten. Wenn Anubis Rechmire vor das Gericht des Re führte und der Schreiber kein Herz mehr besaß, dann war er verloren. Das Herz mußte vor den Augen der Götter auf die Totenwaage gelegt werden. Nur so konnte Rechmire beweisen, ein göttergefälliges Leben geführt zu haben. Konnte er diesen Beweis nicht erbringen, dann würde er den zweiten Tod im Rachen der Großen Schlingerin sterben und wäre auf immer verloren.
Wieder blickte Šamu auf den blutigen Schriftzug am Boden. Waren es vielleicht Priester, die den Schreiber getötet hatten? Kein normaler Mörder würde einen solchen Aufwand betreiben. Doch wenn Priester hinter dem Mord steckten, stellten sich nur noch mehr Fragen. Für welches Verbrechen hatten sie Rechmire gerichtet, der doch selbst einst ein hohes Amt in der Isispriesterschaft bekleidet hatte? Und vor allem, woher waren sie gekommen? Soweit Šamu wußte, gab es in ganz Rom keinen Schrein des Seth, ja vermutlich nicht einmal in ganz Italien. Der schreckliche Gott hatte doch selbst in Ägypten nur noch wenige Anhänger.
Resigniert wandte sie sich ab und machte sich auf die Suche nach einigen der ägyptischen Sklaven, die Ptolemaios mit nach Rom gebracht hatte. Sie sollten ihr dabei helfen, den Toten zu waschen und auf sein Bett zu legen.
* * *
»Du willst was?« Philippos hatte seine Reisekiste wieder abgestellt und sich breitbeinig vor den riesigen insularius gestellt, der ungefragt in seine Wohnung gekommen war. Der hünenhafte Hausmeister war mehr als einen Kopf größer als der Arzt und hatte einen Rücken, so breit, als sei er einmal Faustkämpfer oder gar Gladiator gewesen.
»Ich denke, ich habe mich klar ausgedrückt!« Der Riese bedachte Philippos mit einem überheblichen Lächeln. »Es ist üblich, die vollständige Miete zu entrichten, wenn man seine Wohnung aufgibt. Wenn du bis Sonnenuntergang das Geld heranschaffst, werde ich großmütig darüber hinwegsehen, daß du verschwinden wolltest, ohne auch nur einen Sesterz Miete gezahlt zu haben.«
»Was du verlangst, grenzt an Halsabschneiderei! Warum sollte ich für ein Vierteljahr zahlen, wenn ich nicht einmal fünf Wochen hier gewohnt habe? Überhaupt ist diese insula eine Zumutung. Das Dach hat einen Brandschaden, und in den Läden im Erdgeschoß gibt es nicht weniger als fünf Schlachter. Wie soll ein Kranker Vertrauen zu einem Arzt fassen, wenn er auf dem Weg zu dessen Praxis an einem halben Dutzend Barbaren mit blutigen Messern in den Händen vorbei muß und …«
»Das reicht!« Der insularius packte Philippos am Halsausschnitt seiner tunica und zog ihn zu sich heran. »Hat dich Crassus vielleicht gezwungen, hier einzuziehen? Entweder du zahlst, Grieche, oder dich wird noch vor Sonnenaufgang ein großes Unglück treffen. Crassus unterhält eine halbe centurie ausgemusterter Legionäre, die nichts anderes zu tun haben, als sich um Querulanten wie dich zu kümmern. Du warst doch selbst mal bei den Legionen. Ich brauch dir also nicht zu erzählen, wozu diese Kerle fähig sind.« So schnell und überraschend, wie der insularius zugepackt hatte, ließ er Philippos nun wieder los.
Er hätte das Fenster zum Hinterhof verhängen sollen, dachte der Arzt wütend. Sicher hatte ihn einer der netten Nachbarn beim insularius gemeldet! Eine halbe Stunde später, und er wäre auf und davon gewesen …
»Damit du nicht auf dumme Gedanken kommst, werde ich jetzt deine Truhe mitnehmen.« Der Hüne machte schon Anstalten, sich nach der Reisekiste zu bücken, als Philippos ihm in den Arm fiel. In der eisenbeschlagenen Kiste hatte er neben seinen wenigen Habseligkeiten auch sein ganzes Geld verstaut. Nur die Götter mochten wissen, was er davon jemals wiedersehen würde, wenn die Kiste erst einmal in den Händen dieses Tyrannen gelandet war!
»Laßt mich meine Schuld lieber jetzt begleichen. Ich möchte doch nicht, daß du oder dein Herr mich in schlechter Erinnerung behalten.«
Der Hausmeister runzelte die Stirn. »Du hast dein Geld hier? Wie leichtfertig …«
»Aber nein, ich weiß doch, daß das Haus unter deiner Obhut steht und ich hier so sicher wie in einem Legionslager bin.«
Septimus lächelte zufrieden. Wie die meisten schlichten Gemüter war auch er ganz offensichtlich anfällig für Schmeicheleien.
»Wo zwei so kräftige Arme wie die deinen für Ordnung sorgen, was sollte da wohl passieren?«
Der Hausmeister nickte zufrieden. »Das hast du ganz richtig erkannt, Philippos. Hier in dieser insula hat es noch nie Ärger gegeben. Jeder weiß, daß der Wohnblock unter dem Schutz des Crassus steht. Sich mit ihm anzulegen, ist fast schon so, als würde man Jupiter herausfordern.«
Philippos musterte Septimus aus den Augenwinkeln, während er in dem kleinen Lederbeutel an seinem Gürtel nach dem Schlüssel für die Truhe kramte. Männer wie diesen Septimus würde er niemals begreifen. Obwohl der Hausmeister selbst nur ein Unfreier war, schien er Crassus geradezu anzubeten. Dabei war Crassus der größte Sklavenschlächter der ganzen Stadt! Nachdem er zusammen mit Pompeius den Aufstand des Spartakus niedergeschlagen hatte, war es Marcus Licinius Crassus gewesen, der den Befehl zur Kreuzigung von Tausenden der aufständischen Sklaven entlang der via appia gegeben hatte.
Muskeln und Hirn waren zwei Dinge, die selten zusammengingen, dachte Philippos schmunzelnd. Dann öffnete er den Deckel der Truhe und zählte von dem Geld, das er in seiner Zeit als Legionsarzt angespart hatte, die Summe ab, die er Septimus schuldig war.
Kritisch drehte der Hausmeister die silbernen Denare zwischen den Fingern und musterte jede einzelne Münze. Ja, eine ließ er sogar zu Boden fallen, so als könne er aus dem Klang auf die Reinheit des Silbers schließen.
»Du kannst mir ruhig trauen«, brummte Philippos verärgert.
»Es stammt alles aus den Soldtruhen der Legionen.«
Septimus ließ sich durch den Einwand nicht aus der Ruhe bringen. Erst als er jede Münze geprüft hatte, ließ er das Geld in seiner Lederbörse verschwinden. »Du scheinst ein reicher Mann zu sein.«
Philippos konnte förmlich sehen, was hinter der Stirn des Sklaven vor sich ging. Vermutlich dachte er daran, einige seiner Spießgesellen zusammenzurufen und ihm die Kiste rauben zu lassen. Bei den unsicheren Zuständen auf den Straßen der Stadt wäre das ein ganz alltägliches Verbrechen. Es gab nur einen Weg, ihn davon abzuhalten.
»Möchtest du dir wohl etwas verdienen?«
Septimus legte den Kopf schief. »Womit?«
»Nun, ich bräuchte vielleicht jemanden, der mich ein Stück die via appia hinab begleitet. Nicht weit … Kaum eine Meile. Wenn du mir meine Truhe tragen könntest, würde ich dich reich entlohnen. Vor Sonnenuntergang wärest du längst wieder zurück.«
»Wieviel zahlst du?«
Philippos knabberte nervös an seiner Unterlippe. Diese Art von Verhandlungen haßte er. »Wieviel verlangst du?«
»Du machst das Angebot!«
Störrisch wie ein alter Esel, dachte Philippos wütend. Wieviel mußte er Septimus wohl überlassen, damit er keinen Ärger machte? »Nun, ich bin kein pontischer Fürst«, fing der Arzt zögerlich an. »Trotzdem sollst du mich nicht als kleinlich in Erinnerung behalten. Ich denke, ein Denar wäre eine angemessene Bezahlung.«
»Ein Denar!« Septimus lachte lauthals. »Dafür mach' nur selbst deinen Rücken krumm.« Der Sklave wandte sich zur Tür und wollte offensichtlich gehen.
»Halt, warte!« Philippos packte ihn bei der Schulter. »Das war doch nur ein Spaß.«
»Mir ist aber nicht nach Späßen zumute, Krämerseele. Entweder du machst mir ein vernünftiges Angebot, oder du schleppst deine Kiste allein.«
Der Arzt ballte wütend die Fäuste. Er konnte seine Kiste durchaus allein tragen! Der einzige Grund, warum er diesen erpresserischen Schurken nicht einfach hinauswarf, war, daß er nicht genau wußte, welches Gesindel zu Septimus' Freunden gehörte. Wenn er irgendwelche Verbindungen zu den Straßenbanden von Clodius oder Milo hatte, würde er mit seiner Kiste wohl niemals die via appia erreichen.
Philippos mußte wieder einmal an das schreckliche Omen vom Vortag denken. Die Tote, die ihm zugewinkt hatte. Vielleicht würden ihn ja irgendwelche Halsabschneider wegen seines Geldes umbringen? Nein, jetzt war wirklich nicht der Zeitpunkt, geizig zu sein!
»Was ist nun?« knurrte der insularius ärgerlich. »Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit …«
»Ich biete dir …« Das Wort wollte Philippos einfach nicht über die Lippen. Er mußte daran denken, wie mühsam er sich sein bescheidenes Vermögen As für As zusammengespart hatte.
»Was bietest du?«
»Nach reiflicher Überlegung … Da du den stolzen Namen Septimus trägst …« Der Arzt hatte das Gefühl, daß ihm ein Daimon die Kehle zupreßte. Er räusperte sich. »Also, ich würde dich mit der fürstlichen Summe von sieben Denaren entlohnen, wenn du mich bis zur Stellmacherei des Telemachos an der via appia begleitest.«
»Sieben Denare!« Septimus stieß einen leisen Pfiff aus. »Nun, ich denke, für eine solche Summe werde ich dir diesen kleinen Freundschaftsdienst durchaus erweisen können.«
»Ich wußte doch, daß ein treues Herz in deiner Brust schlägt!«
Philippos mußte sich zusammenreißen, um nicht allzu ironisch zu sprechen. Sieben Denare! Das war der Wochenlohn eines Handwerkers! Und dann noch die Unkosten für die Reise … Wenn er so weiter machte, wäre er in kürzester Zeit ruiniert. Sein einziger Trost war, daß das Leben billiger wurde, wenn er Rom erst einmal hinter sich gelassen hätte.
* * *
Šamu war gerade damit beschäftigt, Rechmires Kinn mit einer Leinenbinde zu fixieren, als eine ganze Gesandtschaft römischer Würdenträger ins atrium eintrat. Soweit sie das durch die offene Tür der Totenkammer erkennen konnte, trugen sie fast alle die toga praetexta, das mit einem Purpurstreifen geschmückte Ehrengewand der Priester und Staatsbeamten. Der einzige unter den Römern, den sie zumindest vom Sehen her kannte, war Gnaeus Pompeius Magnus, ihr Gastgeber. Ob es ihm wohl gelungen war, im Senat die Bitte des Ptolemaios um militärische Unterstützung durchzusetzen?
Ohne sich um das Hofzeremoniell zu kümmern, das der oberste Eunuch des Pharao auch unter den eingeschränkten Möglichkeiten der nicht allzu weitläufigen Stadtvilla aufrechtzuerhalten versuchte, durchquerten die Römer das atrium. Selbstbewußt machten sie nicht die geringsten Anstalten, darauf zu warten, daß der Neue Osiris ihnen eine Audienz gewährte.
Fast hatten sie schon das gegenüberliegende Ende des Hofes erreicht, als Pompeius plötzlich mitten im Schritt verharrte und dann ein wenig zur Seite auswich.
Neugierig reckte Šamu den Hals. Was mochte das zu bedeuten haben? Auch die anderen Römer folgten dem unerklärlichen Schwenk ihres Anführers.
Mit festem Schritt eilte Pompeius dann den kleinen Flur am tablinum vorbei geradewegs auf die Gemächer des Pharao zu. Während seine senatorischen Gefolgsleute feingeschnürte Sandalen aus rotgefärbtem Leder bevorzugten, trug er als einziger eisenbeschlagene caligae, die Stiefel eines Soldaten.
Als die Gesandtschaft außer Sichtweite war, trat Šamu ins atrium und erkannte, wer den Römern Einhalt geboten hatte. Es war der Welteroberer Alexander. Offensichtlich hatte sich Pompeius gescheut, auf das Mosaikbild des Makedonen zu treten. Lag Aberglaube oder Respekt hinter diesem Verhalten?
Šamu mußte an die Worte Rechmires denken: Pompeius träumt noch heute davon, die Parther zu besiegen und die Grenzen des römischen Reiches bis nach India auszudehnen. Er ist besessen von der Idee, ein ebenso bedeutender Feldherr wie Alexander zu sein. Was für ein Mann war das nur, in dessen Hände der göttliche Ptolemaios sein Schicksal gelegt hatte?
* * *
Zufrieden umrundete Philippos den Circus Maximus und genoß die letzten Strahlen der spätherbstlichen Sonne. Den Groll über das Vermögen, das er Septimus überlassen mußte, hatte er fast vergessen. Der Unfreie hatte ihn dafür sicher aus der Stadt hinaus begleitet und die ganze Zeit über die schwere Holzkiste getragen.
Außerdem, so dachte Philippos, hatte er aus seinem Fehler gelernt. Lächelnd streichelte er über den kleinen Siegelring an seiner Hand. Nachdem Septimus gegangen war und man die Kiste in der Stellmacherei eingelagert hatte, war Philippos noch einmal in die Stadt zurückgekehrt. Dort hatte er fast seine ganze Barschaft bei einem argentarus hinterlegt und dafür ein Dokument erhalten, das er gemeinsam mit dem Siegelring bei einem Kollegen des Bankiers in Pompeji vorlegen sollte, um dort dann eine entsprechende Summe Geldes ausgehändigt zu bekommen. So brauchte er auf der Reise in den Süden nicht um seine Barschaft zu fürchten. Er hatte gerade noch soviel dabei, wie er zum Leben brauchte.
Noch fünf oder sechs Tage und er wäre in Pompeji, der Stadt, in der sich sein ehemaliger Mentor Quintus Aurelianus niedergelassen hatte. Alles, was er war, verdankte Philippos diesem Mann. Er hatte ihn in Spanien unter den einfachen Legionären ausgewählt, um ihm bei der Behandlung der Verletzten und Kranken zu helfen. Und da Philippos sich als geschickter erwiesen hatte als andere, brachte Aurelianus ihm alles bei, was er über die Heilkunst wußte, ja er ließ ihn zum Schluß sogar die wenigen kostbaren Bücher lesen, die er besaß.
Wie es dem alten Kerl wohl ergangen war, dachte Philippos. Acht Jahre lang hatte er von Quintus nichts mehr gehört. Er wußte nur, daß der Arzt sich in Pompeji niederlassen wollte, weil er dort Verwandte hatte. Sicher könnte Quintus ihm auch diesmal helfen. Die Bucht von Neapolis war auf jeden Fall bedeutend schöner als das schmutzige Rom. Dort würde er einen neuen Anfang machen, und sein Schicksal würde sich wieder zum Guten wenden!
Ganz in der Stimmung, ein paar Asse für Honiggebäck auszulegen, schlenderte Philippos über den Platz vor dem Circus Maximus und betrachtete die Auslagen der verschiedenen Stände, die auf dem Markt aufgebaut waren. Bauern aus der Umgebung versuchten, ein paar Scheffel Korn an den Mann zu bringen, fliegende Händler stapelten Öllämpchen, Teller und andere Haushaltsgeräte auf ihren schmalen Tischen, und ein Barbier pries lauthals seine sichere Hand, die angeblich noch niemals das Blut eines Kunden gesehen hatte. Ein kleines Zelt aus fadenscheinigem grünen Stoff erweckte Philippos besondere Aufmerksamkeit. Das Tuch war über und über mit magischen Symbolen, Schutzzeichen und den Namen von Göttern und Daimonen bestickt. Es stand ein wenig abseits, und Philippos wunderte sich, daß sich überhaupt schon wieder Hexen und Wahrsager in die Stadt wagten. Soweit er wußte, hatten die aedilen erst vor weniger als einem halben Jahr alle Angehörigen dieser zweifelhaften Zünfte aus den Grenzen des pomeriums verbannt.
Neugierig strich der Arzt um das Zelt. Nahe dem Eingang saß eine Frau in mittleren Jahren mit einem kantigen, fast abweisenden Gesicht. Philippos hatte das Gefühl, daß auch sie ihn beobachtete. Schließlich erhob sie sich, gab ihm einen Wink und verschwand dann, ohne sich noch einmal nach ihm umzusehen, im Inneren des Zeltes, so als sei sie sich völlig sicher, daß er ihr folgen würde.
Unsicher blickte sich Philippos um. Außer ihm war niemand in der Nähe, dem diese Geste gegolten haben konnte. Sollte er? Vielleicht konnte er sich mit Hilfe der Hexe an der Isispriesterin rächen? Seitdem er diese verfluchte Ägypterin getroffen hatte, schien das Unglück nicht mehr von seiner Seite weichen zu wollen.
Schließlich faßte Philippos sich ein Herz und trat in das dunkle Zelt. Nur eine einzige Öllampe, deren Docht weit zurückgeschnitten war, erhellte das Zwielicht. Die Hexe hockte ganz am hinteren Ende des Zeltes, dort wo es am dunkelsten war, und blickte in eine flache, mit Wasser gefüllte Bronzeschale. Der schwere Duft getrockneter Kräuter lag in der Luft. Einige erkannte Philippos am Geruch, doch die meisten waren ihm fremd.
Eine ganze Weile musterte der Arzt die Hexe. Sie schien nicht die geringste Notiz von ihm zu nehmen. Vorgebeugt hockte sie auf ihrem niedrigen Schemel, und die Haare fielen vor ihr Gesicht, so daß er nicht in ihren Zügen lesen konnte. Die Frau trug ein schlichtes, rotes Gewand und einen schweren Mantel aus grüner Wolle, der von einer kunstvoll geschmiedeten Bronzespange gehalten wurde. Arm war sie offensichtlich nicht! Wenn sie Geld hatte, mußte sie wohl auch erfolgreich sein, überlegte Philippos. Für ihren Einfluß sprach auch, daß sie die einzige war, die hier einen Stand hatte. Sicher gab es einige reiche Patrizier, die schützend ihre Hand über sie hielten. Ja, vielleicht besuchte sie sogar der eine oder andere Senator?
Philippos räusperte sich leise, um die Frau auf sich aufmerksam zu machen, doch nichts geschah. Noch immer hockte sie mit gesenktem Kopf über der Bronzeschale. Ob sie ihn vielleicht als Kunden ablehnte? Aber sie hatte ihm doch zugewunken! Er räusperte sich ein zweites Mal. Diesmal ein wenig lauter. Vergebens! Offensichtlich wollte sie nichts mit ihm zu tun haben. Resignierend drehte sich Philippos um und wollte das Zelte verlassen.
»Du bist dem Tod begegnet, nicht wahr?« Die Stimme hinter ihm klang dunkel, fast ein wenig rauh und hatte einen Akzent, den der Arzt nicht zuordnen konnte. Überrascht blickte er sich um. Die Hexe hatte den Kopf erhoben und gab ihm ein Zeichen, vor ihr auf einem Schemel Platz zu nehmen.
Einen Augenblick lang überlegte Philippos, ob er nicht einfach das Zelt verlassen sollte. Die Art, wie diese Frau ihn behandelte, war ihm unheimlich. Ihre Selbstsicherheit, ihr mysteriöses Verhalten … Sprachen durch ihren Mund wirklich Daimonen und Götter, oder war sie nur eine geschickte Betrügerin? Noch nie zuvor hatte er eine Hexe aufgesucht.
»Nun?« Die Frau legte den Kopf schief und blickte ihn mit ihren dunklen Augen herausfordernd an. Spürte sie seinen Zweifel, seine Unsicherheit?
Der Arzt reckte sein Kinn vor und trat einen Schritt auf die Hexe zu. Er hatte diese Sache begonnen, er würde sie auch zu Ende führen! Er ließ sich auf dem Schemel nieder und begann zu erzählen, was ihm in den letzten beiden Tagen an Unglück widerfahren war.
Nachdem er geendet hatte, sah die Hexe ihn lange Zeit schweigend an, so als könne sie in seinen Augen sein Schicksal lesen. Wie ein Fels lastete ihr Schweigen auf Philippos' Gemüt. War seine Zukunft denn so schrecklich, daß sie keine Worte dafür fand? Und dieser Blick! Er empfand ihn fast wie eine Berührung, ja schlimmer sogar, ihm war, als könne sie in die verborgensten Abgründe seiner Seele blicken. Nervös begann er, mit der Rechten am Saum seiner tunika herumzufingern. Wäre er doch bloß nie in dieses Zelt gekommen! Was hatte er sich dabei nur gedacht? Ärzte und Hexen, das paßte nicht zusammen, das waren zwei verschiedene Welten!
»Gegen die Priesterin werde ich dir nicht beistehen. Sie dient auf ihre Art der Großen Göttin, was uns fast zu Schwestern macht. Auch kann ich nicht erkennen, welches Unrecht sie dir zugefügt hat. Du hättest gestern nicht das atrium des Gabinius betreten dürfen. Ich fühle, daß dieser Besuch noch für lange Zeit dein Schicksal bestimmen wird. Ein Schatten liegt über dir, Philippos, und du wirst dem Tod nicht davonlaufen können, denn wohin du dich auch wendest, er wird dir folgen. Gestern auf dem Esquilin ruhte der Blick der Götter auf dir. Als du vorhin in mein Zelt getreten bist, konnte ich im Wasser einen nackten Mann mit einem Hundekopf sehen, er streckt seine Hand nach dir aus. Außerdem sind da zwei goldene Adler, die miteinander kämpfen. Ihre Beute ist ein dritter Adler, der mit gebrochenen Flügeln auf einem bunten Steinboden sitzt, vielleicht auf einem Mosaik.«
Philippos wich erschaudernd vor der Frau zurück. Was für verrücktes Geschwätz! Männer mit Hundeköpfen! Er hätte niemals hierherkommen dürfen!
»Du warst doch einst bei den Legionen, oder irre ich mich, Fremder?«
Woher wußte diese Hexe das?
Die Zauberin schüttelte lächelnd den Kopf. »Das hat nichts mit Magie zu tun. Ich habe die Narben auf deinem rechten Arm gesehen. Sie sehen aus wie die von Schwertern oder Dolchen. Dein linker Arm hingegen, an dem du deinen Schild getragen hast, blieb unverwundet. Wie ein Gladiator oder einer der Schläger, die die Straßen unsicher machen, siehst du aber nicht aus. Also mußt du bei den Legionen gewesen sein. Auch dein Alter paßt zu dieser Vermutung. Wahrscheinlich bist du erst vor wenigen Monaten aus dem Dienst entlassen worden.«
»Das stimmt!« Philippos blickte die Frau mit großen Augen an. Eine solch schlüssige Kette logischer Folgerungen, die obendrein auch noch zu einem richtigen Ergebnis führten, hätte er vielleicht bei einem Philosophen oder Rhetoriker erwartet, nicht aber bei einer Hexe. Oder war es vielleicht möglich, daß sie ihn kannte? Er musterte sie scharf, doch fand er an ihrem Gesicht nichts Vertrautes. Nein, er hatte diese Frau noch nie in seinem Leben gesehen!
»Wieviel bin ich dir schuldig?« Philippos hatte es eilig, von der Hexe wegzukommen.
»So viel, wie dir mein Rat wert ist. Wenn du klug bist, solltest du zum Esquilin zurückkehren und dafür sorgen, daß jene, die dir winkte, ein angemessenes Begräbnis bekommt. So wirst du den Geist der Toten besänftigen und vielleicht noch für eine Weile der Aufmerksamkeit des Aïdoneus entgehen.«
»Du glaubst wirklich, daß …« Philippos hütete sich, den Namen des Hades, den die Hexe nur bei seinem Beinamen – der nicht Sichtbare – genannt hatte, in den Mund zu nehmen. Mit solchen Leichtfertigkeiten machte man den Gott nur vor der Zeit auf sich aufmerksam. »Du glaubst, daß Er schon auf mich wartet?«
Die Hexe zuckte mit den Achseln. »Man kann das Zeichen, das du erhalten hast, tatsächlich so deuten.«
Der Arzt schluckte. Sein Mund war plötzlich trocken wie Staub, und blanker Schweiß stand ihm auf der Stirn. Mit zitternden Händen griff er nach seiner Geldkatze und reichte der Hexe eine Handvoll Sesterzen. »Ich werde deinem Rat folgen.« Philippos' Stimme klang rauh wie das Krächzen eines Raben.
Hastig stand er auf und eilte dann aus dem Zelt, so als säßen ihm die Erinnyen im Nacken.
* * *
Erst als das Auge des Horus schon hoch am Himmel stand, fand Šamu Gelegenheit, allein bei dem Leichnam Rechmires zu trauern. Ohne den alten Schreiber fühlte sie sich noch verlorener in diesem fremden Land. Es gab niemanden mehr im Gefolge des Pharao, mit dem sie so offen sprechen konnte, wie sie es mit Rechmire getan hatte. Der Schreiber hatte sich, so weit sie wußte, nie in die Palastintrigen eingemischt. Sie hatte ihn gekannt, seit sie vor vielen Jahren aus dem Tempel auf Philae nach Alexandria gekommen war. Welchen Grund mochte es nur geben, einen Mann wie ihn zu ermorden?
Wütend ballte sie die Fäuste. Der Pharao hatte ihr befohlen, sich um den Toten zu kümmern. Wie Isis, die die Teile des von Seth zerstückelten Osiris überall auf der Welt gesucht hatte, würde auch sie nicht ruhen, bevor sie die verschwundenen Teile von Rechmires Leichnam wiedergefunden hatte. Und sollte ihr dies nicht gelingen, so würde sie zumindest den Mörder entlarven und dem Gericht des Ptolemaios übergeben. Der Pharao würde dem Mörder ein nicht minder grausiges Ende bereiten, als Rechmire es erfahren mußte.
Erst bei der Totenwaschung hatte Šamu das volle Ausmaß des Frevels entdeckt, den man an dem Schreiber begangen hatte. Nicht allein sein Herz war herausgeschnitten worden, auch seine Genitalien waren abgetrennt und verschwunden. Die Wunde an seinem Hals war so tief, als hätten die Mörder versucht, auch noch seinen Kopf mitzunehmen. Als sie die tödliche Verletzung näher untersuchte, hatte sie dicht über dem klaffenden Schnitt eine dünne blaue Linie gefunden. Offensichtlich war der Schreiber zunächst mit einer Lederschlinge gewürgt worden, so daß er nicht mehr in der Lage war, um Hilfe zu rufen. Womöglich hatten die Meuchler ihm dann bei lebendigem Leib das Herz herausgeschnitten.
Wer würde so etwas tun? Und was hatte das Zeichen des Seth zu bedeuten? Waren es Priester, die Rechmire ermordet hatten?
Sie versuchte, sich noch einmal an die Einzelheiten des Schreckensfundes zu erinnern. Rechmires Perücke hatte über dem mit Blut geschriebenen Götternamen gelegen. Die Mörder hatten die alte Tempelschrift benutzt. Nur wenige vermochten die Bilderschrift der Alten noch zum Sprechen zu bringen. Auch das wies darauf hin, daß die Mörder aus einem Tempel stammten. Außer ihr selber waren nur wenige Angehörige aus dem Gefolge des Ptolemaios in der Lage, diese Zeichen zu lesen.
Ungewöhnlich war auch, wie wenig Blut trotz der schrecklichen Wunden Rechmires auf dem Fußboden zu sehen gewesen war. Šamu hatte einmal erlebt, wie ein Soldat aus der Palastwache im Streit von einem seiner Kameraden niedergestochen worden war und verblutete, ohne daß sie ihm noch hätte helfen können. Zum Schluß hatte der Soldat in einer riesigen roten Lache gelegen. Nicht so Rechmire. Womöglich war der Schreiber gar nicht in seinem Zimmer ermordet worden? Šamu erinnerte sich, daß sie ihn im Mondlicht im Garten gesehen hatte. Doch wozu hätten die Mörder ihn ins Haus schaffen sollen? Vielleicht, damit man ihn schneller fand?
Die Priesterin schüttelte den Kopf. Das ergab keinen Sinn! Der Garten war zu klein, als daß die Leiche lange unbemerkt geblieben wäre. Trotzdem hätten die Mörder dort womöglich eher eine Spur zurückgelassen. Šamu warf einen letzten Blick auf den aufgebahrten Leichnam des Schreibers und schwor, nicht eher zu ruhen, bis diese Bluttat gesühnt war.