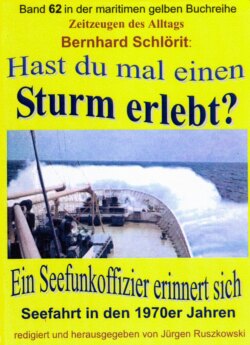Читать книгу Hast du mal einen Sturm erlebt? - Bernhard Schlörit - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der lange Marsch zum Seefahrtsberuf
Оглавлениеoder
Warum denn einfach, wenn es auch umständlich geht?
Meine persönliche Kiellegung fand 1949 statt, da kam ich in dem schönen Städtchen Miltenberg am Main zur Welt. Na ja, es wahr wohl eher der Stapellauf, die Kiellegung wurde neun Monate früher inszeniert…
Ich war noch im Kindergartenalter, als meine Eltern getrennte Wege gingen. Meine Mutter musste sich nun mit mir alleine durchschlagen, in jener Zeit noch ein recht schwieriges Unterfangen. So überließ sie mich und meine Erziehung ihrem Onkel und dessen Frau, die beiden Leutchen holten mich zu sich in den Odenwald, und später wurde ich dann im Einvernehmen aller Beteiligten von ihnen adoptiert. Mein neuer Vater war Mechanikermeister, grundsolide und bodenständig, den Lebensunterhalt verdiente er mit einer kleinen Fahrradwerkstatt, in den späteren Jahren dann als Meister in einer Fabrik für Bergbaufahrzeuge. Weiter entfernt von der christlichen Seefahrt kann ein soziales Umfeld nicht sein.
Eine Realschule im Nachbarstädtchen wurde mit der undankbaren Mission meiner Schulbildung beauftragt. Eltern und Lehrer gedachten mich wenigstens bis zur Mittleren Reife zu „fördern“, meine Mitarbeit hielt sich allerdings in Grenzen.
Für den Physikunterricht war ein gewisser Herr Müller zuständig. Im Kriege hatte er als Funker gedient, in einer Unterrichtsstunde zu dem Thema ‚angewandte Elektrophysik’ schleppte er einen Tongenerator herbei und beglückte uns sichtlich begeistert mit einer kleinen Einführung in die Kunst des Morsens. Ich saß wie üblich in der letzten Reihe des Physiksaales und dachte: ‚Unglaublich, wie ein normaler Mensch seine Zeit mit dieser Piepserei verbringen kann. So erzeugt man also Tinnitus. Der hat doch nicht alle Latten am Zaun!’ Damit war das Thema für meine Person abgehakt. Von Zukunftsvisionen meinerseits konnte keine Rede sein…
Halbwegs akzeptable Leistungen erbrachte ich in Deutsch, Geschichte und Geographie, grottenschlecht war das, was ich in allen naturwissenschaftlichen Fächern, Mathematik, Physik und dergleichen ablieferte, die Noten waren entsprechend. Nicht gerade die ideale Voraussetzung für die doch ziemlich technische Ausbildung zum Berufsfunker, wie mir später klar wurde.
1965 muss es wohl eine Generalamnestie für lernfaule Schüler gegeben haben, mir wurde tatsächlich das Zeugnis der mittleren Reife zuerkannt, Eltern und auch einige Lehrer waren gleichermaßen überrascht. Ich ebenfalls. Um meine Vorstellungen von einem interessanten und abenteuerlichen Beruf umzusetzen, hatte ich mir ausgerechnet die Bundeswehr als geeignete Plattform auserkoren, nicht unbedingt eine meiner großartigsten Ideen, man war halt 16 Jahre jung und entsprechend ‚schlau’. Angedacht war, das Jahr bis zu meinem 17. Geburtstag als Jobber zu überbrücken und dann zu den Fahnen zu eilen. Mein Vater, mit dieser tollen Absicht konfrontiert, war zunächst mal fassungslos. Er gehörte zu der Generation, die noch lange unter den Folgen des Krieges litt, Uniformträger waren ihm gründlich verhasst. Vielleicht mit Ausnahme des Postboten. Nach mehreren Krisensitzungen des Familienrates kam es zu einer erzwungenen Planänderung. Im April 1965 erhielt der Möchtegernsoldat eine Lehrstelle beim Landratsamt des Odenwaldkreises. Vater erhoffte sich von der Verwaltungslehre einen späteren Wechsel in die Beamtenlaufbahn mit guter Absicherung für seinen Filius. „Junge, denk auch mal an die Pension!“ Kein Mensch denkt mit 16 Jahren an die Pension, aber in diesem Alter hatte man damals wenig Alternativen, wenn die Eltern nicht kooperierten…
Den Ausschlag für die Wahl der Lehrstelle gab für mich die kurze Dauer der Ausbildung, sie sollte in zwei statt wie sonst üblich in drei Jahren erfolgen. Zeit genug, den alten Herrn mittels zäher Verhandlungen zur Unterschrift auf meine Freiwilligenmeldung zu bewegen. Man erinnere sich, dass die Volljährigkeit damals erst mit 21 Jahren erreicht war, um die Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten kam man nicht herum.
Dass ich in dieser Zeit recht flüssig den Umgang mit der Schreibmaschine erlernte und doch eine ganze Menge über Verwaltung und administratives Handeln vermittelt bekam, sollte sich später als Funkoffizier noch mal sehr nützlich erweisen. Das ließ sich aber in jenen Jahren noch nicht einmal erahnen.
Mein Vater gab dann auch irgendwann resigniert auf und unterschrieb, im Herbst 1966 ging es nach Wiesbaden zur Freiwilligenannahmestelle des Heeres, um einen zweitägigen Eignungstest und die obligatorische Musterung zu absolvieren. Eine der Prüfungen war der so genannte INT-Test. Uns wurden die drei Morsezeichen für I (..), für N (-.)und für T (-) erklärt, dann diese drei Zeichen in immer schneller werdender Folge vom Band abgespielt, und die Prüflinge hatten auf einem Vordruck die dort dargestellten Buchstaben richtig anzukreuzen. So gedachte man die Kandidaten mit Morsetalent herauszufiltern. Ich schrieb recht entspannt mit, es lag nicht in meiner Absicht, mich auf diesem Gebiet zu profilieren.
Zum Abschluss der beiden Tage führte ein Laufbahnberater Gespräche mit allen Bewerbern. Mir schwebte eine Verwendung bei den Fallschirmjägern vor, man brachte mir aber schonend bei, dass ein magerer Brillenträger mit latenter Höhenangst nicht unbedingt der Traumkandidat dieser Waffengattung sei. Mir wäre aber einer der besten INT-Tests gelungen, damit sei die Fernmeldetruppe für mich das Richtige. Das klang überzeugend, jeder hört gerne, dass er irgendwo einer der Besten sei. Und schon hatten sie meine Unterschrift unter einer Verpflichtungserklärung für vier Jahre.
Nach sechs Monaten allgemeinmilitärischer Ausbildung in Sonthofen im Allgäu wurden alle dort ermittelten ‚Morsetalente’ nach Rotenburg an der Wümme versetzt, wir waren für den Dienst in einer EloKa-Einheit vorgesehen.
EloKa steht für elektronische Kampfführung, dieser Verein befasste sich unter anderem mit der Aufklärung und Überwachung des Funkdienstes der Sowjettruppen in der damaligen DDR. Wir sollten Horchfunker werden.
Ausbilder war ein Feldwebel Emmelmann, allgemein nur Johnny genannt. Johnny war als Moses, also Schiffsjunge, zur See gefahren, er strebte die klassische Laufbahn vom Schiffsjungen zum Kapitän an. Noch während der Ausbildung hatte er sich, mit einem Hansa-Dampfer in Südasien liegend, eine schwere Malaria eingefangen, verbrachte einige Monate in Colombo im Hospital und konnte dann aufgrund der gesundheitlichen Schädigungen den Berufswunsch vergessen. Er war ein lustiger Vogel, immer für irgendeinen Spaß zu haben, als Berufssoldat aber eine glatte Fehlbesetzung. Seine Erlebnisse aus zwei Jahren Fahrt bereicherten aber viele unserer Ausbildungsstunden, außerdem war er der erste leibhaftige Seemann, der mir über den Weg lief.
Im Übrigen verbrachten wir viel Zeit mit Hörausbildung. Nach dem Erlernen des Morsealphabets wurde zügig trainiert, wöchentlich steigerte sich das Tempo. Tempo 30 (Zeichen in der Minute), Tempo 40, Tempo 50 und so weiter. Johnny schaltete Tonbänder mit den Übungstexten auf unsere Kopfhörer und verschwand hinter der Bild-Zeitung, wir versuchten verzweifelt, dem immer schneller werdenden Tempo zu folgen. Dabei trennte sich auch die Spreu vom Weizen, einige Kameraden konnten irgendwann ihre Hörleistung nicht mehr steigern und wurden anderen Verwendungen überstellt. Mir gelang es, durchzuhalten, und nach einem abschließenden Lehrgang auf der Heeres-Fernmeldschule in Feldafing bestand ich die Horchfunkerprüfung.
Es folgten einige Jahre Einsatz im Horchdienst, wir hörten unsere sowjetischen ‚Kollegen’ drüben ab, peilten ihre Funkstellen an und fühlten uns als ganz tolle Hechte. Zur gleichen Zeit hörten deren Horchfunker unsere Fernmeldeverbindungen ab und fühlten sich bestimmt auch als ganz tolle Hechte. So war jedem gedient.
Das sich nähernde Dienstzeit-Ende warf nun die Frage auf, wie ich mir meine weitere berufliche Zukunft vorstellte. Zurück in den Verwaltungsdienst? Nee, danke schön, das fand schon in der Lehrzeit nicht meinen Beifall, ich glaubte kaum, dass es inzwischen spannender geworden war.
Da kam mein Kamerad Klaus M. ins Spiel, ebenfalls Horchfunker und Z4-Soldat sowie ausgebildeter Reedereikaufmann. Erlernt hatte er diesen Beruf bei der Hamburger Reederei Frigga, die damals ihre Massengutfrachter in der Erzfahrt einsetzte. Außerdem hatte er während seiner Lehrzeit in der ‚Kuhwerder Fähre’ Bier gezapft, Eingeweihten besser bekannt als „Tante Hermine“. Und dort schleppte er mich dann eines Tages hin, Hamburg war ja von Rotenburg aus schnell zu erreichen. In dieser legendären Seemannskneipe in der Hafenstraße, unweit der St.Pauli-Landungsbrücken, stellte mich Klaus einigen Fahrensleuten aus seinem Bekanntenkreis vor, eine ganze Nacht gab es Bier und wilde Storys, von beidem wohl etwas zu viel. Das hörte sich alles unglaublich interessant an, die hatten todsicher auch eine Verwendung für einen abenteuergeilen Odenwälder, der noch nicht genau wusste, wo seine Reise hingeht. De facto bin ich aufgrund eines eindrucksvollen Kneipenbesuches Seemann geworden. Wenigstens das habe ich mit so manchem „geshanghaiten“ Jantje aus der Zeit der Segelschiffe gemeinsam.
Hermine Brutschin-Hansen, die berühmte Wirtin, saß übrigens damals noch selbst an der Kasse dieser Pinte, ein Jahr danach ist sie verstorben.
Alte Postkarte von „Tante Hermines Kuhwerder Fähre“
Dank an Peter Nennstiel http://de.ask.com/web?l=sem&ifr=1&qsrc=999&q=Peter%20Nennstiel%20Hafenkneipen&siteid=3083&o=3083&ar_uid=BAE82F1D-BE08-47E7-A242-F50312082AF2&click_id=AC58DE61-8C65-48C2-AA6B-22615AC12984
Ich sollte einige Jahre später aber in der immer noch existierenden ‚Kuhwerder Fähre’ quasi mein Hauptquartier einrichten. Und nebenbei die Seefahrtschule besuchen…
Klaus meinte kurz und bündig: „Wenn dich das interessiert, machste mal eben das Seefunksonderzeugnis und dann fährste los. Null Problem, die suchen dringend Funker!“
„Wie lange dauert’n das?“ – „Na, ein halbes Jahr, dann biste fertig. Schaffste mit links, kannst doch hören und so…“ Damit war seine Berufsberatung abgeschlossen, ich schrieb den ‚Verband Deutscher Reeder’ um Informationsmaterial an und kontaktierte anschließend die Seefahrtschule Bremerhaven. Für den Oktober 1971 gab man mir die Zusage zu einem Seefunksonderzeugnis-Lehrgang. Seefahrt aufgepasst, Schlörit kommt! Von wegen…
April 1971. Vier Jahre Bundeswehr sind abgehakt. Mit der nach einer solchen Dienstzeit üblichen Abfindung und einer kleinen Erbschaft (Vater war kurz zuvor verstorben) kommt man sich richtig wohlhabend vor, somit bestand keine Notwendigkeit einer Arbeitsaufnahme vor Beginn des Funkerlehrganges. Im Mai spendierte ich mir meine erste große Auslandsreise, zwei Monate in den Norden der USA. Eine in Ohio lebende Tante stellte ihr Haus als Basislager zur Verfügung, von dort aus ließen sich viele touristische Hotspots leicht erreichen. Meinem etwas eingerosteten Schulenglisch tat das auch gut, und Englisch würde demnächst für meine Ausbildung einen hohen Stellenwert bekommen.
Im Sommer zurückgekehrt dann der Tiefschlag: Die Seefahrtschule teilte in einem nüchternen Anschreiben mit, dass der vorgesehene Lehrgang im Herbst nicht stattfinden würde. Dass sogar überhaupt kein Lehrgang für dieses Seefunksonderzeugnis mehr geplant sei, weil das Bundesverkehrsministerium keine Ausnahmegenehmigungen für Sonderfunker mehr erteilen werde. Aus der Traum.
Dazu muss ich ein wenig weiter ausholen. Zu dieser Zeit gab es vier verschiedene Befähigungszeugnisse, die zur Teilnahme am Seefunkdienst berechtigten. Das Seesprechfunkzeugnis war obligatorisch für alle nautischen Offiziere, auch Sportskipper erwarben es, damit durfte Sprechfunkdienst wahrgenommen werden. Für Berufsfunker war es praktisch in ihr Patent integriert. Die Ausbildung wurde zum Teil in Abendkursen angeboten. Das Seefunksonderzeugnis galt als Mindestanforderung für ‚hauptamtliche’ Funker, es war für den Einsatz auf Schiffen gedacht, die eigentlich gar nicht telegrafieausrüstungspflichtig waren, aufgrund ihres besonderen Einsatzes aber eine solche Station fuhren, Bergungsschlepper und Fischereifahrzeuge zum Beispiel. Dieses Zeugnis konnte man in sechsmonatigen Kursen erwerben. Erst das Seefunkzeugnis 2. Klasse berechtigte zum Dienst auf Frachtern aller Größen und in allen Fahrtgebieten, der Erwerb setzte eine abgeschlossene Berufsausbildung im Elektrofach und einen dreisemestrigen Besuch der Seefahrtschule voraus. Anstatt einer Berufsausbildung wurde auch ein zweijähriges Praktikum in der Elektrobranche anerkannt. Dieses Patent konnte in einem zusätzlichen Lehrgang auf 1. Klasse aufgestockt werden, damit durfte man auf Passagierschiffen oder bei Küstenfunkstellen arbeiten. Und mit diesen beiden Zeugnissen agierte der Inhaber auch unter der Berufsbezeichnung „Funkoffizier“, er trug bei zweiter Klasse zwei und bei erster Klasse drei Streifen an der Uniform und zählte damit zur Kaste der Handelsschiffsoffiziere.
Aufgrund des permanenten Funkermangels war es aber zur Regel geworden, Sonderzeugnisfunkern per Ausnahmegenehmigung den Dienst auf Frachtschiffen aller Größen und Fahrtgebiete zu erlauben. Infolge dieser langjährigen Praxis wimmelte es bei der Seefahrt von Sonderzeugnisinhabern, viele ehemalige Bundeswehrfunker, Seeleute aus der Mannschaftsebene, Funkamateure und sogar Ehefrauen von nautischen und technischen Schiffsoffizieren nutzten die Möglichkeit, nach sechs Monaten Lehrgang diesen Job zu ergattern. Wobei die Durchfallquote aber recht hoch war, sechs Monate sind verdammt wenig, um einen brauchbaren Funker zu produzieren.
So, und nun sollte diese Regelung nicht mehr zur Anwendung kommen, man wollte nur noch Funkoffiziere mit dem Seefunkzeugnis 2. Klasse oder dem höherwertigen Zeugnis 1. Klasse akzeptieren. Den Inhabern der Sonderzeugnisse wurde eine Übergangsfrist zum Erwerb der 2. Klasse eingeräumt, und das war es dann.
Für den Erwerb des 2.Klasse-Zeugnisses besaß ich weder die erforderliche Berufsausbildung noch ein gleichwertiges Praktikum. Da stand nun der abgeschmetterte Funkerkandidat und guckte dumm aus der Wäsche.
Die Pläne in Sachen Seefahrt hatten sich in Luft aufgelöst, eine Alternative musste her.
Eine Reifenhandlung in der Heimatregion suchte einen Verkaufsfahrer, zur Überbrückung kam das gerade recht. Diesbezügliche Sachkenntnisse fehlten völlig, mir war lediglich bekannt, dass Reifen rund, aus Gummi und zum Fortkommen eines Autos sehr vorteilhaft sind. Somit war für einige Monate der vermutlich erfolgloseste Verkaufsfahrer Südhessens im Großraum Darmstadt unterwegs. Mehr und mehr drängte sich der Gedanke auf, vielleicht doch die zwei Jahre Praktikum in Kauf zu nehmen, um die Voraussetzungen für den Besuch der Seefahrtschule zu schaffen. Aber zwei Jahre können verdammt lange dauern, besonders, wenn man jung ist. Und dann waren ja auch noch drei Semester Schulbesuch zu absolvieren. Dreieinhalb Jahre also. Und was tun, wenn ich das alles durchzog und hinterher feststellte, dass die Seefahrt doch nicht meine Welt war? Es gab ’ne Menge zu grübeln in jenen Tagen.
Nach längerer Orientierungsphase kam mir dann eine besonders tolle Idee, zumindest hielt ich meine Kopfgeburt für so was. Es müsste doch möglich sein, irgendwie bei einer Reederei so eine Art „Schnupperreise“ zu absolvieren, ein Bordpraktikum oder etwas Ähnliches. Auf dem heimischen Postamt lagen die Telefonbücher der ganzen Republik, nichts wie hin, die Adressen mir bekannter Reedereien müssten ja da drin stehen. Das waren gerade mal drei, Hapag-Lloyd, DDG Hansa und Frigga. Letztere antwortete gar nicht, Hansa lehnte dankend ab und Hapag-Lloyd bot mir in einem kurzen Schreiben eine Anstellung als Aufwäscher an. Keine Ahnung, was ein Aufwäscher zu tun hatte, egal, nun würde es mit der Seefahrt klappen. Ich kontaktierte die in dem Brief aufgeführte Telefonnummer und wurde umgehend nach Bremen einbestellt. Seefahrt, Schlörit kommt, zweiter Anlauf…