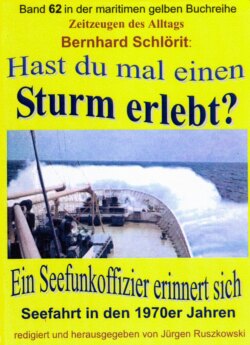Читать книгу Hast du mal einen Sturm erlebt? - Bernhard Schlörit - Страница 6
Der Einstieg… – Ein Aufwäscher geht an Bord
ОглавлениеHapag-Lloyd, damals Deutschlands größte und bei Landratten auch bekannteste Reederei, war erst 1970 durch Fusion der beiden traditionsreichen Unternehmen Norddeutscher Lloyd (Bremen) und Hapag (Hamburg) entstanden. Eigentlich standen beide Firmen immer in heftiger Konkurrenz zueinander, dieser Geist hatte auch die Besatzungen durchdrungen, und je nach Standort wollte man diesen Hamburgern oder Bremern nichts zu tun haben. Es brauchte noch einige Jahre, bis aus beiden Reedereien wirklich eine Company geworden war. 1972 gab es teilweise getrennte Verwaltungsbereiche, und das alte Lloyd-Heuerbüro im Bremer Überseehafen existierte auch noch. Dort stand ich an einem nasskalten Januarmorgen vor einem gewissen Herrn Pauli, der die Lloyddampfer (und damals nur diese) mit Mannschaftsgraden bemannte. Meine Einstellungsprozedur war denkbar kurz, mit einer Art Laufzettel ging es zum Vertrauensarzt der See-Berufsgenossenschaft, der untersuchte den hoffnungsvollen seemännischen Nachwuchs und stellte dann die obligatorische Gesundheitskarte aus, dazu noch den so genannte ‚Seuchenpass’, wenn die Verwendung im Bedienungssektor vorgesehen war. Wieder bei Pauli gelandet, folgte die Frage, ob man gerade polizeilich gesucht würde. Nach meinem Kenntnisstand war das nicht der Fall. Auf meine Frage, was denn bitteschön ein Aufwäscher eigentlich zu tun hatte, lautete die kurze Antwort: „Na, saubermachen halt. Geschirr spülen, Gänge feudeln und so’n Kram.“ Aha!
Dann überreichte mir Pauli mein Seefahrtsbuch, wichtigstes Dokument überhaupt, um Arbeit auf einem Schiff zu finden. Neben persönlichen Daten und einem Passbild enthielt es auf vielen Seiten Raum für Visa und Vermerke sowie die Eintragung aller Borddienstzeiten, die ich jemals leisten würde. Mir schien es in dem Moment das kostbarste Dokument zu sein, das ich besaß.
„So“, meinte Pauli abschließend, „Nun fahren ’se mal wieder nach Hause, wir schicken ein Telegramm, wenn’s dann soweit ist“ Das war es dann.
Nach Hause zurückgekehrt, meldete ich meinem Freundeskreis Vollzug in Sachen beginnender Seefahrtskarriere und lud umgehend zu einer feuchtfröhlichen Abschiedsfeier, schließlich konnte jeden Moment das angekündigte Telegramm eintreffen. Dass in der christlichen Seefahrt die Uhren etwas anders tickten, hatte mir niemand vermittelt. Wir haben dann acht Wochen lang immer wieder mal sehr intensiv Abschied gefeiert, allmählich schmolz meine Barschaft dahin, dafür stiegen die Leberwerte.
Endlich, als ich schon fast nicht mehr daran glaubte, trudelte ein Telegramm ein, kurzer Text: DIENSTANTRITT MIT ALLEN EFFEKTEN 27.03.72 MS BURGENSTEIN HALO BREMEN +. Was bitteschön waren Effekten? Keine Ahnung, was das nun wieder sollte, aber der zum Dienst einberufene Seelord packte seinen Bundeswehr-Seesack, davon ausgehend, dass ein Seesack das allgemein übliche Verpackungsmöbel für Seeleute sei. An Bord stellte sich heraus, dass der frisch gestrickte Aufwäscher der einzige Verwender dieses Traditionsgepäcks war, Hein Seemann reiste 1972 schon mit Koffer und Reisetasche. Und übrigens, mit Effekten war lediglich meine persönliche Ausrüstung gemeint… Aber der Reihe nach.
Am 27. März stand ich wie angeordnet wieder vor dem Heuerstall im Bremer Hafen. Mit mir noch einige andere Gestalten, die aber im Gegensatz zu mir schon verdammt erfahren wirkten. Wir wurden alle in einen Kleinbus verfrachtet und zum Schiff gekarrt, der genaue Liegeplatz ist mir nicht mehr erinnerlich.
Tja, und da lag sie dann. MS „BURGENSTEIN“, ein klassischer Stückgutfrachter, 1958 als Typschiff einer Serie von zunächst drei Schiffen in Dienst gestellt und mit 8.495 BRT vermessen. 147 Meter lang, 20 Meter breit, von einem 9.000 PS-Diesel angetrieben. Platz für 10.900 Tonnen Fracht und neun Passagiere. Nicht gerade ein Riesenschiff, aber mir kam es im Moment gigantisch vor. Schwarz gestrichener Rumpf, weiße Aufbauten, ein gewaltiger Schornstein in Ockergelb mit der schwarzweißroten Hapag-Schornsteinkappe. Und jede Menge Masten, eine andere Bezeichnung für das umfangreiche Ladegeschirr war mir unbekannt. Der Zossen war gerade von einer Mexiko-Reise via Antwerpen und Rotterdam wieder nach Bremen zurückgekehrt und sollte nun zunächst nach dem Löschen der Restladung in Bremerhaven eindocken. Apropos Zossen, an jenem Tage kannte ich diesen Begriff noch gar nicht und sprach hochachtungsvoll nur von einem Schiff. Für den Seemann aber ist jeder ‚Dampfer’ ein ‚Zossen’, ein ‚Schlorren’, ein ‚Zarochel’, ein ‚Wurstwagen’, alles Mögliche, aber kein Schiff.
Nun also die ersten Schritte in diese neue Welt. Mit leichter Verzögerung, wir mussten an der Gangway kurz warten, weil die Wasserschutzpolizei gerade zwei Typen in Handschellen an Land schleppte. Einer davon war mein Aufwäscher-Vorgänger, wir mir später erklärt wurde. Die beiden hatten vor der Ausreise irgendetwas ausgefressen und waren schon beim Einlaufen sehnlich erwartet worden…
An Deck zerstreuten sich die mit mir eingetroffenen Crew-Mitglieder in Windeseile und „der Neue“ stand dumm in der Gegend herum.
Das Schwesterschiff BUCHENSTEIN
Anscheinend war ich der Einzige, der nicht wusste, wo er sich hinzuwenden hatte. Irgendwann erbarmte sich jemand meiner und fragte „ Als was steigst’n du ein?“ – „Aufwäscher“ – „Ach so, also dann, erste Reise oder was?“ – „Jou“ – „Na, dann geh mal hoch zum Chiefmate und gib dein Buch ab, der verklickert dir alles Weitere.“ – „Und wo find’ ich den?“ – „Na, 3. Deck, Steuerbord Vorkante, Kannste nich’ verfehlen!“ Konnte man doch, völlig frei von Ahnung stolperte der Anfänger in den Aufbauten herum und landete dann nach einigem Suchen schließlich doch noch beim 1. Offizier. Keine Ahnung, warum der damals die Bücher einsammelte, normalerweise ist das der Job des Pursers. In späteren Jahren als Funkoffizier war das meine Aufgabe.
Besagter Chiefmate nahm mich kaum wahr, ein Aufwäscher war in der noch sehr traditionellen Hierarchie beim Lloyd am unteren Ende der Skala angesiedelt. Auf der Crewliste waren 48 Mann aufgeführt, der Aufwäscher agierte unter der Nummer 48 und stand damit in den Augen eines 1. Offiziers wohl auf der gleichen Hierarchieebene wie eine Küchenschabe. So, wie der mich anguckte, betrachtet man normalerweise ein Insekt, das unvermutet auf dem Frühstücksbrötchen auftaucht. Mein Auftritt war äußerst kurz, dann schickte mich seine Eminenz zur weiteren „Behandlung“ in Richtung Mannschaftsmesse, was wieder eine längere Such-Expedition in den Aufbauten zur Folge hatte.
Dort wurde mir zum ersten Mal so etwas wie richtige Aufmerksamkeit zuteil. Der für diese Mannschaftsmesse zuständige Messesteward war Uwe, ein pickliger Jüngling von 18 oder 19 Jahren, und er war gewissermaßen mein unmittelbarer Boss. Für ihn war der Aufwäscher, na ja, vornehm ausgedrückt, eine Art Assistent. „Also Bernd, wir machen hier die Backschaft für die Mannschaftsmesse. Auch den Laden sauber halten und so. Und dann machst du jeden Tach die Kammern vom Scheich, vom Timmi, vom Storie und vom Chef!“ „Hää?“
Dann die Übersetzung: vom Bootsmann, vom Schiffszimmermann, vom Storekeeper und vom Koch. Tragen die hier alle Künstlernamen oder was?
Mit Uwe zusammen bewohnte ich auch gemeinsam eine Kammer, eine ziemlich kleine Bude mit zwei übereinander liegenden Kojen, kleine Bank, Stuhl, zwei schmale Schränke, Waschbecken, das war’s.
Klimaanlage gab es nicht, Toilette und Dusche in Indien (jenseits des Ganges).
Auf dem gleichen Gang waren auch die Unterkünfte anderer Mitglieder der „Kolonne Fress und Feudel“. Neben uns wohnten die Kochsmaaten.
An Bord fuhren einige Stewards, Stewardessen und nachgeordnete Bedienungskräfte, dieses Bedienungspersonal rangierte unter dem abfälligen Begriff „Feudelgeschwader“. Der Begriff „Feudel“ kam mir bei der Seefahrt zum ersten Mal unter, bei uns in Hessen nennt man das „Butzlumbe“. Und beim Bund war es ein Aufnehmer…
An der Spitze des Feudelgeschwaders stand der 1. Steward oder Chiefsteward, er bediente auch die Führungsspitze des Dampfers im Salon. In der Offiziersmesse agierten zwei Stewardessen, in der Mannschaftsmesse Uwe und sein ‚Assistent’.
In der Kombüse wirkten drei Mann, ein Koch und zwei Kochsmaaten, der eine davon Bäcker und der andere gelernter Schlachter. Die Verpflegung war für meine Begriffe überraschend üppig, wer das unbedingt wollte, konnte sich hier dumm und dämlich fressen.
Für die Mannschaftsmesse war ich neben Uwe als Backschafter zuständig, Landratten würden es vielleicht „Kellner“ nennen, für die Crew waren wir die „Messbüddels“. Zu bedienen waren sämtliche Mannschaftsdienstgrade des Dampfers, Offiziere und vergleichbare Halbgötter waren meinen Blicken meistens entzogen, die tafelten in der Offiziersmesse und im Salon.
Die Mannschaften also. Da kannte man zwei Fraktionen, Deck und Maschine. Zur Deckscrew zählten der Scheich oder Bootsmann als Herr und Meister über den Decksbetrieb sowie seine Matrosen und Decksleute, überwiegend Deutsche, ein Spanier und drei Türken. Die Jungs unterschieden sich durch die Ausbildung, Matrosen waren gelernte Facharbeiter, die Decksleute ungelernte Hilfskräfte. Einer der Matrosen war für das Kabelgatt zuständig, agierte unter der Bezeichnung „Kabel-Ede“ und war auch so etwas wie der „erste Matrose“ an Deck. Ebenfalls in einer Art Meisterebene, wenn auch nicht so hervorgehoben wie der Bootsmann, arbeitete der „Timmi“, der Schiffszimmermann. Solche Kähne, wie die BURGENSTEIN, führten ziemlich viele Holzkomponenten in den Aufbauten und im Decksbetrieb, so hatte sich dieser Traditionsberuf noch bis in die Siebziger Jahre gehalten. Später fuhr man dann Decksschlosser, Holz an Bord starb aus. Besagter Timmi hatte bei den damaligen Besatzungsstärken noch einen „Juzi“, einen Jungzimmermann als Mitarbeiter. Lang ist’s her.
Neben dieser Decksgang gab es dann noch die „Maschinesen“. Die hatten auch einen Alpha-Wolf im Meisterstatus, „Storie“ alias Storekeeper. Seine Leute waren entweder Motorenwärter oder Motorenhelfer. Erstere, allgemein als „Schmierer“ bezeichnet, hatten teilweise abgeschlossene Berufsausbildungen im Metallbereich, die Helfer, genannt „Reiniger“ waren Ungelernte.
Weiterhin saß in der Crewmesse der „Eisbär“, ein Kühlraummechaniker. Das Schiff verfügte für temperaturempfindliche Ladung über eine begrenzte Kühlraumkapazität, der Eisbär war für das Funktionieren der Kühlung verantwortlich.
Eine Besonderheit auf diesem Frachter war die Ausbildungsgruppe. Zehn Decksjungen inklusive Ausbildungsbootsmann waren eingeschifft, sie absolvierten ihr erstes Lehrjahr für den Matrosenbrief. Junge Kerle, so um die sechzehn, die benahmen sich auch so und fraßen dank häufiger Arbeit in frischer Luft wie die Haie, was uns Messbüddels zu deutlicher Mehrarbeit verhalf.
Und dann saß in unserer Messe noch ein einsamer Chinese herum. Damals gab es ihn noch, den „Max“ bei Hapag, den „Fritz“ beim Lloyd. Traditionell fuhr man Chinesen für den Betrieb der Bordwäscherei, Wäsche fiel ja auf diesen „Style-Dampfern“ mit Passagieren und kopfstarken Besatzungen genügend an. Da die Seeleute nicht im Traum daran dachten, sich chinesische Namen zu merken, wurden die Chinesen mal Fritz, mal Max genannt. Übrigens waren das keine Reederei-Mitarbeiter, die wurden ausgeliehen, ihr Boss war irgendein ominöser „Oberchinese“, der seine Wäscher an die Reedereien vermietete. Dieses tolle Geschäftsmodell wird heute in weiten Teilen von der deutschen Wirtschaft kopiert…
Die Offiziersmesse habe ich während der gesamten Reise nicht betreten. Wie schon gesagt, Hierarchieebene Küchenschabe. Dort nahmen ein zweiter und ein dritter nautischer Offizier, drei Schiffsingenieure in gleicher Zählweise, diverse nautische und technische Offiziersassistenten, ein Elektriker und ein Funker ihre Mahlzeiten ein. Diese Würdenträger wurden aber nie so genannt, ein nautischer Offizier war ein ‚Steuermann’, ein ‚Mate’, ein ‚Stürmann’. Wobei der Steuermann das Schiff nicht steuerte, diese Tätigkeit oblag dem Rudergänger. Und der war schlicht ein Matrose, der nach strikten Anweisungen des Steuermanns, Kapitäns, Lotsen oder wer sonst gerade das Schiff fuhr, den Zossen lenkte. Schiffsingenieure waren ‚Ings’. Der Elektriker hieß ‚Blitz’, der Funker ‚Sparks’, ‚Sparky’, ‚Funkrat’, ‚Purser’, kein Mensch sprach vom Funkoffizier. Nautische Offiziersassistenten hießen ‚NOA’, ‚OA’, oder ‚Oase’. Die technischen vergleichbaren Dienstgrade waren ‚Assis’, Einzahl ‚Assi’. Es dauerte einige Zeit, bis ich keines Dolmetschers mehr bedurfte.
Auf einem anderen Planeten, zumindest aus meiner Perspektive, befand sich der ‚Salon’, dort speisten die drei „Eisheiligen“, also der Kapitän, der erste Offizier oder Chiefmate und der Leitende Ingenieur oder ‚Chief’. Sollten Passagiere mitreisen, und das war in der Regel auch der Fall, wurden auch sie im Salon verpflegt.
Meinen Job hatte ich nach kurzer Einweisung zu verrichten, mehr Ausbildung war auch nicht notwendig, das lief nach dem Motto: „Feudeln und Geschirrspülen kann jeder Depp!“ Ab sofort war ich der Kommandant der Geschirrspülmaschine. Präziser formuliert, ich war die Geschirrspülmaschine, eine solche gab es nämlich an Bord nicht. Trotz meiner verzweifelten Bemühungen wollte der Geschirrberg nicht schrumpfen, irgendwann kam es mir so vor, als ob die Crew ununterbrochen mit Nahrungsaufnahme beschäftigt sei. Morgens in aller Frühe wird umfangreich gefrühstückt, und das hieß nicht nur Brötchen, Butter, Marmelade, auch ein warmes Gericht war Bestandteil der ersten Tagesmahlzeit. Zumindest Eier in allen Varianten, gebacken, gerührt, gekocht, gekrault und weiß der Geier, was noch. Die nannten das „Eier nach Wahl“, bei den Mengen, die da verdrückt wurden, sah es mir eher wie „Eier vom Wal“ aus. Um 10:00 Uhr war „Smoketime“, die ganze Truppe rückte an und schlürfte Kaffee, den der Aufwäscher zu kochen hatte. Mittags volles Lunch-Programm mit drei Gängen, und das hatte gefälligst flott zu gehen, die Gang hatte nicht ewig Mittagspause. Nachmittags „Coffeetime“, wobei die Janmaaten nicht nur den bereitgestellten Kaffee weg pumpten, sondern sich noch zwischendurch ein paar Brote schmierten und in wenigen Minuten die gerade mal frisch gereinigte Messe wieder einsauten. Abends dann kalte Platten mit Wurst und Käse, und auf dass niemand den Hungertod erleide, gab es auch da eine warme Mahlzeit dazu. Mit entsprechendem Spülaufwand, vor 19:00 Uhr kamen wir nicht aus der Pantry. Wenigstens die erste Zeit nicht, gewisse Kniffe und Tricks musste man sich noch aneignen.
Noch in der Nacht nach meinem Einstieg legte die BURGENSTEIN in Bremen wieder ab und verholte nach Bremerhaven. Ich lag bereits in der Koje, als der ganze Kasten anfing zu vibrieren und zu grummeln. Ich sprang in die Hose und hetzte nach draußen, der in der gleichen Kammer nächtigende Uwe tippte sich an die Stirn. Dann stand ich an der Reling und war fast enttäuscht, wie unspektakulär alles ablief. Ein Greenhorn geht auf Reisen…
Am frühen Vormittag des Folgetages wurde das Schiff in der Hapag-Lloyd-Werft in Bremerhaven eingedockt.
MS BURGENSTEIN eingedockt
Man rechnete mit einer Woche Werftliegezeit, danach sollte der Dampfer in der Kanada-Große Seenfahrt eingesetzt werden. Umfangreiche Überholungsarbeiten standen an, für die Messbüddels machte das aber wenig Unterschied zum normalen Betrieb. Wir spülten, deckten auf, deckten ab, putzten Kammern und Gänge, und der Frischling hatte darüber hinaus alle Mühe, sich in dieser neuen und fremden Welt zurechtzufinden.
Möglichkeiten, Mist zu bauen, gab es in Hülle und Fülle, wie ich bald feststellte. Uwe hatte mich nach dem Mittagessen mit der „Fullbrass“ nach achtern geschickt. Das war ein ziemlich großer Kübel voller Speiseabfälle, die dort in eine Müll-Luke entsorgt werden sollten. Normalerweise wurden Abfälle aller Art damals einfach über die Kante gekippt, Umweltschutz war als Begriff noch weitgehend unbekannt. Nur für die Hafenliegezeiten gab es achtern einen Abfallraum, der dann später auf See wieder ausgespült wurde. „Bring den Schiet mal wech, achtern auf’m Poopdeck is ’so ’ne Klappe. Machste auf und feuerste alles da rein.“ So lautete mein Auftrag. Also Abmarsch mit der reichlich schweren Tonne, Niedergänge runter, übers Deck, Niedergang hoch (egal, ob hoch oder runter, an Bord ist jede Treppe ein Niedergang) und da war eine Klappe. Stand sogar schon offen. Ich holte gerade mit Schwung aus, da waren da unten Stimmen zu vernehmen. Kurzer Blick in die Luke, hoppla, da standen der Scheich und der Kabel-Ede fröhlich ins Gespräch vertieft. Das war nicht die Müll-Luke, sondern irgendein anderes Verlies. Wäre eine Superreise geworden, wenn ich den beiden den ganzen Abfall übers Haupt gekippt hätte.
Im Trockendock einen Tag später der nächste Fauxpas. Schiffstoiletten waren auf diesen alten Pötten wohl schon an Fäkalientanks angeschlossen, der Dreck wurde dann aber einfach ins Meer gespült. Aus einem mir damals nicht bekannten Grund war die Benutzung der Toiletten im Dock nicht möglich, man musste über einen Steg rüber an die Dockskante und die dort installierten Toiletten aufsuchen. War jedem sonnenklar, mir aber nicht. An Bord war auch alles abgeschlossen und die Toilettentüren entsprechend beschildert, ausgerechnet auf meinem Gang war es wohl vergessen worden. Ich suchte also jenes Örtchen auf, drückte mir einen beachtlichen Kupferbolzen aus dem Kreuz und betätigte die Spülung. Kurz danach drangen von draußen, von den bereits am Schiff errichteten Stellagen, deutliche Unmutsäußerungen durchs Bulleye herein. Später hörte ich dann in der Messe den Bootsmann sagen: „Die Werfties sind stocksauer, irgendeine blöde Sau hat denen direkt vor die Füße auf die Stellage geschissen, möchte wissen, welcher Dödel da nicht lesen kann…“ Jetzt war Mund halten angesagt. Nichts zugeben, was nicht bewiesen werden kann!
Um aber mitreden zu können, musste ich ganz flott den allgemeinen Sprachgebrauch verinnerlichen. Backbord und Steuerbord waren nicht das Problem, von Luv und Lee hatte ich auch schon gehört, vorn und achtern waren mir ebenfalls klar. Dass eine Back aber sowohl ein Tisch als auch der ganz vorne und höher gelegene Decksabschnitt ist, muss man erst mal wissen. Verballhorntes Englisch war sprachlich stark vertreten, die Leute an Bord waren die „Piepels“. Hier noch einige Beispiele an seemannssprachlichem Allgemeinwissen: Verpasst ein Sailor das Auslaufen des Schiffes, dann ist er „achteraus gesegelt“. Wird er aufgrund dessen gekündigt, bekommt er „einen Sack“. Danach packt er keinen Koffer, sondern seinen „Zampelbüddel“. Werden Überstunden geleistet, spricht der Janmaat vom „Zutörnen“, steigt er mit einer Lady in die Koje, spricht er von „Eintörnen“. Besagte Dame wird auch gerne mal „Schlitzmatrose“ genannt. Der Maschinist trug bei der Arbeit keinen Overall, sondern ein „Kesselpäckchen“.
Sämtliche Arbeitsvorgänge trugen für mich fremde Bezeichnungen, da wurde gefeudelt, gehievt, gefiert, gemalt, gelenzt, gebunkert, gepönt, ich könnte minutenlang weiter aufzählen. Weiß ein Leser vielleicht, was „labsalben“ bedeutet? Ich wusste es damals auch nicht.
Einer der vordersten Räume, vor dem ersten Kollisionsschott des Schiffes, ist die „Vorpiek“. Pinkelt der Seemann, nennt er das „Vorpiek lenzen“. Mir flogen die Insider-Vokabeln nur so um die Ohren, merkwürdigerweise blieben die Ferkeleien besonders gut im Gedächtnis erhalten.
Während der einwöchigen Werftliegezeit ging es reichlich turbulent her. Wie sich nun zu meiner Überraschung herausstellte, war die endgültige Besatzung für die Anschlussreise noch gar nicht an Bord. Wenn die Schiffe von ihren Linienreisen zurück nach Europa kamen, liefen sie ja in der Regel Antwerpen, Rotterdam, Bremen und Hamburg an, auf Ausreise von Hamburg dann wieder Bremen, Rotterdam, Antwerpen. Um der Stammbesatzung einige Urlaubstage zu ermöglichen, bot die Reederei für diese Küstenreise Ablösung durch so genannte Hafenablöser an. Traf der Kahn dann ausgehend wieder in Antwerpen ein, wurde erneut ausgewechselt, und die Jungs von der Stammbesatzung waren dann 10 oder 14 Tage zu Hause gewesen. So befanden sich auch hier jede Menge Urlaubsvertreter bzw. Hafenablöser an Bord, viele davon im Pensionsalter. Außerdem gab es eine gewisse Fluktuation, einige neu eingestiegene Maaten befanden, dass sie auf diesem Zossen doch nicht fahren wollten und stiegen einfach wieder aus. Oder ein Vorgesetzter war der Meinung, dass er mit diesem oder jenen Mann nichts anfangen könne – mangels Eignung oder wegen zuviel Durst – und schickte den Betreffenden wieder nach Hause. Eine neu angemusterte Stewardess war auch ganz schnell wieder weg, und das war Paul Steffens zu verdanken.
Paul Steffens war der Koch, ebenfalls ein Urlaubsvertreter. Paul war beim Norddeutschen Lloyd eine legendäre Erscheinung, stolze 74 Jahre alt und fuhr immer noch gerne als Hafenablöser. Und außerdem war er meines Erachtens die größte Pottsau, die mir bis dahin begegnet war. Nicht im Bezug auf seine Kombüse, da war alles tipptopp. Aber der Gute war völlig übersexualisiert, zentrales Gesprächsthema war der menschliche Fortpflanzungsakt in allen Varianten. Während die Kochsmaaten die Mahlzeiten zubereiteten, widmete sich Paule hingebungsvoll dem Studium dänischer Pornomagazine und kommentierte ausführlich deren Darstellungen. Vermutlich war in seiner Vorpiek schon lange Ruhe eingekehrt, aber im Kopf hatte er es noch. Einmal sah ich ihn in der Kombüse in der Ecke sitzend und ganz versunken mit einer Handarbeit beschäftigt. Bei der nächsten Abholung einer Mahlzeit wurde mir stolz das Ergebnis seiner Bemühungen präsentiert, er hatte in eine große geschälte Pellkartoffel eine Vagina geschnitzt, sehr filigran und authentisch, auch die Schamhaare, dargestellt durch Petersilie, fehlten nicht. Vagina nannte er es übrigens nicht, er drückte sich da etwas herber aus. Paul war ganz stolz auf sein Werk und schleppte die Kartoffelvagina dann tagelang mit sich herum, bis sie unansehnlich wurde.
Eines Abends wurden zu den kalten Platten noch Würstchen mit Kartoffelsalat zubereitet. Die gerade erst neu eingestiegene Salonstewardess brachte die Platten für den Service in die Kombüse, für die drei Eisheiligen wurde sogar auf Silbergeschirr serviert, für die Offiziere feineres Porzellan mit Reedereiwappen, für die Crew dann eine schlichtere Variante. Kaum war das Mädel wieder weg, schnappte sich Paule eine der Platten, wühlte seinen Penis aus der Hose und auf die Platte, klatschte etwas Kartoffelsalat dazu, garnierte das Ganze mit einem Salatblatt und wartete. Die Kochsmaaten, Uwe und ich warteten ebenfalls, das durfte man sich auf keinen Fall entgehen lassen.
Die Stewardess erschien, um ihre Platten abzuholen. Paule steht da, Platte vorm Bauch und kräht fröhlich „hier, mien Deern, dat Würstchen für’n Kaptein!“ Sie wollte gerade zugreifen, als sie die Situation realisierte. Schriller Aufschrei, irgendwas, das wie „alte Sau“ klang, und überstürzter Abgang Stewardess.
Paul verstaute ungerührt seine Genitalien und ließ alle Beweise verschwinden. Minuten später stand der Chiefmate in der Tür. „Paul, was war hier los?“ – „Wie, wat soll denn lous sein?“ Dem Ersten dämmerte ziemlich schnell, dass er mit seinen Ermittlungen an die Wand fahren würde, er trat den Rückzug an. Am folgenden Morgen hatte die Stewardess abgemustert…
Die Werfttage vergingen wie im Flug, so nach und nach trudelten Teile der Stammbesatzung wieder ein, die Letzten würden in Antwerpen wieder zusteigen. Mein Boss, der Chiefsteward, ging auch, an seine Stelle trat eine Chiefstewardess, das gab es auch nicht allzu häufig beim Lloyd.
Inzwischen war ich guten Mutes, mit der Besatzung klar zu kommen. Der Bootsmann war ein sehr agiler drahtiger Bursche mit einem trockenen Humor, Timmi und Storie waren auch gemütliche Vertreter, und die ganze Decks- und Maschinengang hatte kein Problem mit mir als Neuling. Von den noch zu erwartenden Leuten der Stammcrew wurde auch nur Gutes berichtet, von mir aus konnte es losgehen. Aber Aufwäscher werden in der Regel nicht konsultiert, wenn es um die Festlegung des Auslauftages geht.
Natürlich nahm ich auch schon an einigen Landgängen in Bremerhaven teil, noch keine Meile zur See gefahren, aber schon Landgang und auf dicke Hose machen. Meine neuen Kollegen schleppten mich die Rickmersstraße hoch und runter und zeigten mir alles, was ein Neueinsteiger ihrer Ansicht nach zu wissen hatte. Um nicht gleich auf meine Heuer angewiesen zu sein, war ich mit 400 Mark in der Tasche nach Bremen gereist, 1972 war das noch eine brauchbare Summe. Nach der Werftliegezeit war das Geld weitgehend weg, ich hatte fast alles auf den Kopf gehauen, aber auch ’ne Menge Spaß gehabt…
Reichtümer konnte man als Aufwäscher nun wirklich nicht erwarten, die Grundheuer lag so bei 380 Mark. Ausschlaggebend waren wie bei allen anderen Mannschaften auch die Überstunden, und die gab es beim Feudelgeschwader reichlich, man kam in meiner Funktion schon auf ca. 700 oder 800 Märker.
Die Zeit im Trockendock verlief in meinen Augen chaotisch, an allen möglichen Baustellen im Schiff wurde Tag und Nacht gearbeitet, unzählige Piepels liefen an Bord herum, es war mir manchmal nicht ersichtlich, wer zur Crew und wer zur Werft gehörte.
Nach einer Woche waren die Werftarbeiten abgeschlossen und es wurde ernst. MS BURGENSTEIN sollte nun in den Häfen längs der Nordsee Ladung einsammeln und dann über den Nordatlantik in das Zielgebiet Kanada – Große Seen fahren. Die geplanten Anlaufhäfen und die dortigen Agenturadressen wurden uns mit einem Postzettel ausgehändigt, den wir dann umgehend an die Lieben zuhause weiterleiteten. Zu den schon erwähnten Ladehäfen kam noch Grangemouth in Schottland dazu, dann sollte es über den Atlantik gehen. Auf der anderen Seite des großen Teiches würden wir in den St.Lorenz-Strom zunächst nach Montreal und anschließend über den Ontariosee nach Toronto laufen. Weitere Häfen waren nach dem Passieren des Welland-Kanals Cleveland und Toledo am Eriesee, danach sollten noch Detroit sowie Bay City am Huronsee und Chikago am Michigansee bedient werden. Auf der Rückreise wurden die gleichen Häfen wieder angelaufen, um Ladung für Europa zu übernehmen.
Für mich war dieses Fahrtgebiet nicht gerade ein Volltreffer, den Norden der USA kannte ich ja schon ein wenig, meine Vorstellungen gingen mehr so in Richtung Palmen, Rum, braune Damen. Seefahrt ist aber das ziemliche Gegenteil eines Wunschkonzerts, also bitte, dann eben ‚Große Seen’.
Eines schönen Nachmittags dockten wir aus, und ab ging’s nach Hamburg. Zum ersten Mal erlebte ich, wie ein Seeschiff so richtig zum Leben erwacht. Die Bewegungen, das Wummern des Diesels, die allgegenwärtige Vibration, das ununterbrochene rhythmische Klirren in meiner Pantry, Knacken, Knistern und Scheppern ohne Unterlass. Die Nordsee in jenen Apriltagen zeigte sich recht unfreundlich, grauer Himmel, ruppiger Seegang, nasskalt. Prompt stellte sich die Seekrankheit ein, natürlich genau zu Abendessenzeit. Mit kaltem Schweiß auf der Stirn wackelte ich zwischen Kombüse und Messe hin und her und durfte Spiegeleier mit Spinat servieren, alleine der Essensgeruch ließ mich permanent würgen. Der Kabel-Ede schaute mich kurz an und fragte: „Sach ma’, biste in meinen Teller gefallen?“ – „Nö, warum?“ – „Weil du genauso grün bist wie der Spinat!“ Ach so…
Die Seekrankheit machte mir noch einige Tage zu schaffen, man ist ja als Messbüddel auch permanent den Speisegerüchen augesetzt, da schlägt ein empfindlicher Magen erst recht Purzelbäume. Irgendwann stellt sich aber doch ein Gewöhnungseffekt ein, und dann wechselt die Gesichtsfarbe wieder von lindgrün in schweinchenrosa. Gott sei dank, sonst hätte ich die ganze Seefahrt gleich unter „Erledigt“ abheften können. Es lag nicht in meiner Absicht, mich pausenlos rund um den Globus zu kotzen.
Die BURGENSTEIN befuhr nun die so genannte „Rotterdam-Antwerpen-Range“. Arbeitsame Tage für die Decksbesatzung, Einlaufen, Festmachen, Luken öffnen, Bäume stellen, dann das Ganze wieder in umgekehrter Folge, Auslaufen und schon der nächste Hafen. Zu den erwähnten Abfütterungszeiten kamen die Maaten in die Messe geschlurft, feuerten die Arbeitshandschuhe in die Ecke und erwarteten prompten Service. Wehe dem Messbüddel, der dann vor sich hin pennt. Zumal ein Großteil der Typen alles andere als harmlos wirkte, da lagen tätowierte Unterarme auf der Tischplatte, die eher an Kanalrohre erinnerten.
Liegezeiten waren üppig in jenen Tagen, das Schiff lud konventionelles Stückgut mit entsprechendem Zeitaufwand. Einige Container nahmen wir als Decksladung an Bord, diese Transportkisten waren in der Seeschifffahrt noch verhältnismäßig neu, Jahre später würden sie die gesamte Branche revolutioniert haben.
Zum ersten Mal kam ich in Rotterdam wieder an Land, einige Stunden verbrachten wir in einer Kneipe mit Namen ‚Wallenstyn’. Uwe vergatterte mich aber zur Zurückhaltung, die Kneipe war Hansa-Territorium, also die Heimstätte der Seeleute von der Bremer Reederei DDG Hansa. Lloydfahrer waren dort nur geduldet. Hängte man sich da zu weit aus dem Fenster, gab’s was aufs Maul. Originalzitat Uwe.
Mit Landgang war das so eine Sache, möglich war er für uns Messeheinis erst am Abend nach erfolgter Abfütterung aller Raubtiere und anschließender Messe- und Pantryreinigung. An der Gangway hing eine Tafel mit der voraussichtlichen Auslaufzeit, im Übrigen wurde die Rückkehr vom nächsten Dienstbeginn bestimmt. In den ständig angelaufenen Häfen hatten die Jantjes meistens eine ‚Stammkneipe’, die sie häufig als ureigenstes Territorium betrachteten, Devotionalien der eigenen Reederei wie die Kompanie-Flagge oder Aschenbecher in der Schornsteinfarbe der Firma zierten die Theke, Schiffsbilder des Unternehmens die Wände und die Piepels hatte so in jedem Port ein eigenes „Zuhause“.
Das war dann das Basislager aller Unternehmungen, von hier aus wurden dann die Fühler in andere Bereiche ausgestreckt, mal ein Fressladen heimgesucht, die Nuttengasse inspiziert und nicht ganz so häufig auch die Sehenswürdigkeiten der Hafenstädte besichtigt. Am Schluss landeten die Meisten wieder in der „Reederei-Kneipe“. Die Leute auf den Linienfrachtern hatten so ein weltweites Kneipennetz gespannt und fanden überall ihr kompanieeigenes Wohnzimmer vor.
Antwerpen bescherte mir auch ganz neue Erkenntnisse, dort gab es nämlich Damenbesuch der dritten Art. Einige Maaten hatten die Bars in der Umgebung des Liegeplatzes abgeklappert und ein paar etwas abgegriffene Schönheiten zu einem Besuch auf unserem Kahn überredet. Zunächst gab es da Verteilungsprobleme, im Mannschaftsdeck waren überwiegend Zweimann-Kammern, und die Ladys wollten keine Zuschauer oder gar Turnübungen mit mehreren Mackern akzeptieren. Nach einigem Palaver hatten sich die Paare irgendwie verteilt, und es ging zur Sache. Ich kam gerade von einem kurzen Barbesuch zurück und steuerte meine Kammer an, als plötzlich eine wild kreischende nackte Frau mit wehendem Penis an mir vorbeiraste, der Schlachter fluchend achtern ran, wobei er bei jedem Schritt eines ihrer Kleidungsstücke hinter ihr her schleuderte. Irgendwie hatte er sich einen Transvestiten eingefangen und das erst gemerkt, als er die Überraschung ausgepackte. Später hörte ich, dass auch einige andere Janmaaten voll daneben gegriffen hatten, man war halt in der falschen Kneipe gewesen. Antwerpen war wohl in jenen Tagen bekannt für seinen Transsexuellen-Strich, immer wieder mal irrten sich Seeleute bei der Damenwahl und reagierten dann entsprechend angefressen.
Grangemouth hieß der letzte Anlaufhafen an der europäischen Küste. Die schottische Hafenstadt liegt an der Mündung des Flusses Carron am Ufer des Forth und machte auf mich nicht gerade einen einladenden Eindruck, auf einen Landgang habe ich dann verzichtet. Abends spät konnte man auf einmal wieder allerhand Gegacker und Gejauchze auf den Gängen vernehmen, schottische Weiblichkeit gab sich die Ehre. Die Damen waren aber wirklich von erlesener Hässlichkeit und außerdem in erster Linie an alkoholischen Getränken interessiert, trotzdem fanden sich einige Piepels, die sich auf den Deal welkes Fleisch gegen eine Buddel Schluck einließen. Zu meiner Verblüffung gebärdeten sich zwei der zur Ausbildung eingeschifften 16jährigen Decksjungen besonders aktiv, die witterten eine reelle Chance, Erfahrungen zum Dumpingpreis zu sammeln. Eigentlich zählte es zu den Aufgaben des Ausbildungsbootsmannes, seine Schützlinge vor solchen moralischen Entgleisungen zu bewahren. Aber der hatte selbst so eine Schabracke auf seiner Kammer und konnte ja auch nicht überall gleichzeitig sein.
Voll beladen machte sich die BURGENSTEIN nun auf den Weg über den Atlantik, vor uns lagen gute 3.000 Seemeilen bis zum Erreichen des ersten Löschhafens, runde acht Tage sollte die Überfahrt dauern. Ich kann mich nicht erinnern, während der ganzen Atlantiküberquerung, einmal so etwas wie blauen Himmel gesehen zu haben. Graues unfreundliches Wetter, raue kabbelige See.
Inzwischen war ich so leidlich seefest geworden und konnte weitgehend unbeeinträchtigt meinen täglichen Aufgaben nachgehen. Ich putzte, feudelte, reinigte Kammern, schleppte Teller, spülte dieselben, und fing nach Abschluss dieser Arbeiten gleich wieder von vorne an. Dabei hatte ich noch einen der komfortableren Jobs, die Decksmannschaft war bei Wind und Wetter draußen mit irgendwelchen Wartungsarbeiten befasst, die Maschinenleute schufteten in ihrem überhitzten „Fettkeller“ und unsereiner spülte lediglich Geschirr.
Von den seemännischen Tätigkeiten an Bord waren die Messbüddels ja ausgeschlossen, aber die vielen abendlichen Schnack-Runden mit den Matrosen und „Maschinesen“ erschlossen mir auch diese Welt immer ein bisschen mehr. Auf den Schiffen in dieser Zeit gab es nach dem abendlichen Dienstende noch ein reges Gesellschaftsleben, dabei musste man aber gewisse Grundregeln beachten. Die Kammertüren verfügten über einen Haken, eine Art Abstandshalter, um die Türen auf einige Zentimeter Öffnung zu fixieren. Geschlossene Tür bedeutete Draußenbleiben, der oder die Bewohner wünschten nicht gestört zu werden. Tür auf Haken hieß „Besucher willkommen“.
Und auf der BURGENSTEIN waren allabendlich viele Türen ‚auf Haken’ gesperrt, irgendwo fand immer eine Party statt. Natürlich bildeten sich auch Cliquen, die mal in dieser, mal in jener Kammer tagten. Zumal fast jeden zweiten Tag, manchmal auch in Folge, die Uhr eine Stunde zurückgestellt wurde. Wir fuhren ja westwärts und hatten uns immer der jeweiligen Ortszeit anzupassen. Wenn ich also gegen 19:00 Uhr das Geschirrhandtuch an den Haken hängte, konnte ich davon ausgehen, dass es eigentlich erst 18:00 Uhr sei. Partytime.
Maßgebliches Hilfsmittel für diese gesellschaftlichen Aktivitäten war der schier unerschöpfliche Vorrat an Beck’s-Bier, den die Chiefstewardess verwaltete und sukzessive an uns verhökerte. Und so kamen wir eines Abends auf die glorreiche Idee, einen Beck’s-Bier-Club zu gründen. So frei nach dem alten Motto: „Wo mehr als zwei Deutsche zusammenhocken, gründen sie einen Verein.“ Die Sache wurde mit germanischer Gründlichkeit organisiert, unsere Reiniger und Schmierer bastelten aus Kupferblech kleine Anstecknadeln in der Form des auf jedem Flaschenetikett abgebildeten Brauereiwappens, und diese waren dann unter allen Umständen bei Tag und bei Nacht zu tragen. Nichtbeachtung hatte eine Kiste Bier als Strafgebühr zur Folge. Sitzungen des Clubs fanden zweimal wöchentlich in der Messe statt, dazwischen auch Spontankonferenzen auf den Kammern.
Beck’s-Bier-Club
Mitglieder waren innerhalb kurzer Zeit alle unteren Chargen, selbst ein Teil der Unteroffiziere. Einige Offiziere wären wohl gerne beigetreten, das sah man aber höheren Orts gar nicht gerne. Lediglich der Funker pfiff drauf und ließ sich häufiger als Gast blicken, natürlich mit ’ner Beck’s-Kiste als Türöffner bewaffnet.
Besagter Funker war einer der wenigen Sparkys beim Lloyd, die noch mit einem Seefunksonderzeugnis fuhren. Die Reederei legte eigentlich Wert auf Offiziere mit den „richtigen“ Befähigungszeugnissen und nicht auf solche mit verkürzter Ausbildung und Ausnahmegenehmigung. Aber der damalige allgemeine Funkermangel zwang auch den Lloyd zu Zugeständnissen. Dieser Sparks benahm sich auch nicht so abgehoben wie die meisten Streifenträger auf dem Schiff, von mir auf eine Besuchsmöglichkeit der Funkstation angesprochen, hatte er sich ganz selbstverständlich dazu bereit erklärt, dem Aufwäscher mal seinen Laden detailliert vorzustellen.
Anschluss bei den Piepels zu finden war das geringste Problem. Mit einer ziemlich deftigen Kodderschnauze gesegnet, fand ich ziemlich schnell die richtige Wellenlänge im Umgang mit den Janmaaten. Recht bald zählte ich zu einer Clique mit dem Koch, dem Bäcker, einem Reiniger und ab und an dem Kabel-Ede, auch der Eisbär schloss sich uns gelegentlich an. Ein gutes Verhältnis zum Eisbär hatte seine Vorteile. Seine primäre Aufgabe war eigentlich die Wartung und der sichere Betrieb der Kühlräume. Aber er betrachtete sich auch als „Ladungsbeauftragter“ und klaute aus der Fracht alles, was für einen Seemann von Nutzen sein konnte. Wir fuhren ja noch herkömmliches Stückgut in Kasten, Kisten, auf Paletten, in Säcken und dergleichen. Auf dieser Reise hatten wir in Antwerpen unter anderem sehr hochwertige Weine geladen, Eisbär entnahm „Warenproben“, wie er das nannte, und seine Gäste hatten natürlich Anteil an der Beute.
Ladungsdiebstahl war rechtlich gesehen ein glatter Kündigungsgrund, aber man musste ja erst mal erwischt werden. Der Eisbär meinte lakonisch: „Das nennt man Arbeitsteilung. Zunächst mal klauen die Hafenmalocher beim Laden. An Bord bin ich dran. Und beim Löschen mopsen die Docker wieder, was sie kriegen können. Den Rest kriegt der Befrachter, ein bisschen Schwund ist immer, Bruuhahahaha“! Er schüttete sich schier aus vor Lachen über seine eigenen Gedankengänge. Mit der flächendeckenden Einführung von Containern ist das Problem in dieser Form nicht mehr aktuell, die Crew kommt kaum noch an Ladung heran. Dafür verschwinden im Umfeld der Häfen manchmal ganze Container…
Besagter Eisbär war wirklich eine interessante Type, groß, breitschultrig und mit einem veritablen Rauschebart ausgestattet, sah er wirklich aus wie ein Grizzly im Kesselpäckchen.
Er wohnte gewissermaßen auf dem Schiff, zählte schon ein Jahr zur Stammbesatzung und hatte sich perfekt eingerichtet. Die Kammer hatte er mit einer Teakholz imitierenden Tapete ausgekleidet und damit eine gewisse Segelschiff-Atmosphäre geschaffen. Und die Partys auf seiner Bude waren legendär.
Als ich zum ersten Mal im Rahmen einer größeren Schluckspechteversammlung als Gast auf seiner Kammer weilte, fiel mir ein gerahmtes Foto an der Wand auf.
Ein begeistert grinsendes nacktes Weib posierte an einem Kanal, im Hintergrund fuhr ein Lloyd-Dampfer vorbei. Auf Anfrage erzählte er, dass er sich auf jener Reise an Bord dieses Schiffes befand, das Foto wurde vor zwei Jahren im Wellandkanal in der Nähe von Toronto aufgenommen. Ein cleverer Kanadier war auf die Idee verfallen, seine Freundin splitternackt am Kanal zu positionieren und dann mit den verschiedenen Schiffen im Hintergrund zu fotografieren. Später kreuzte er in Toronto an Bord auf und verscherbelte die Bilder für 15 Dollar pro Stück. Tolles Geschäftsmodell, die sabbernden Maaten rissen ihm die Fotos förmlich aus der Hand. Wir würden kurz vor Toronto diesen Kanal passieren, ich war finster entschlossen, ein solches „Schiffsfoto“ zu erwerben, wenn der Typ auftauchte. Der kam aber dann nicht, die Freundin war es wohl leid geworden, nackt am Kanal herum zu hampeln, während hinter ihr ein Dampfer vorbei zog, wohl wissend, dass von der Brücke sämtliche Ferngläser auf ihren Hintern gerichtet waren.
MS BURGENSTEIN schob sich stetig weiter nach Westen vor, das Hämmern des Schiffsdiesels, das Grummeln und Rumpeln des ganzen Schiffskörpers, ein beständiges leichtes Stampfen und Rollen bestimmte unseren Alltag. Ich benötigte einige Zeit, um mich an das fortwährende Vibrieren, an die permanenten Bewegungen und die allgegenwärtigen Gerüche zu gewöhnen. Mein Alltag spielte sich überwiegend in der eng begrenzten Welt zwischen meiner Kammer, der Pantry und der Kombüse ab. Und wie schon gesagt, für die Unteroffiziere agierte ich noch als verantwortlicher „Raumpfleger“, täglich waren ihre Kammern zu reinigen, die Kojen zu bauen und dergleichen mehr. Der Aufwäscher wurde so ziemlich mit den „niedrigsten“ Tätigkeiten betraut, die an Bord eines Frachters zu vergeben waren. Was mir aber herzlich gleichgültig sein konnte, ich betrachtete das als „Durchgangsstation“, hütete mich aber, diesen Umstand lauthals zu betonen.
Als wir uns nach einigen Tagen Neufundland näherten, trieben Growler auf der See, kleine Eisberge in immer dichterer Folge. Die erfahrenen Janmaaten hatten kaum ein Auge dafür übrig, aber für mich war das natürlich sensationell, wie nahezu alles, was sich hier so abspielte. Und dann war auf einmal vor uns ein kilometerbreites flaches Eisfeld.
Fahrt durch das Eisfeld
Der Alte (inzwischen nannte auch der frischgebackene Aufwäscher den Kapitän so, jedenfalls, wenn er nicht in der Nähe war…) hielt aber unverändert Kurs, und wir pflügten in langsamer Fahrt hindurch. Ob das nun ein Risiko darstellte oder nicht, konnte ich in meiner seemännischen Unbedarftheit nicht beurteilen, aber so kam ich zu einigen spektakulären Fotos. Unsere fünf oder sechs Passagiere auch, und es wurde allgemein behauptet, dass der Alte nur aus diesem Grunde durch das Eisfeld gefahren sei.
Endlich erreichten wir nach acht Tagen die Mündung des St. Lorenz-Stromes und sahen…nichts. Pottendicker Nebel hüllte uns und das Festland ein, wir krochen in langsamer Fahrt nach Kanada hinein, ließen Quebec rechts liegen und machten schließlich in Montreal fest.
Meine erste Atlantiküberquerung per Schiff war beendet. Es sollten noch viele folgen…
Große Seen-Fahrt
Montreal
Am Abend des ersten Liegetages stellten wir beiden Messbüddels einen neuen Abwaschrekord auf, wir wollten ja frühst-möglich an Land gehen. Zu viert zogen wir los, die beiden Kochsmaaten, Uwe und meine Wenigkeit. Ich lernte, dass Landgang in fremden Häfen nicht unbedingt eine ganz leichte Angelegenheit ist, besonders wenn alle Beteiligten zum ersten Mal in diesem Hafen lagen. Wo ist es denn für den Seemann interessant? Und wie kommt man dahin? Gute Tippgeber waren gefragt, einige Piepels mit „Große-Seen-Erfahrung“ befanden sich an Bord, aber deren Aussagen waren ziemlich widersprüchlich. Sehenswürdigkeiten kamen weniger in Betracht, wir arbeiteten am Tage, Zeit hatten wir erst am Abend. Daher ist es wenig erstaunlich, dass Landgänge häufig in Kneipen endeten. Taxifahrer waren die ersten Kontaktpersonen in fremden Ports, und die meinten es nicht immer ehrlich mit Hein Seemann. Man nannte den Namen einer Kneipe, die angeblich das Glück auf Erden verhieß, der Laden war in unmittelbarer Nähe des Liegeplatzes, was die Janmaaten aber nicht wussten, und schon kam man in den Genuss einer recht teuren und unergiebigen Stadtrundfahrt. So ähnlich verlief mein erster Landgang in Kanada.
Zwei Tage lagen wir in der Stadt, ein Teil der Ladung wurde gelöscht, darunter bedauerlicherweise das Weindepot unseres Eisbären. Und wieder hieß es „Leinen los“ Richtung Toronto am Nordufer des Ontariosees.
Zunächst aber kamen wir mit dem Erreichen des Sees in das Gebiet der „Thousand Islands“, einem Gewirr von unzähligen Inseln und Inselchen, viele davon mit beeindruckenden Villen bebaut. Hier hatte sich viel Geld angesiedelt, es wimmelt auch von Motoryachten aller Größen. Und merkwürdige Bauten gab es dort, eine Hütte sah aus wie eine Burg vom Rhein.
Wann immer möglich, stahl ich mich aus der Pantry und versuchte, meine Eindrücke mit der Kamera festzuhalten.
Wir erreichten Toronto, damals schon eine Millionenmetropole. Die Liegezeit war etwas üppiger bemessen, Landgang war also dringend geboten.
Skurrilerweise landeten wir, das heißt neben mir der Koch, der Bäcker und Pipifax, der Reiniger, in einem bayerischen Schuppen mit Lederhosen-Combo, Kellnerinnen im Dirndl und viel „Humptata“. Die kanadischen Gäste amüsierten sich wie Bolle, viele davon waren deutscher Herkunft und hatten (so wie es auch viele Deutschamerikaner tun) mittlerweile völlig verdrängt, dass nicht ganz Deutschland aus Bier saufenden Lederhosenträgern besteht.
Pipifax, der Reiniger
Da saßen dann emigrierte Niedersachsen oder Saarländer mit einem Gamsbarthut aus Pappmachee auf der Gurke und grölten „Oans, zwoa Gsuffa“. In unseren Augen war das reichlich grotesk, was da ablief. Besonders meine drei Kumpane sahen das so, die stammten alle von der Küste, und die weißblaue Partykultur war denen völlig suspekt. Lediglich die Maßkrüge fanden ihren Beifall. „Endlich mal ’n richtiges Maul voll Bier!“, meinte Pipifax.
Irgendwann verließen wir diesen Tumult und streunten ein wenig in der Gegend herum, wir fanden noch einige nette Bars, kamen auch mit ein paar recht ansehnlichen Kanadierinnen ins Gespräch, die aber mit Seeleuten nichts am Hut hatten. Zumal gerade während einer solchen Kontaktaufnahme unser Motormann Pipifax sturzbesoffen vom Barhocker fiel, das war nicht so werbewirksam. Aber alles in allem war es ein unterhaltsamer Abend.
Sightseeing und Beck`s Bier, die dienstfreien Piepels geniessen die Kanalfahrt
Am übernächsten Tag ging es dann weiter, auf uns wartete der Wellandkanal, der es den Schiffen erspart, die Niagarafälle herunterzufallen. Das war jedenfalls die Begründung, die Kabel-Ede für den Bau dieses Kanals lieferte. Erst dieser Wasserweg erschließt die weiter westwärts gelegenen Great Lakes für die Seeschifffahrt. Über eine Strecke von ca. 40 Kilometern überwindet er mit 8 Schleusen knappe 100 Meter Höhenunterschied. Für die Deckscrew und die Schiffsleitung bedeutete die Kanalpassage eine Schweinearbeit, Matrosen mussten in jeder Schleusenkammer mit dem Ladebaum an Land gehievt werden, um fest und wieder los zu machen. Wir passierten den Kanal an einem Sonntag, an den Schleusen befanden sich Tribünen wie auf einem Sportplatz, auf denen sich ganze kanadische Großfamilien eingefunden hatten. Schiffe gucken hatte hier wohl einen hohen Nennwert im allgemeinen Unterhaltungsangebot. Wir haben später noch ausgiebig diskutiert, wer bei der Besichtigung die Zoobesucher und wer die Affen waren.
Cleveland in Ohio war unser nächstes Ziel. Da dies der erste US-Hafen dieser Reise war, erlebte ich zum ersten Mal die überaus umständliche Einklarierungsprozedur der amerikanischen Behörden. Von der Einklarierung, also der grenzpolizeilichen und zollmäßigen Abfertigung eines Schiffes, hatte ich bis dahin nichts mitbekommen, das spielte sich im Salon zwischen den Behörden und dem Kapitän beziehungsweise dem Purser ab. Die Amis aber ließen die komplette Besatzung antreten und überprüften mit strenger Miene jedes Seefahrtsbuch samt zugehörigem Sailor. „Gesichtsparade“ nannten die Piepels das.
Der ganze Auflauf zog sich mächtig in die Länge, immer wieder blätterte ein Immigration-Officer in seinem dicken Wälzer, der wohl alle in den USA unerwünschten Personen auflistete. Eisbär unterhielt mich während der Wartezeit mit Döntjes aus früheren Jahren, als man sich sogar von jedem Seemann anlässlich der Einklarierung das Geschlechtsorgan vorzeigen ließ, um tripperkranke Maaten herauszupicken. Erst als die Franzosen dann einmal ein Passagierschiff mit jeder Menge Amigäste an Bord in gleicher Weise kontrollierten, wurde dieses entwürdigende Verfahren stillschweigend abgeschafft. Ich stellte mir diese Prozedur reichlich grotesk vor, da sitzt so ein wichtiger Gesundheitsbeamter im Salon, und der Reihe nach wedeln ihm die Sailors mit dem Schniedel vor der Nase herum.
Nach zwei Stunden war auch diese Gesichtsparade überstanden, wir durften Cleveland betreten. Genau in dieser Stadt war ich ein Jahr zuvor gewesen und diente mich meiner Clique als Guide an, weil ich da noch einen riesigen Tanzschuppen mit sehr kopfstarkem Frauenangebot in Erinnerung hatte. Blöderweise war mir der Namen des Etablissements entfallen, nach einiger Zeit resignierten wir und suchten zunächst mal ein Steakhaus auf, Amisteaks waren laut Aussage der Kollegen Kult bei jeder USA-Reise. Einer unserer Schmierer war zwar des Englischen kaum mächtig, aber finster entschlossen, sein Steak so zu ordern, wie er es aus zahlreichen Western-Storys kannte. „Hör ma’“, lautete seine Ansage an die Waitress „you bring me mal ein Zwölf-Unzen-Steak, not bloody und mit Pilze!“ Große Ratlosigkeit beim Bedienungspersonal. „I mean Steak with Pilze…Pepperlings and Champions, you know?” Ich griff dann unterstützend ein, und letztlich vertilgte er wie wir alle ein ausgezeichnetes T-Bone-Steak, und zwar ganz ohne Pepperlings und Champions.
Krönender Abschluss war ein Barbesuch in einem Schuppen mit recht hohem Damenanteil, irgendwie schienen da ’ne Menge ‚grüner Witwen’ auf Männersuche gewesen zu sein. Unsere Gruppe zerstreute sich zusehends, jeder war mit sich und sonst wem beschäftigt.
Als Germans waren wir da die exotische Attraktion des Abends.
Von Hafen zu Hafen arbeitete unser Dampfer den Fahrplan ab, nächste Station war Toledo.
Dort waren wir aber nur einen Tag, das Hafenviertel wirkte nicht so attraktiv, und ich blieb an Bord. Ähnlich sah es in Detroit aus, aber wir schwärmten wenigstens ein paar Abende aus, um die nähere Umgebung zu erkunden. Der Port war von Industriehallen, Lagergebäuden und heruntergekommenen Häusern umgeben, überwiegend Afroamerikaner lungerten an den Ecken herum, und alles machte damals schon einen heruntergewirtschafteten Eindruck. Scheinbar keine Kneipe weit und breit. War aber nicht so, nach den ersten drei Runden um den Block hatten die Jantjes schon eine zwar reichlich verkommene, aber immerhin geöffnete Kaschemme gefunden. Überhaupt habe ich damals schon und auch in den kommenden Jahren die unglaubliche Findigkeit der Seeleute bewundert. Wenn es um das Aufspüren von Kneipen und dem Sailor wohl gesonnene Damen ging, zeigten sich die Janmaaten als reinste Trüffelschweine. Ich bin heute noch überzeugt, dass der durchschnittliche Fahrensmann maximal eine Stunde benötigen würde, um in Mekka eine Bierbar und in Vatikanstadt einen Puff zu finden.
Besonders attraktive Ziele gab es in der unmittelbaren Nähe der Liegeplätze nie, die Hafengegend in diesen US-Ports wirkte in allen Fällen reichlich heruntergekommen. Das trifft aber gemäß meinen späteren Erfahrungen auf viele Häfen dieser Welt zu, verlässt der Seemann seinen Frachter, lernt er sein Gastland zunächst mal „von unten“ kennen. Bars in Hafennähe waren in Ami-Land alle gleich. Meistens dunkle Läden, Licht fiel nur auf den Billardtisch, sofern vorhanden. In einigen Schuppen wurde Tabledance geboten, irgendein weibliches Wesen hampelte fast nackt auf einer Tresen-Bühne umher, da waren nur Schambereich und Brüste mit irgendwelchen Plastikaufklebern notdürftig abgedeckt, das Gesetz wollte es so. Um den Tresen hockten schweigend ein paar abgerissene Amis vor ihrem Flaschenbier, die Basecap nach achtern gezogen, und verfolgten stumm diese Darbietungen. Und ab und an steckte dann einer der Gäste eine Dollarnote in den kaum vorhandenen Slip der Künstlerin, die warf dem edlen Spender dann Blicke zu, die sie wohl für erotisch hielt, und weiter ging die „Show“. Gab es dort Prostitution, wirkte sie eher abschreckend als anziehend.
Vieles in diesen heruntergekommenen Läden entsprach nicht dem, was man aus der deutschen Kneipenszene gewohnt war. Bier wurde grundsätzlich mit dem Adjektiv „icecold“ beworben. Klar, die Brühe schmeckte so übel, dass sie nur nahe am Gefrierpunkt genießbar wurde. Bier vom Fass, also „Draft Beer“, wurde teilweise mit Schläuchen direkt in die vor den Gästen stehenden Gläser gepumpt, Tankstellenbetrieb gewissermaßen. Und die Toiletten waren sensationell, man hockte in dem meist völlig versifften Toilettenraum vor begeistertem Publikum auf einem offenen Thron, Türen an den Kabinen fehlten in der Regel. Ein Umstand, der bei den Sailors immer wieder für große Heiterkeit sorgte. Das ging soweit, dass sich Pipifax und der Bäcker beim Scheißen gegenseitig fotografierten, um dann mit den Bildern den Daheimgebliebenen den ‚American Way of Life’ mal näher zu erläutern.
Natürlich existierten in den amerikanischen Städten auch Lokale mit weitaus besserem Niveau, dazu musste man aber schon ein wenig weiter in die City vordringen.
Letzte Häfen auf der Ausreise waren Bay City und Chicago. Unser Liegeplatz in Bay City befand sich in unmittelbarer Nähe eines Sportgeländes, vor uns hatte ein dänischer Dampfer festgemacht. Kaum waren wir fest, erschien eine Delegation der Wikinger-Crew und forderte uns zu einem Fußballmatch heraus. Das gab es häufiger, es wurden sogar von einigen Besatzungen Pokale ausgespielt, und es existierte eine Ranking-Tabelle mit den erfolgreicheren Besatzungen. Dazu zählte unsere Gang nicht, aber einige fußballbegeisterte Piepels nahmen die Herausforderung an und organisierten eine Mannschaft. Ich war noch nie fußballinteressiert gewesen, wurde aber als Mitglied des medizinischen Betreuungsteams eingeteilt. Das heißt, mit den anderen „Betreuern“ schleppte ich etliche Kisten Bier zum Veranstaltungsort. Da die Dänen sich leicht verspäteten, wurde sogleich schon mal ein bisschen medizinisch behandelt, besonders heftig von unserem Star-Reiniger Pipifax. (Wir kannten ihn alle nur unter diesem Spitznamen, ich glaube, nur der Purser wusste, wie er wirklich hieß). Kurz nach dem Anpfiff schoss Pipifax zunächst mal ein Eigentor. Nachdem wir ihm noch einmal die eigentliche Stoßrichtung seines Teams erläutert hatten, rannte er noch eine Zeitlang sehr engagiert, aber weitgehend nutzlos mit und zog sich dann doch vor dem Ende der ersten Halbzeit zur weiteren medizinischen Behandlung an den Spielfeldrand zurück. Auch der Rest unserer glorreichen Truppe brachte nicht viel mehr Leistung, die Dänen hauten uns zweistellig in die Pfanne.
Chikago war Endhafen unserer Reise, die Liegezeit dauerte drei Tage.
Wir zogen abends ein paar Mal an Land, die üblichen Lokalitäten aufsuchend. Schon möglich, dass die Offiziere da in besseren Kreisen verkehrten, in den von uns frequentierten Spelunken habe ich in Amiland jedenfalls keinen Streifenträger gesehen. Wir streunten an den Abenden doch überwiegend in schiffsnahen Bereichen umher. Selbst der Besuch bei einem Friseur geriet da unversehens zur Klamotte. In den USA existierten noch zahllose „Barbershops“, in denen ausschließlich Männer bedient wurden, diese Läden erkennt man schon von weitem an einem neben der Tür angebrachten Glaszylinder mit einer sich drehenden farbigen Säule. Mit vier Mann fielen wir dort ein, dem schwarzen „Barber“ wurde leicht mulmig ob dieser Klientel.
Kurze Ansage vom Koch: „Make me ’an Haircut, but not so fucking short!“ Feinstes Seemannsenglisch. Da der Schwarze mit seinem Slang nur schwer zu verstehen war, beantwortet Cookie jede Frage mit „Yes” – mit dem Ergebnis, dass er schlussendlich fast keine Haare mehr auf dem Kopf hatte und dank eines üppig eingesetzten süßlichen Rasierwassers für den Rest des Tages stank wie eine Nutte bei Dienstbeginn. Wir anderen drei Maaten verzichteten dann kurzfristig auf die Dienste dieses Figaros.
Wie diese Hafenviertel beschaffen waren, zeigte sich auch, als wir bei einem Fußmarsch in der Hafengegend von der Besatzung eines Streifenwagens gestoppt wurden. Nach eingehender Kontrolle unserer Landgangsausweise forderte uns ein sichtlich ungehaltener Cop auf, unseren Hintern schleunigst in ein Taxi zu verfrachten, er habe keine Lust, unsere abgestochenen Kadaver irgendwann hier in seinem Bezirk aufzusammeln. Er organisierte anschließend über Funk auch ein „Cab“ und blieb bei uns stehen, bis wir abtransportiert wurden, ‚full service’ gewissermaßen. Wir hatten gar nicht realisiert, in was für einer gefährlichen Ecke wir herumstrolchten.
In Chicago hatten wir dann auch das Glück, einen Hafensonntag zu genießen. Ein Großteil der Besatzung hatte einen arbeitsfreien Tag, und auch ich bekam eine der seltenen Gelegenheiten, einmal Landgang zu erleben, bevor die Säufersonne aufging. Mit ein paar Maaten landete ich auf einem Open-Air-Konzert einiger hier sehr populärer Rock-Bands. In meinem ganzen Leben habe ich noch nicht so viele bekiffte Gestalten gesehen, die Masse der Besucher lag total bedröhnt in der Gegend herum. Mit diesem Zeug hatte ich noch nie was am Hut gehabt, aber einer der Kochsmaaten hatte da wohl ein bisschen Kraut von den Amis abgestaubt und verschwand dann auch in einem anderen Universum. Den Heimweg zum Dampfer legte er nahezu frei schwebend zurück.
Von nun an befanden wir uns auf Heimreise. Das Schiff begann nun damit, in den gleichen Häfen wieder Ladung einzusammeln, lediglich Quebec sollte noch zusätzlich in den Fahrplan aufgenommen werden. Natürlich marschierten wir auch „homeward bound“ immer wieder mal an Land und zogen um die Häuser. Da sich diese Aktivitäten aber grundsätzlich erst spätabends nach Dienstende entfalteten, endete alles sehr schnell in den einschlägigen Bars. Höhepunkt war dabei noch einmal eine zweitägige Liegezeit in Toronto, die Schiffsleitung organisierte über die Agentur einen Ausflug zu den Niagarafällen. Solche Ausflüge wurden in jenen Jahren immer wieder mal angeboten, sowohl die Liegezeiten als auch die Besatzungsstärken schufen beste Vorrausetzungen dafür. Für viele Maaten war es oft die einzige Gelegenheit, mal über die Hafenmeile hinauszukommen und mehr vom Land zu sehen als die lokalen Kneipen und Pinten. Nicht, dass Hein Seemann überhaupt keine Chance dazu gehabt hätte, aber oft war er zu phlegmatisch, um sich auf eigene Faust den Mühen einer weitergehenden Exkursion zu unterziehen. Außerdem mussten erst mal gewisse Primärbedürfnisse befriedigt werden, dann blieb vielleicht noch Zeit für das Kulturprogramm…
Der Trip zu den Fällen war ganz nett, aber auch dort hatte ich mich ein Jahr zuvor als Tourist schon einmal aufgehalten. Trotzdem genoss ich auch dieses Mal wieder die spektakulären Ausblicke, es ist schon ein tolles Naturschauspiel.
Ausflug zu den Niagarafällen
Im Übrigen ist die Stadt Niagara Falls eine hundertprozentige Touristenstadt und darüber hinaus als eines der nordamerikanischen Hauptziele für Flitterwöchner bekannt, Honey Moon in Niagara Falls hat einen hohen Stellenwert. Unser Koch fand auch gleich die passende Begründung dafür: „Wenn de gleich nach der Hochzeit schnallst, dass die Olle nix taugt, schmeißt ’se in die Wasserfälle und gut is’!“ Auch ’ne Logik.
In den nächsten Tagen fühlte ich mich wie ein Zuschauer in einem rückwärts laufenden Film, wieder ging es durch die tausend Inseln, den St. Lorenz hoch, Montreal und Quebec boten letzte Gelegenheiten, noch mal einen Fuß an Land zu setzen, dann lag der Atlantik wieder vor uns. In Montreal wurde mir auf meinen Wunsch mal ein freier Tag gewährt, und ich machte mich alleine auf die Socken, um mir die Stadt näher anzuschauen. In dieser Metropole, übrigens der größten in der Provinz Quebec, wurde überwiegend französisch gesprochen, nicht unbedingt meine Stärke, aber man konnte zurechtkommen. Längere Zeit hielt ich mich auf dem Gelände der Weltausstellung auf, die 1967 dort stattgefunden hatte. Bei der Gelegenheit lernte ich eine junge Kanadierin kennen, die mir dann für einige Stunden als Tour Guide Gesellschaft leistete, schlussendlich verabredeten wir uns für die nächste Reise, wenn das Schiff in fünf oder sechs Wochen wieder zurück sein sollte. Auch so etwas gab es gelegentlich…
In Quebec blieb mir Landgang versagt, schade, diese Provinzhauptstadt mit ihrem berühmten Altstadtkern hätte ich mir gerne einmal näher angeschaut. Aber die kurze Liegezeit ließ keine weiteren Aktivitäten zu.
Am Abend verließ die BURGENSTEIN diesen letzten Hafen vor der Atlantiküberquerung, vor uns lagen wieder mal etliche tausend Seemeilen. Im Gegensatz zur Anreise war das Wetter dieses Mal ausgezeichnet, bei strahlendem Sonnenschein ging es über den St. Lorenz in Richtung offenes Meer. Landgänge wurden nun wieder durch vermehrte gesellschaftliche Aktivitäten an Bord ersetzt, der Beck’s-Bier Club tagte in dichter Folge. Auch der Eisbär gab sich in seiner Kammer wieder häufiger die Ehre und ließ uns an dem Ergebnis seiner jüngsten Laderaumkontrollen teilhaben, in Montreal hatten wir nämlich etliche Paletten „Seagrams Golden Crown“ geladen, einen kanadischen Whisky der Premium-Kategorie. Natürlich hatte man versucht, diese Paletten durch geschicktes Stauen einigermaßen gegen Diebstahl zu sichern, aber unser Eisbär hätte sich vermutlich auch dann zum Whisky durchgegraben, wenn er hinter Stahlschotten eingeschweißt worden wäre. Um bei einer eventuellen Kammerkontrolle nicht aufzufallen, hatte er den Stoff in Plastikkanister umgefüllt, während der ganzen Überfahrt stand immer ein guter Tropfen zur Verfügung. Natürlich durften wir es nicht übertreiben, exzessiver Verbrauch dieser Ladungsbestandteile wäre wohl zuerst der 1. Stewardess aufgefallen, bei ihr wäre nämlich der Kantinenumsatz dramatisch eingebrochen.
Jeden Abend um eine bestimme Zeit öffnete sie ihren Zoll-Laden und verkaufte den Piepels, was so benötigt wurde. Neben Bier, im geringeren Maße Spirituosen (die brauchte kaum jemand, die wurden ja geklaut) und Zigaretten waren das auch Toilettenartikel und allerlei Kleinkram des täglichen Bedarfs. Wir zahlten bei ihr nicht in Cash, sondern per Unterschrift auf einem Ticket. Diese Einkäufe fanden sich dann später auf der Heuerabrechnung wieder und sorgten bei manchem Maaten für üble Überraschungen, man kauft halt viel unbekümmerter ein, wenn man nur eine Unterschrift zu leisten hatte und keine harte Kohle rüber schieben musste.
Mich selbst nutzte die Dame als Lastesel, die Eisheiligen und einige andere Offiziere ließen sich ihre Waren auf die Kammern liefern. Dieser unbeliebte Auftrag wurde in der gesamten Hierarchiekette des Feudelgeschwaders nach unten durchgereicht, und ganz unten befand sich meine Wenigkeit. Die Bierlast und die Zollstores waren tief im Bauch des Schiffes, die Streifen tragenden Abnehmer der Ware residierten ziemlich weit oben. Schon mal mit zwei Kartons Beck’s auf dem Ast vier oder fünf Decks hoch gekraxelt? Da kommt Freude auf, wenn der Kahn vorne hochsteigt, wird der Niedergang immer steiler, man kippt fast hintenüber. Dann rauscht der Schlorren in ein Wellental, die Treppe wird gefühlt flacher und man rennt die Stufen mit der Bierladung hoch wie ein vergifteter Affe. Bei solchen Gelegenheiten hatte ich anfangs einiges an Bruch produziert, weil ich den akrobatischen Anforderungen nicht immer gewachsen war.
Die Rückreise war also auch mit regem Partyleben erfüllt, aber doch in geringerem Maße als bei der Ausreise. Wieder wurden in steter Folge die Uhren verstellt, dieses Mal aber voraus. Das heißt, uns fehlte allabendlich eine Stunde. Je näher wir dem alten Kontinent rückten, umso ruhiger wurde es im Schiff.
Bei sommerlichem Wetter erreichten wir wieder nach acht Tagen Antwerpen, es begann wieder die Europa-Küstenreise. Nur wenige Besatzungsmitglieder hatten um Hafenablöser ersucht, es gab kaum Abmusterungen, und die Gang blieb weitestgehend zusammen. Ich hatte mich schon vor einiger Zeit entschlossen, auch noch eine Reise mitzufahren, meine ursprünglichen Absichten, nur mal einen Schnuppertrip zu wagen und dann ins Elektronik-Praktikum zu gehen, hatte ich etwas aus den Augen verloren. Ich amüsierte mich hier einfach zu gut…
Inzwischen hatte ich auch mehr über die einzelnen Tätigkeitsfelder an Bord in Erfahrung gebracht. Durch die vielen Gespräche mit den Piepels bekam ich allmählich eine Ahnung davon, wer an Bord für was verantwortlich war. Fragt man eine Landratte nach seemännischen Berufsbildern, fallen ihr in aller Regel Matrosen und Kapitäne ein, Ende der Fahnenstange. Vielleicht noch die nette Bezeichnung „Smutje“ für den Koch, aber die ist in der Handelsschifffahrt verpönt. Die Sache war aber weitaus komplexer, zahlreiche Besatzungsmitglieder besaßen seefahrtspezifische Berufsabschlüsse, unterstützt wurden sie aber auch, wie schon erläutert, von etlichen ungelernten Hilfskräften. Über allem thronte natürlich der Kapitän, der hatte sich nach seinem Aufstieg durch sämtliche Offiziersränge zum Stellvertreter des Reeders qualifiziert (Böse Zungen sagen „manchmal auch nicht!“) und war nun Herrscher „über das Ganze“. Wohl nicht mehr Master next God, da legten ihm die Gesetze mittlerweile auch Beschränkungen auf, aber doch noch mit enormer Machtfülle ausgestattet. Wachdienst ging er nicht, in der Regel führten die Kapitäne das Schiff vom Schreibtisch aus, bei kniffligen nautischen Situationen war ihre Anwesenheit auf der Brücke aber unerlässlich. Gesehen habe ich die Kapitäne während meiner Aufwäscherfahrzeit höchst selten, das „Wir da unten“ und das „Ihr da oben“ war sehr ausgeprägt. Für die Maschine war auf diesen alten Linienfrachtern auch der Chief so eine Art Gottkönig, ebenfalls mehr am Schreibtisch, weniger in seinem Fettkeller anzutreffen. Zum „Deck“ zählten auch alle nautischen Offiziere, die auf See sich gegenseitig ablösend das Schiff fuhren. Traditionell ging der Erste die so genannte Vier-acht-Wache, der Dritte die Acht-zwölf-Wache und der Zweite die Zwölf-vier-Wache, jeder der Nautiker war also täglich zwei mal vier Stunden auf der Brücke. Dazu kamen diverse Nebenaufgaben, der Erste war für die Ladung zuständig, der Zweite für den Sanitätsdienst, der Dritte für Seekarten und nautische Unterlagen und so weiter. Zur „Maschine“ zählten naturgemäß alle vier Schiffsingenieure, die unterschiedliche Patente besaßen. Dann die Ingenieur-Assistenten, die Assis. Auf Schiffen wie der BURGENSTEIN gab es noch keinen wachfreien Maschinenbetrieb, ein Ing und ein Assi bildeten eine Wache und schoben im schon erwähnten 4-8-Rhythmus Dienst an der Antriebsanlage. Die Mannschaftsgrade arbeiteten in der Wartung und wurden auch mit ständigen Reinigungsarbeiten beschäftigt, der Bedarf dafür war im Decks- wie auch Maschinenbetrieb recht hoch.
Aus früherer Zeit wird überliefert, dass sich die beiden Fraktionen auf den alten Dampfschiffen spinnefeind waren, für Matrosen soll es sogar lebensgefährlich gewesen sein, im Quartier der Heizer aufzutauchen, umgekehrt galt das auch.
In der von mir geschilderten Epoche war der traditionelle „Krieg“ zwischen Deck und Maschine schon nicht mehr aktuell, aber ein gewisser Konflikt beherrscht bis in die Gegenwart das Denken der Seeleute. Schiffsingenieure leiden bis zum heutigen Tag darunter, dass ihnen die höchste Würde, die Stellung des Kapitäns, verwehrt bleibt, diese Position ist nun einmal den Nautikern vorbehalten, den von den Ings gerne so genannten „Fensterguckern“. Nautiker sind sich durchaus bewusst, dass ohne die Techniker da unten im Maschinenraum absolut nichts mehr ginge, sprechen dessen ungeachtet aber gerne von „Keller-Asseln“. Es gab in den letzten Jahren Anstrengungen, den nautischen und den technischen Offizier zugunsten eines für beide Bereiche ausgebildeten „Multifunktions-Offiziers“ zu ersetzen, eine Eier legende Wollmilchsau könnte man es auch nennen.
Das scheint aber bisher nicht so recht zu funktionieren, also existieren beide Bereiche weiterhin nebeneinander mit den altbekannten Rivalitäten.
Küche und Bedienung bildeten einen eigenen Bereich, zu dieser Zeit war der Sektor noch sehr stark besetzt, drei Mann in der Kombüse und etwa sechs Leute im Service sind heute auf einem Frachter undenkbar.
Spezielle Positionen bekleideten der Schiffselektriker nebst Assistent sowie der Funkoffizier. Der ‚Blitz’ stand zwar der Maschine näher als der Deckstruppe, wurde aber in beiden Bereichen benötigt und auch eingesetzt, Generatoren, elektrische Windenantriebe, die allgemeine Installationselektrik an Bord und später die wachsende Elektronik forderten einen in allen Bereichen kompetenten Allround-Elektriker. Der Funker unterstand ausschließlich dem Kapitän, er saß da oben in seiner Funkbude in einer Art Sonderrolle und wurde, da er nie schweißtriefend in der Nähe hohen Arbeitsanfalls gesichtet wurde, von Decksbauern und Maschinesen zwar respektiert, aber häufig auch als fauler Sack betrachtet. Das ist nun einmal das Los von Spezialisten, die sich mit für Laien schwer begreiflichen Künsten beschäftigen. Dazu zählte auch die Morserei.
Auch die nächste Reise führte wieder in die Großen Seen, das Schiff sollte die ganze Sommersaison in diesem Fahrtgebiet verbleiben. Im Winter wurde die Große-Seen-Fahrt eingestellt, die Eisverhältnisse ließen kein Befahren mehr zu. Natürlich gab es auch bei diesem Trip sowohl an Bord als auch an Land diverse schräge Erlebnisse, aber der Reiz des Neuen begann schon etwas zu verblassen. Die Maaten, die schon die Mexiko-Reise des Schiffes im Winter mitgemacht hatten, waren allerdings der Meinung, ich wäre auf dem falschen Dampfer, bei diesem Fahrtgebiet sei nicht viel zu holen. Nächtelang hörte ich mir bei diversen Kammerpartys wilde Storys aus der Karibik und sonstigen Sunshine-Fahrtgebieten an, so kam es wohl zu dem Entschluss, meine weitere Ausbildung hinten anzustellen und unbedingt nach der BURGENSTEIN noch einen weiteren Dampfer als Aufwäscher zu beglücken.
Wenn die Mexikofahrer zum Umtrunk einluden, dudelte ununterbrochen aus ihren Kassettenrekordern der Song „Una lagrima por tu amor“, diese Schnulze, gesungen von einer Estela Nunez, dröhnte wohl zu dieser Zeit in Zentralamerika aus jeder Juke-Box. Der Koch meinte einmal: „Man musste aufpassen, dass man nicht aus der Kneipe geschwemmt wurde, die Nutten heulten alle Rotz und Wasser, wenn die Scheibe lief!“ Den Song habe ich auch heute noch im Ohr, bei meinem ersten Trip nach Lateinamerika war er immer noch einer der meistgespielten Gassenhauer.
In Bremen wurden auf Ausreise noch einige Besatzungsmitglieder ausgetauscht, dort kam auch Karl an Bord. Ich stand gerade in der Nähe der Gangway, als die „Neuen“ ankamen, ein etwas vierschrötiger Typ in einem Samtanzug trat an Deck, schüttelte die erstbeste Hand und verkündete „Hallo, ich bin Marlies!“. Bitte was? Es stellte sich heraus, dass der „Kerl“ als Stewardess anmusterte, Marlies war stocklesbisch, kleidete und verhielt sich männlich herb, infolge dessen lief sie künftig unter dem Spitznamen „Karl“. Sie wurde aber bei der Crew vom ersten Tag an akzeptiert und stellte sich im Laufe der Reise als echter Kumpel heraus.
Selbstverständlich fand sie/er auch umgehend Aufnahme im Beck’s-Bierclub und soff, wenn gewünscht, wie ein Loch.
Herausragend in meiner Erinnerung an diese zweite Reise ist die Affenhitze, die dann im Juni/Juli in den großen Seen herrschte. Das kontinentale Klima sorgte für einen wahren Glutsommer, Klimaanlagen waren auf der BURGENSTEIN unbekannt. In den Kammern kühlte es auch nachts nicht ab, der kleine Ventilator an der Kammerdecke rührte den Mief nur um.
Eine unangenehme Begleiterscheinung dieser Witterung war das ungehemmte Wachstum der Kakerlaken. Die Biester waren schon immer an Bord gewesen, bei normalem Klima aber klein und nicht so zahlreich. Ich hatte diese Reisebegleiter ohnehin erst bei der Seefahrt kennen gelernt, auf diesen alten Schiffen gehörten sie zum Stammpersonal. Zahlreiche Holzelemente in den Aufbauten schufen ein kakerlakenfreundliches Umfeld, in zahllosen Ritzen und Fugen fristeten sie ihr Dasein. Tja, und wenn es wärmer wurde, dann gediehen sie besonders prächtig. Da nicht sein konnte, was nicht sein durfte, wurde die Kakerlakenjagd zu einer meiner Hauptbeschäftigungen. Die Chiefstewardess hatte auf einem Kontrollgang in der Pantry eine zu hohe Populationsdichte dieser Biester ausgemacht, ich erhielt eine Dose Insektenkiller und mutierte zum Kammerjäger. Meine Sprüherei hat die braunen Gesellen aber nicht sehr beeindruckt, es wurden immer mehr. Ich wartete nur noch darauf, dass ich eines Tages ein ganzes Rudel vor der Spraydose auffinden würde, mit umgebundener Serviette auf die nächste Fütterung wartend. Wir spülten, sprayten, wuschen jedes Schapp täglich aus, aber nach einigen Tagen Ruhe waren unsere Freunde wieder da, emsig und geschäftig wie eh und je. Sie war halt ein alter Kasten, unsere BURGENSTEIN. Auf den späteren Schiffen, nur aus Eisen und Kunststoffen bestehend, fanden die Viecher nicht mehr so gute Lebensgrundlagen vor. Nur die Kombüse und die Pantrys durfte man nicht aus den Augen verlieren, da hob „La Cucaracha“ immer wieder mal das Haupt…
In Montreal hat es mit der in der ersten Reise getroffenen Verabredung wirklich geklappt. Meine kanadische Fremdenführerin Claire stand schon zum Einlaufen an der Pier, wir konnten uns aber lediglich für den Abend verabreden, schließlich durfte ich nicht einfach von Bord hüpfen. Sie lud dann zum Barbecue in ihrem Elternhaus, zwei Kollegen sollte ich auch noch mitbringen. Abends wurden wir dann abgeholt, der Bäcker, Pippifax und ich. Claire hatte ihrerseits zwei Freundinnen aufgeboten, und in einem Vorort stieg dann die Party mit Familienanschluss. Leider zuviel Familienanschluss, die Eltern meiner neuen Bekanntschaft hielten uns Seeleute wohl für höchst bedenkliche Sittenstrolche und wichen keine Sekunde aus dem Raum, die Girls waren mal eben 18 Jahre alt. Selbst, als mich Claire in den Garten lotste, um mir irgendwas zu zeigen, war Mutti sofort achtern ran, um es sich ebenfalls zeigen zu lassen. Oder so. Jedenfalls war es ein ziemlich verdruckster Abend. Da auch keinerlei Alkoholika zum Barbecue gereicht wurde, verfiel Pipifax zusehends in tiefe Depressionen.
Wir haben uns am nächsten Tage noch einmal getroffen, dann ohne Anstandswauwau. Auch auf der Rückreise kam es noch mal zum Rendezvous, einige Zeit standen wir dann noch im Briefwechsel, bis die Verbindung abriss. Das gab es ab und an auch, dass Hein Seemann mal ein ganz bürgerliches Mädel kennen lernte, das nicht unbedingt in der gebührenpflichtigen Seemannsbetreuung tätig war.
Bei unserem letzten Transit durch den Wellandkanal hinterließ unser Dampfer noch eine besondere „Duftmarke“. Die Schiffe verblieben ja während der Schleusung einige Zeit in der Schleusenkammer, manche Sailors von der Deckscrew nutzten diesen Kurzaufenthalt, um mit Ölfarbe den Schiffsnamen und das Datum des Transits auf die Mauer zu pinseln. Mit der Zeit war ein recht großes Verzeichnis von Schiffen entstanden, die mal den Kanal passiert hatten. So machten sich auch auf unserem Kahn eines Tages zwei Janmaaten ans Werk und fingen eiligst an zu malen. Merkwürdigerweise stand dann da nicht unser Schiffsname, sondern MV (Motor-Vessel, entspricht dem deutschen MS) und dann einige chinesische Schriftzeichen sowie das aktuelle Datum. Anschließend zerrten sie den Wäscherei-Fritz an die Reling, er möge doch mal den chinesischen Schiffsnamen übersetzten. Der las, las noch mal, und schüttelte völlig entgeistert den Kopf. Bis er endlich stockend übersetzte. Da stand MV LANGE UNTERHOSE. Wie sich dann herausstellte, hatten die zwei Artisten den Wäschezettel von Fritz als Vorlage genutzt, auf diesem Zettel waren in Chinesisch und Deutsch zur Erstellung der Abrechnung alle gängigen Wäschestücke aufgedruckt.
Ich stelle mir heute noch vor, wie viele China-Sailors später noch die Schleuse passierten und vor lauter Kopfschütteln ein Schleudertrauma erlitten. Diese Episode ist auch sehr bezeichnend für den „sense of humour“, den die Janmaaten immer wieder auslebten.
Manche Sailors von der Deckscrew nutzten diesen Kurzaufenthalt, um mit Ölfarbe den Schiffsnamen und das Datum des Transits auf die Mauer zu pinseln
Vieles, was sich da so ereignete, kann man getrost unter der Rubrik ‚Lausbubenstreiche’ verbuchen, Seeleute bewahrten sich die Neigung zu solchen Aktionen teilweise bis ins hohe Alter.
Am 30.07.1972 verließ ich in Bremen das Schiff, nach 4 Monaten und 4 Tagen endete meine erste Fahrtzeit. Anstatt nun zügig ein Praktikum in der Elektrobranche anzusteuern, beschloss ich, noch einen Dampfer dranzuhängen, ich hatte es auf einmal gar nicht mehr so eilig. Vielleicht klappte es ja dieses Mal mit einer Reise dorthin, wo man „Una Lagrima“ spielte…
Es folgten einige Urlaubswochen zuhause in meiner Odenwälder Heimatgemeinde, Highlight dieser Zeit war wohl der Besuch von drei Bordkumpels, der Koch, der Bäcker und Kabel-Ede gaben sich die Ehre. In meiner damaligen Stammkneipe erfreuten sie die Eingeborenen mit mehreren eindrucksvollen Sondervorstellungen, selbst Jahre später hörte ich dort: „Wisst Ihr noch, als damals die Seeleute hier waren?“