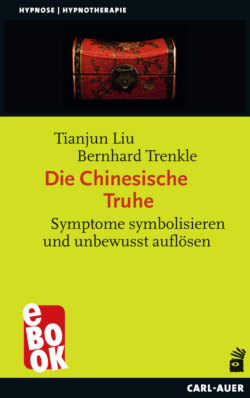Читать книгу Die Chinesische Truhe - Bernhard Trenkle - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1.3Das Symbol für das Ausgangssymptom intensiv imaginieren
ОглавлениеDas Ausgangssymptom zum konkreten Objekt umwandeln
Der Therapeut lädt den Klienten ein, sich sein Symptom als einen konkreten Gegenstand vorzustellen, einen Gegenstand mit physikalischen Eigenschaften. So könnte zum Beispiel gereizte Stimmung als ein wirres Knäuel, der Druck auf der Brust als Stein bildlich werden. Das Symbol zeichnet sich gewöhnlich ab, indem der Therapeut dem Klienten von verschiedenen Seiten Fragen stellt, möglichst nicht durch den willkürlichen Einsatz der Vorstellungskraft.
Das Symbol prüfen und vereinfachen
Das vom Klienten entwickelte, spontan entstandene oder vom Therapeuten eingeleitete Symbol eignet sich nicht unbedingt von vornherein. An dieser Stelle ist es am Therapeuten, zu überprüfen und beim Sortieren zu helfen: Das Symbol soll grundsätzlich das Symptom verkörpern und nicht dessen Auslöser, oft ein Lebensereignis; in der Praxis wird dies allerdings leicht verwechselt. Das Symbol ist nicht immer klar und eindeutig. Sollten mehrere Objekte als Symbol auftauchen, ist ein Objekt als das wichtigste zu erfassen, als das Hauptthema zu bearbeiten; die anderen, restlichen werden in der nächsten Sitzung berücksichtigt.
Ein präzises und prägnantes Symbol als Arbeitsgegenstand zu entwickeln, ist grundlegend für die wirksame Durchführung der Chinesischen Truhe.
Das Symbol intensiv imaginieren
Der Therapeut wendet suggestiv, zielgerichtet zwei Strategien bei der Fragestellung an, um den Klienten schrittweise in die vertiefende Imagination mit dem Symbol eintauchen zu lassen, mit bildhaftem, plastischem Erleben. Die erste Möglichkeit ist, aus verschiedenen Blickwinkeln nach möglichst vielen Facetten des Symbols zu fragen, sodass das Symbol sich allmählich abzeichnet, sich wie ein Bild mit allen erdenklichen Details vom Hintergrund abhebt. Die zweite Möglichkeit besteht darin, über mindestens drei Kanäle nach der Sinneswahrnehmung zu fragen, sei es optisch, akustisch, olfaktorisch oder taktil, sodass ein mehrdimensionales, plastisches Bild vom Symbol entsteht.
Wenn der Klient zum Beispiel ein schwarzes Pflaster als Symbol benennt, kann der Therapeut sein imaginatives Erleben verstärken, indem er ihn nach dessen Größe, Form, Farbe, Lichtreflexion (glänzend/matt), Geruch, Klebrigkeit, Konsistenz sowie Textur fragt, wie auch nach dem Geruch der Medizin, aus westlichen oder klassisch chinesischen Kräutern etc. Durch wiederholte suggestive Fragestellungen zu verschiedenen Details und Sinneswahrnehmungen wird das Bild in seiner Form und Bedeutung schrittweise plastisch zum Vorschein kommen, das Pflaster wird schließlich im Kopf des Klienten eine psychische Realität darstellen, als ob eine objektive physische Realität erreicht wäre.
Die Entstehung des Symbols, das Differenzieren, Prüfen oder Vereinfachen sowie der Prozess des intensiven Imaginierens sind häufig miteinander verflochten, sie inspirieren und vervollständigen sich gegenseitig. Die Reihenfolge, was zuerst, was als Nächstes geschieht, ist nicht streng definiert; die unterschiedlichen Schritte können sich auch parallel entwickeln oder sich kreuzen.