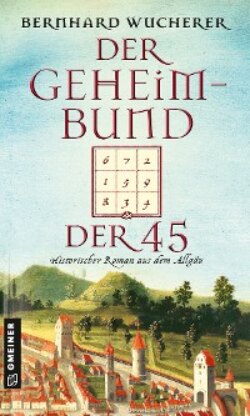Читать книгу Der Geheimbund der 45 - Bernhard Wucherer - Страница 6
Die historischen Inspirationsartefakte, um die sich im Roman alles dreht
ОглавлениеDas in Isny entdeckte »Magische Amulett«
Das Amulett, um das sich in diesem Roman alles dreht, gibt es wirklich. 2018 wurde ein besonders bedeutungsvolles Exemplar bei Grabungsarbeiten auf dem alten Marktplatz in Isny gefunden, direkt beim dortigen »Prangerstein«, wo es beim großen Stadtbrand von 1631 oder schon zuvor in den Boden gelangte und die Zeiten überdauerte. 2019 wurde von Dr. Matthias Ohm vom Landesmuseum Württemberg bestimmt, dass es sich um einen sogenannten »Rechenpfennig« (auch als »Münzmeisterpfennig« oder in Süddeutschland als »Raitpfennig« bezeichnet) handelt, einen medaillenartigen Platzhalter, der im Mittelalter beim Rechnen auf der Linie (auf Rechenbrettern, -tischen oder -tüchern) verwendet wurde. Rait-, Rechen- oder Münzmeisterpfennige konnten daneben auch politische oder – wie im vorliegenden Fall und im Roman beschrieben – moralische Botschaften transportieren.
Die in Isny ausgegrabene Medaille besteht aus Buntmetall, also einer Kupferlegierung, wahrscheinlich Bronze, was sich allerdings erst bei einer Materialanalyse feststellen ließe. Sie hat einen Durchmesser von zwanzig Millimetern und wurde nachträglich gelocht, damit sie um den Hals getragen werden konnte, vermutlich, ohne dass deren Träger den ursprünglichen Zweck kannten. So entstehen Legenden wie die von »Gladius Dei«, dem »Geheimbund der 45«.
Avers
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart; Foto: Christoph Schwarzer
Auf der Vorderseite weist das in Isny gefundene Exemplar auf die Vergänglichkeit des Menschen hin (vanitas). Neben einigen Schriftzeichen und anderen noch nicht erkannten Darstellungen ist ein toter Mensch mit einer Krone auf dem Kopf zwischen zwei Leuchtern und insgesamt fünf Sternen zu erkennen. Des Weiteren sieht man zu beiden Seiten des toten Königs innere Organe: Lungenflügel, Nieren und dergleichen. Dies lässt darauf schließen, dass es zur Entstehungszeit der Medaille Kenntnisse über die menschliche Anatomie gegeben hat. Und das, obwohl Leichenöffnungen bei Todesstrafe verboten waren. Die Darstellung der Organe deutet auf eine Entstehung vor der Frühen Neuzeit hin. Sie entspricht einer Anatomie, wie sie in »De Arte Phisicali et de Cirurgia« des englischen Chirurgen Johannes von Arderne (1307–1392 n. Chr.) nach 1412 n. Chr. dargestellt wird. Eine Wende zur Wiedereinführung anatomischer Sektionen an menschlichen Körpern – die von der Kirche abgelehnt wurden – brachten erst das 13. und 14. Jahrhundert. In diesem Zusammenhang darf der große Leonardo da Vinci (1452–1519 n. Chr.) genannt werden. Der bekannteste Künstler und Wissenschaftler der Renaissance führte selbst anatomische Präparationen durch und zeigte – anders als auf dem Amulett – realistische, detailgenaue und detailreiche anatomische Zeichnungen. Text: HODIE M(ihi) CR(as) TIBI A (bedeutet in etwa soviel wie: »Heute kommt der Tod für mich, morgen für dich«)
Revers
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart; Foto: Christoph Schwarzer
Das »Magische Quadrat« auf der Rückseite des in Isny gefundenen Exemplars erinnert an unser heutiges »Sudoku«, eine Gattung von Logikrätseln, die aus lateinischen Quadraten entstanden. Das in Isny gefundene »Magische Quadrat« sollte wohl Krankheiten und Tod abwehren. Es zeigt in neun einzelnen Quadraten die arabischen Ziffern 1 bis 9, die in der Summe aller Zeilen, Spalten und der beiden Diagonalen gleich sind. Diese Summe (15) wird als »Magische Zahl« des »Magischen Quadrates« auf dem »Magischen Amulett« bezeichnet. Rechnet man alle Zahlen zusammen, ergibt sich die Zahl 45. Das »Lo Shu« war schon zu Zeiten des legendären mythologischen Kaisers Yu (Regierungszeit von 2205–2147 v. Chr.) in China bekannt (wo es auch im Roman herkommt, weil es in Europa erst im 16. und 17. Jahrhundert beschrieben wird. Dies hat allerdings nichts mit dem in Isny gefundenen Exemplar zu tun). Im Westen hat sich unter anderem Adam Ries (1492 oder 1493–1559 n. Chr.) mit dem »Magischen Quadrat« beschäftigt. In seinem »Rechenbüchlin« gab er auf Seite 71 diese Aufgabe mitsamt der Lösung. Neben zwei Beispielen folgte: »Und darnach verwechsel mit den 8. und 2. also/ so hastu allenthalben 15. Denn alle Summen ergeben die Magische Zahl 15«. Text: »EK« für Egidius Krauwinckel, tätig in Nürnberg.
Die Motive beider Seiten werden im Roman vordergründig thematisiert und formen sich darin zu zwanghaften rituellen Handlungen, die im Codex des Geheimbundes »Gladius Dei« (lateinisch für »Schwert Gottes«) festgehalten sind. Dessen 45 Mitglieder haben sich bei der Gründung ihres mystischen Zirkels Anno Domini 1001 in der späteren Konzilstadt Konstanz aufgrund der Abbildungen auf dem Avers zum Ziel gesetzt, die bei Todesstrafe verbotenen und von der Kirche verfolgten anatomischen Präparationen zum Zwecke der Wissenschaft voranzutreiben. Und was das Revers des »Magischen Amuletts« betrifft, gibt der Codex dieses Bündnisses vor, talentierten, aber mittellosen Knaben aus dem Bereich und dem Umfeld des Bodensees, aus Westschwaben (dem heutigen Oberschwaben) und aus dem Allgäu zu ermöglichen, die Arithmetik oder andere Fächer der »artes liberales«, der »sieben freien Künste«, zu studieren. Grundsätzlich wäre es äußerst lobenswert, dass sich ein elitäres Bündnis von Adeligen, Gelehrten, Kaufleuten und Medizinern dieser Thematik annimmt … wenn es sich nicht selbst barbarischer Praktiken bedienen würde, die seinen hehren Zielen widersprechen.
Der in Isny ausgegrabene »Prangerstein«
Foto: Heinz Bucher, Isny
Der mächtige Prangerstein (1,7 Meter × 1,2 Meter) bot die Grundlage für die räumlichen beziehungsweise geografischen Beschreibungen in diesem Roman. Er stand an der exponiertesten Stelle Isnys, am Marktplatz, direkt am Alten Rathaus, dem früheren Amtshaus. Die ungewöhnliche Form mit den reliefartigen Linien erinnert an die städtebauliche Geometrie der Siedlungsgründung, die damit verbundene Gründungsachse und die Ummauerung, sowie die Handelsstraßen und die wichtigsten Stadttore. Die in den Stein gehauenen Zeichen zeigen links ein nach Norden orientiertes gleichseitiges Dreieck. Die Nordrichtung ist vertieft. Die drei Spitzen sind die Stadttore ohne das Obertor. Der Ausgrabungspunkt ist das Wassertor, rechts als Turm mit Spitzdach erkennbar. Die Nordrichtung ist astronomisch orientiert. Die Seitenlängen betragen jeweils tausend »Isnyer Fuß« (333,33 Meter). Da die Tore noch stehen und mit modernen Mitteln vermessen werden konnten, bestätigen sie den »Vermessungsstein« und den Baubeschluss aus der Klosterchronik. Straßen und Tore wurden von der Gründungsachse aus festgelegt. Sie beginnt am Wassertor (Tordurchgang Mitte, Innenseite Tor) und richtet sich zur gegenüberliegenden Dreiecksseite (Seitenhalbierungspunkt). Das vierte Tor (Obertor) ist vom Marktplatz aus nach der astronomischen Wintersonnenwende (22. bzw. 23. Dezember, kürzester Tag) ausgerichtet. Der »Isnyer Fuß« gibt auch die Länge (33,33 Zentimeter) für die ersten Ziegelsteine (Funde aus der Grabung am Marktplatz) vor. Der Maßstab auf dem interessanten Fundobjekt beträgt 1:500. Wie auch andernorts wurde der Pranger in Isny benutzt und war ein Strafwerkzeug in Form eines Pfahls oder einer Säule, an die Missetäter wegen einer als straf- oder verachtungswürdig empfundenen Tat eine gewisse Zeit lang angebunden oder angekettet stehen mussten und somit allgemeiner Verachtung und Spott ausgesetzt waren. Quelle: Roland Manz, Erhard Bolender, Heinz Bucher, März 2020.
Isny im Allgäu, Hauptort des Geschehens
Als mächtige Gletscher vor zehntausend Jahren das Allgäu bei Isny formen, bildet sich die reizvolle Landschaft aus, wie wir sie heute kennen und lieben. Damals entstehen das heute landschaftsprägende sanfte Gebirge der Adelegg mit Schwarzem Grat, der Eistobel mit Wasserfällen, Strudellöchern und gewaltigen Felswänden, die Moore mit Heideflächen, lichten Waldgebieten, Wiesen und Seen.
Bereits den Römern gefällt dieses Fleckchen Erde so gut, dass sie ein Kastell auf einem Moränenhügel im Tal der Argen unweit der heutigen Stadt Isny bauen. Erstmals urkundlich erwähnt wird Isny im 11. Jahrhundert. Als Freie Reichsstadt entwickelt sich Isny ab dem 14. Jahrhundert zur ersten großen Blüte. Die stattlichen Bürgerhäuser innerhalb des mittelalterlichen Ovals mit Toren und Türmen und die noch weitgehend erhaltene hohe Stadtmauer mit Wehrgang zeugen bis heute vom Reichtum der Stadt. Isny ist eine der ersten Städte, die protestantisch wird, nachdem Martin Luther persönlich den Stadtoberen einen Brief geschrieben hat. Die Besonderheit eines katholischen Klosters in der von evangelischem Bürgertum geprägten Stadt, ist nur einer der vielen Gegensätze und jahrhundertelangen Streitpunkte in der Stadtgeschichte. Bereits 1507 bekommt die Stadt als zweite im Bodenseeraum nach Konstanz das Münzrecht.
1365 wird Isny Freie Reichsstadt und damit nur dem Kaiser untertan. Der freiheitliche Geist bleibt den Isnyern bis heute erhalten. Inzwischen zählt die Stadt mit den vier eingemeindeten Orten Beuren, Großholzleute, Neutrauchburg und Rohrdorf rund vierzehntausend Einwohner. Kunst und Kultur sind in Isny an vielen Ecken zu spüren und zu erleben. Ganz besonders im früheren Kloster und späteren Schloss, das seit Kurzem Kunsthalle, Städtische Galerie und Städtisches Museum unter einem Dach vereint. Aber auch in Isny-Großholzleute, denn dort im historischen Gasthof »Adler« logieren in früheren Zeiten Königinnen, befindet sich eine Station der Thurn-und-Taxis-Post und ist der Gründungsort der ersten Skischule weit und breit. Beim Treffen der »Gruppe 47« mit Preisträger Günter Grass wird dort Literaturgeschichte geschrieben, als Grass zum ersten Mal aus dem Manuskript seiner »Blechtrommel« liest. Besonders herausragend ist die seit Jahrhunderten original erhaltene Prädikantenbibliothek im Turm der Nikolaikirche. Sie enthält wertvolle Handschriften, Inkunabeln (Früh- oder Wiegendrucke) und weitere Kostbarkeiten. Im Rahmen der Stadtsanierung in den letzten Jahren fördern umfangreiche archäologische Ausgrabungen in der Isnyer Altstadt bedeutende Zeugnisse der Geschichte zutage. Neben alten Webstühlen, Tongefäßen und Gläsern sowie sehr mächtigen alten Fundamenten und dem »Prangerstein« wird 2018 auch der »Münzmeisterpfennig« ausgegraben, der in diesem Roman als »Magisches Amulett« die Hauptrolle spielt. Viel Freude beim Lesen dieses herausragend recherchierten historischen Romans!