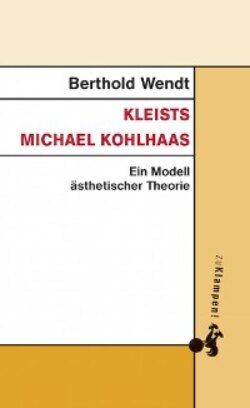Читать книгу Kleists Michael Kohlhaas - Berthold Wendt - Страница 7
I 02) Methodische Positionierung meines Forschungsansatzes
ОглавлениеMeine Arbeit bildet methodisch einen Beitrag zur Diskussion über eine an die Kritische Theorie anschließende kritische Hermeneutik146. Dabei geht sie von der Annahme aus, dass es einer philosophischen Theorie, deren Anliegen es ist, das Unzureichende der gleichwohl zur philosophischen Selbstreflexion notwendigen Reflexionsbegriffe darzutun, aufzuzeigen obliegt, dass eine kontingente, und darum aus dem philosophischen Selbstbewusstsein nicht ableitbare Bestimmtheit, gleichwohl systematisch für die Erfüllung der Konstruktion, d. h. eben ästhetisch notwendig ist. Nur in dieser negativen Dialektik erweist sich der Stoff als eigenständig und nicht als bloß durch die Form beliebig bestimmbares Material. In diesem Sinne wird das in der Negativen Dialektik von Adorno als »Vorrang des Objekts«147 und in der Ästhetischen Theorie als »Sprache der Dinge«148 Bezeichnete als Idealismuskritik verstanden. Da aber der allgemeine Begriff eines Kontingenten ebensowenig ein Bestimmtes bezeichnet wie der Hegel’sche Begriff der Bestimmtheit in der Logik149, sondern nur die Forderung nach einem aus dem Begriff aber nicht ableitbaren Bestimmten, geht eine bloß allgemeine methodische Darlegung notwendig an der Sache vorbei. Diese kann nur in einer modellweisen Einzelanalyse vorgeführt werden. Für die Kleist’sche Dramaturgie wird das in dieser Arbeit am zwangsläufig sich als widersprüchlich erweisenden Begriff des höchsten Gutes aus der Kant’schen Kritik der praktischen Vernunft sowie, speziell dann auf die Erzählung Michael Kohlhaas bezogen, an der Begründung des Rechts im Verhältnis zur Moral aufgezeigt. Die kontingente Rechtsverletzung auf der Grundlage des kontingenten adligen Großgrundbesitzes wird im Prozess des Handlungsverlaufs als ein ästhetisch Notwendiges erwiesen, das den falschen Schein der Vernunft bürgerlicher Verhältnisse aufdeckt. Die Möglichkeit, ein Kontingentes als ästhetisch Notwendiges zu entwickeln, beruht in der Literatur auf der Realisierung der poetischen Formbestimmungen im Stoff. Darum ist der Gehalt eines Werkes nach Adorno dadurch bestimmt, dass die Form, oder moderner ausgedrückt, die Konstruktion, am Stoff Bestimmungen entwickelt, die er für sich so nicht hat und durch die sowohl die Form zur Erscheinung kommen kann wie auch das Material zum Sprechen gebracht wird150. Dieser wechselweise Prozess von stimmiger Formänderung und Stoffentwicklung wird in dieser Arbeit am Handlungsverlauf des Michael Kohlhaas offengelegt. Solch ein Prozess macht dann »die Logik der erzählerischen Konstruktion«151 aus, wie Helga Gallas fordert, und auf die auch – unter dem Namen einer »Logik des Textes«152 – die Theorie des »erschöpfenden Interpretierens« von M. Niehaus die Deutung literarischer Werke verpflichtet. Anders als in meiner Arbeit zeigt sich aber sowohl bei H. Gallas als auch bei M. Niehaus eine nominalistische Ausweitung des Formbegriffs. Denn es werden dort – sei es die subjektiven Intentionen des Autors oder der literarischen Tradition völlig fremde Theorien (bei Gallas die Lacan’sche Psychoanalyse) – herangezogen, die die geschichtlich sich durch die Werke verändernden literarischen Formbestimmungen substituieren. Verstehbar ist die nominalistische Preisgabe des Formbegriffs daraus, dass es in der historischen Richtungstendenz der Veränderung der Formbestimmungen liegt, dass sich die Werke nur in bestimmter, und der Tendenz nach ggf. sogar abstrakter Negation noch auf die traditionellen Formbestimmungen beziehen; doch bleiben sie nur vermöge des Nachweises ihrer spezifisch motivierten negativen Beziehung interpretierbar, da sie ansonsten ihren Werkcharakter einbüßen.
Helga Gallas erwartete sich als Orientierung die Konstruktion des spezifischen Gegenstandes der Literaturwissenschaft, »und zwar, indem ein System theoretischer Begriffe eingeführt wird, das den Gegenstand als theoretischen bestimmt und die Methode seiner Analyse begründet.«153 Es erstaunt freilich, dass Helga Gallas meint, dass dies eine noch zu leistende Aufgabe wäre, denn die Philosophie der Kunst hat in einem »System theoretischer Begriffe« und dessen Kritik – eben durch die Spezifität der Kunst und den Begriff ästhetischer Wahrheit – dies längst geleistet und im weitesten Sinne die Kunst als Verwirklichung der Idee des Schönen und des Erhabenen begründet154. Der Gegenstand der Kunstwissenschaft wird aber durch sie nicht »als theoretischer bestimmt«, sondern durch die Theorie als individueller155. Peter Szondi schreibt: »Auch die Literarhistorie vermag das Besondere nur als Exemplar, nicht als Individuum zu sehen; das Einzigartige fällt auch für sie außer Betracht. […]. Solche Kritik an der Literaturgeschichte schließt keineswegs die These ein, das Individuum, das einzelne Werk, sei ungeschichtlich. Vielmehr gehört gerade die Historizität zu seiner Besonderheit, so dass einzig die Betrachtungsweise dem Kunstwerk ganz gerecht wird, welche die Geschichte im Kunstwerk, nicht aber die, die das Kunstwerk in der Geschichte zu sehen erlaubt.«156 Darum kann es auch keine »Methode seiner Analyse« im Sinne von anzuwendenden methodisch geregelten Verfahren geben, wie es sich der Strukturalismus etwa vorstellt157.
Spricht Wolfgang Kayser158 bei der Bestimmung des Verhältnisses von Untersuchungen zu literaturhistorischen Teilbereichen und der Erkenntnis des poetischen Kernbezirks von einer Gleichberechtigung, so entgeht ihm, dass die Implikation seiner eigenen Argumentation darauf geht, dass es sich dabei um ein Zweck-Mittel-Verhältnis handeln muss. Dabei ist aber der Zweck das organisierende Prinzip, das die Mittel auf sein Ziel ausrichtet. »Es war die Aufgabe dieses letzten Kapitels, in den innersten Kern eines Kunstwerks zu dringen und zu zeigen, wie sich von daher das geheime Leben bis in die letzten Verästelungen der Sprache, des Verses, der äußeren Form organisiert.«159 Kayser bestimmt den poetischen Zweck als den Gehalt eines Werkes, den er gegen die »Idee«160 des Künstlers, also seine Intention, abgrenzt. Und sofern er ihn in das »Gefüge der Gattungen«161 einbettet, drückt er aus, dass er sich aus der individuellen Realisierung der Formbestimmungen der Gattungen im Stoff herstellt. Darum ergibt sich ein koordiniertes wechselseitiges Verhältnis der Gleichberechtigung nur unter der teleologischen Bestimmung, dass die Mittel nur Mittel sind als Mittel dieses Zwecks und außerhalb seiner ohne Bedeutung bleiben (so, wie ein abgetrennter Finger nicht mehr Teil eines lebendigen Organismus ist und sich zersetzt). Weil aus den verselbständigten Mitteln kein Weg zur Erkenntnis des Gehalts eines Werkes162 führt, entsteht für eine rasant sich entwickelnde und spezialisierende Forschung die Gefahr ins Leere zu laufen. Hamacher verleiht, als Repräsentant der literarhistorischen Forschung, dieser Gefahr die affirmative Bestimmung des literaturwissenschaftlichen Erkenntnisziels. »Anstatt hier zu vereindeutigen und sich auf eine Ausformung der Theorie festzulegen, ist am genuinen Erkenntnispotential der Literatur festzuhalten, deren funktionale Leistung im Unterschied zur Philosophie gerade darin besteht, das ganze Spektrum widersprüchlicher Antworten und Lösungsversuche […] gleichzeitig zur Geltung zu bringen und damit ungelöste Probleme offen zu halten.«163 Zwischen den spezialisierten Teilkenntnissen und den lebendigen Beziehungen der Teile eines individuellen Ganzen aufeinander und durcheinander, gibt es keinen kontinuierlichen Übergang, sondern es bedarf eines Hinzukommenden, das Thomas Mann in den Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull schöpfungsgeschichtlich als »Urzeugung«164 bezeichnet hat. Gerade weil zur Bestimmung des Gehalts eines Werkes der entwickeltste Stand des kritischen Selbstbewusstseins165 als terminus a quo und als terminus ad quem einbezogen sein muss, kann es nicht, wie die Hegel’sche Inhaltsästhetik begründet, ein für allemal auf seinen allgemeinen Begriff gebracht und der Geschichte des Selbstbewusstseins subsumiert werden166. Unbeschadet der wissenschaftlich begründeten Wahrheit einer Interpretation ist sie doch als Modellanalyse offen in dem Sinne, dass sich alternative begründete zukünftige Gesamtdeutungen als Möglichkeit vorstellen lassen. Gesamtdeutungen, denn Kunstwerke sind nicht, wie in den Naturwissenschaften, als ein schon auf seine allgemeine Form gebrachter Sachverhalt vorauszusetzen, den eine spezialisierende Forschung nur näher differenziert zu bestimmen hätte. Insofern befindet sich eine stimmig argumentierende Interpretation des Gehalts per se im Gespräch mit anderen Literaturwissenschaftlern, auch wenn ihr ggf. nichts anderes übrigbleibt, als die Unvereinbarkeit von zwei Vorgehensweisen aufzuzeigen.
Eine Interpretation eines Kunstwerks, die sich der literatursystematischen Tradition verpflichtet fühlt, die u. a. Wolfgang Kayser als »Poetik« bezeichnet und die ein Werk als integrale Einheit aus Formbestimmungen und Stoff betrachtet, sieht sich dazu verpflichtet, die Hinzuziehung begrifflicher Bestimmungen, die zur vernünftigen Darstellung des Gehalts eines poetischen Werkes erforderlich sind, aus dem ästhetischen Prozess des Werks selbst zu begründen. Da der Geist eines Kunstwerks das Organisationsprinzip seiner Teile ist, so erscheint dieses Prinzip nur in seinen Teilen, aber diese sind nur als auf seinen Zweck hin ausgerichtete seine Teile. Das Problem des hermeneutischen Zirkels muss bei einer Interpretation also prinzipiell als gelöst vorausgesetzt werden, weil die Teile sonst nicht Teile (eines Ganzen) wären, das Ganze nicht das Ganze seiner Teile. Aufgabe der Interpretation ist es dann den Prozess von Teilen und Ganzem im Detail aufzuzeigen. Auch das von Schleiermacher aufgeworfene Problem der Hypereinheiten löst sich daraus, dass der gegenwärtige Stand des Selbstbewusstseins der terminus a quo und der terminus ad quem einer Interpretation sein muss, die nicht von bloß archivarischem Wert sein soll und damit nutzlos für das Leben.167
Stellt man das Werk als integrale Einheit seiner Elemente nicht mehr ins Zentrum der Forschung, dann erscheint ein Kunstwerk wie jeder beliebige Gegenstand als ein Ding von vielen Eigenschaften und so können von ihm vielerlei spezialisierte Kenntnisse ihren Ausgang nehmen. Kenntnisse aber betreffen fremde Objekte. Zwar können diese historischen Forschungen grobe Fehlinterpretationen verhindern, aber problematisch wird es, wenn das, was im Werk als Element seiner Stoffschicht verarbeitet sein kann, rückwirkend zum gültigen Kriterium der Interpretation erklärt wird. Denn es besteht der wesentliche Unterschied darin, ob die Theorien, in deren Kontext ein Werk entstanden ist, über seine Interpretation entscheiden, oder ob aus der Interpretation heraus Theorien herangezogen werden, um den ästhetischen Wahrheitsgehalt zur begrifflichen Darstellung bringen zu können. Für Hamacher steht Ersteres fest: »Die Schwierigkeiten der Kohlhaas-Interpretationen fußen nicht zuletzt auf dieser Unvereinbarkeit disparater Theorien, die alle zum diskursiven Kontext der Erzählung gehören. Je nachdem, welcher Theorie man als Prätext für Kleists Erzählung den Vorzug gibt, entsteht ein anderes Bild des Protagonisten und seiner Taten.«168 Ganz abgesehen von der Frage, ob es das Ziel einer Kohlhaas-Interpretation sein soll, den Protagonisten und seine Taten zu beurteilen, so spricht doch Hamacher hier dem Gegenstand der Interpretation jede Eigenbestimmung ab. Das Kunstwerk wird im Zugriff einer so verstandenen Interpretation zur beliebigen Projektionsfläche von widersprüchlichen Theorien, die von außen aus dem bunten historischen Kontext an es herangetragen werden. Bekommt aber der Gegenstand einer Wissenschaft seine Bestimmtheit einzig durch einander widersprechende Theorien, dann ist er ein »leerer Gegenstand ohne Begriff, nihil negativum«, nämlich: »Der Gegenstand eines Begriffs, der sich selbst widerspricht, ist Nichts, weil der Begriff Nichts ist, das Unmögliche, wie etwa die gradlinige Figur von zwei Seiten, (nihil negativum).«169 Wenn die wissenschaftlichen Theorien ihre Widersprüche nicht lösen können, dann sind sie entweder falsch oder sie zeigen einen Knoten (Aristoteles), also ein Problem, in der Sache an. Das Problem wäre dann also offen. Dass es die Bestimmung der Kunstwerke sein soll, »ungelöste Probleme offen zu halten«170 liefe auf die These hinaus, Kunstwerke seien nichts weiter als das unterhaltsame kunstvolle Arrangement einer tautologischen Bebilderung von hypothetischen Theorien. Damit wären sowohl ihr spezifisch Ästhetisches als auch ihr Wahrheitsgehalt preisgegeben.