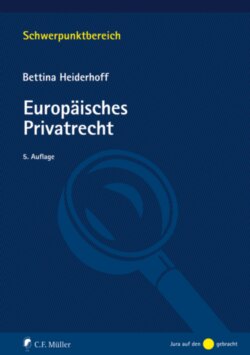Читать книгу Europäisches Privatrecht - Bettina Heiderhoff - Страница 156
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Anmerkungen
Оглавление[1]
Schon bei der Umsetzung muss auch der Grundsatz des „effet utile“ beachtet werden, Calliess/Ruffert/Calliess/Kahl/Puttler, EUV/AEUV, Art. 4 EUV Rn. 55; näher dazu unten im Zusammenhang der Auslegung Rn. 111.
[2]
Nähere Angaben zu allen Richtlinien im Anhang I.
[3]
So EuGH Slg. 1997, 2649, 2672 (Kommission/Großbritannien).
[4]
Das folgt unmittelbar aus der richterlichen Unabhängigkeit; vgl. auch Koenig/Sander, EuZW 2000, 716, 720 ff. Dass der EuGH dennoch eine Staatshaftungspflicht annimmt, wenn Richter europarechtswidrig entscheiden, ändert daran nichts, da der Anspruch gegen den Staat und nicht gegen das Gericht besteht (vgl. zu diesem Anspruch unten Rn. 94); umfassend zur Problematik Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, 2004, S. 344 ff.
[5]
EuGH Slg. 2001, 3541 Rn. 17 ff. (Kommission/Niederlande); zuvor etwa EuGH Slg. 1991, 2607 Rn. 28 (Kommission/Deutschland); vgl. aber auch EuGH Slg. 2002, 4165 (Kommission/Schweden), wo klargestellt wird, dass der Richtlinienanhang nicht umgesetzt zu werden braucht; auch dazu Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, 2004, S. 348 ff.
[6]
Kritisch zur zunächst unvollständigen Umsetzung der Klausel-RL Staudinger, WM 1999, 1546; Neu, ZEuP 1999, 123, 138 f. zu § 3 UWG.
[7]
Unter anderem kommt dies nur bei einer hinreichend konkreten Richtlinie in Betracht. Vgl. erstmals zur Direktwirkung EuGH Slg. 1974, 1337, 1348 (van Duyn); exakter EuGH Slg. 1986, 723, 749 (Marshall). Siehe zur unmittelbaren Wirkung auch BVerfGE 75, 223, 235 ff. Zusammenfassend: Scherzberg, Jura 1993, 225; Brechmann, Richtlinienkonforme Auslegung, 1994, S. 14 ff.; Calliess/Ruffert/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 288 AEUV Rn. 47 ff.; Gebauer/Wiedmann/Wiedmann, Zivilrecht unter europäischem Einfluss, Kap. 2 Rn. 18 ff.
[8]
So ausdrücklich EuGH Slg. 1986, 723, 749 (Marshall); EuGH Slg. 1994, 3325 (Faccini Dori); sowie nach der Einfügung des Verbraucherschutzes in Art. 129a EGV (jetzt Art. 169 AEUV) nochmals bestätigend EuGH Slg. 1996, 1281 Rn. 15, 18 ff. (Corte Inglés); EuGH Slg. 2007, 4473 Rn. 20 (Carp); vgl. zu den Grenzen der Privatbelastung durch unmittelbar wirkende Richtlinien Jarass/Beljin, EuR 2004, 714.
[9]
EuGH Slg. 2005, 9981 Rn. 67 ff. (Mangold).
[10]
Basedow, ZEuP 2008, 230; Thüsing, ZIP 2005, 2149 (der die Entscheidung letztlich dennoch ablehnt). Der Fall Mangold weist noch eine weitere Besonderheit auf. Es ging hier nämlich um eine Richtlinie, deren Umsetzungsfrist noch nicht abgelaufen war. Daher stellte sich dort auch die Frage der Vorwirkung von Richtlinien (dazu unten Rn. 133).
[11]
Nur nochmals EuGH NZA 2014, 193 LS 2 und 4 (AMS).
[12]
EuGH Slg. 2006, 2461 (Kommission/Frankreich) – 31.650 € pro Tag des (weiteren) Verzugs.
[13]
EuGH Slg. 1997, 2649, 2672 (Kommission/Großbritannien); vgl. aber auch EuGH Slg. 2002, 3887 (Kommission/Griechenland), wegen teilweise fehlerhafter Umsetzung der Produkthaftungs-RL; auch schon oben Rn. 86 f.
[14]
So EuGH Slg. 1996, 4845 (Dillenkofer); grundlegend bereits EuGH Slg. 1991, 5357 (Francovich).
[15]
Näher MünchKommBGB/Tonner, § 651r Rn. 4 f.; Gorr, VW 2020, 13.
[16]
Stattdessen für eine richtlinienkonforme Reduktion des § 651r Abs. 3 BGB und eine unbegrenzte Einstandspflicht der Versicherung eintretend Staudinger/Staudinger, BGB, § 651k Rn. 5 f.; die Bundesregierung prüft derzeit eine Neuregelung der Insolvenzsicherung im Reiserecht, BT-Drucks. 19/15995, 5.
[17]
Näher Dörr, WM 2010, 961; anwendend BGH NJW 2009, 2534; zu den Prüfungsvoraussetzungen Herdegen, Europarecht, § 10 Rn. 11.
[18]
EuGH Slg. 2003, 10329 Rn. 33 ff. (Köbler). Der 1. Leitsatz beginnt wie folgt: „Der Grundsatz, dass die Mitgliedstaaten zum Ersatz von Schäden verpflichtet sind, die einem Einzelnen durch ihnen zuzurechnende Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht entstehen, ist auch dann anwendbar, wenn der fragliche Verstoß in einer Entscheidung eines letztinstanzlichen Gerichts besteht, sofern die verletzte Gemeinschaftsrechtsnorm bezweckt, dem Einzelnen Rechte zu verleihen, der Verstoß hinreichend qualifiziert ist und zwischen diesem Verstoß und dem dem Einzelnen entstandenen Schaden ein unmittelbarer Kausalzusammenhang besteht.“
[19]
EuGH Slg. 2001, 9945 Rn. 47 (Heininger); BGH NJW 2004, 2744; in Hinsicht auf die Widerrufsfolgen auch BGHZ 179, 27 (Quelle II).
[20]
Schinkels, JZ 2011, 394, 398.
[21]
Schulze/Schulte-Nölke/Dörner, Schuldrechtsreform vor dem Hintergrund des Gemeinschaftsrechts, 2001, S. 177, 183.
[22]
Burmeister/Staebe, EuR 2009, 444, meinen, dass durch diese Form der überschießenden Umsetzung auch bei Mindeststandard-Richtlinien die Pflicht zur richtlinienkonformen Umsetzung aus Art. 288 Abs. 3 AEUV verletzt sein könne.
[23]
Lutter, JZ 1992, 593, 604; Jarass, Grundfragen der innerstaatlichen Bedeutung des EG-Rechts, 1994, S. 96; zur verfassungskonformen Auslegung vgl. nur BVerfGE 69, 1, 55. Die Unterschiede zur verfassungskonformen Auslegung betont Franzen, Privatrechtsangleichung, 1999, S. 327 f.
[24]
Mit dem inzwischen verbreiteten Ausdruck der „Inseln“ schon Rittner, JZ 1995, 849, 851; zum punktuellen Charakter, der oft kritisiert wird, auch Müller-Graff, NJW 1993, 13, 19; W.-H. Roth, FS Drobnig, 1998, S. 135, 136.
[25]
Dazu unten Rn. 635.
[26]
Neugestaltung der Rahmenbedingungen für die Verbraucher, COM(2018) 183.
[27]
Vorerst Franzen, Privatrechtsangleichung, 1999, S. 291 ff.; Buck, Über die Auslegungsmethoden des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaft, 1998.
[28]
Lorenz, NJW 2011, 2241, 2242; sehr kritisch etwa Schulze/Hommelhoff, Auslegung europäischen Privatrechts, 1999, S. 29.
[29]
So auch Lutter, JZ 1992, 593, 598 f.; Hommelhoff meint ebenfalls trotz aller Kritik: „Auch zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts verwendet der EuGH Kriterien, die den bekannten Savignys entsprechen“, Schulze/Hommelhoff, Auslegung europäischen Privatrechts, 1999, S. 29.
[30]
EuGH Slg. 1999, 7081 Rn. 23 (Adidas); EuGH Slg. 2009, 8295 Rn. 38 (Eschig); EuGH Slg. 2010 3091 Rn. 25 (Fundación Gala-Salvador Dalí u.a.).
[31]
Aus dem Verbraucherschutz etwa die Entscheidung Travel Vac, EuGH Slg. 1999, 2197, in welcher der EuGH bei einigen der Vorlagefragen in auffälliger Weise den Gesetzeszweck unerwähnt lässt und allein den Wortlaut der Norm heranzieht (so Rn. 22 ff., 34 ff.); klar ersichtlich wird die vom EuGH verfolgte Reihenfolge auch in der Entscheidung Berliner Kindl, EuGH Slg. 2000, 1741 Rn. 18: „Da der Bürgschaftsvertrag somit bei einer Auslegung dieser Bestimmung nach ihrem Wortlaut nicht unter die Richtlinie fällt, ist zu prüfen, ob sich aus der Systematik und den Zielen der Richtlinie etwas anderes ergibt“. Klar zu seinen Methoden äußert der EuGH sich auch in EuGH Slg. 1998, 8679 Rn. 25 ff. (Codan).
[32]
EuGH Slg. 1998, 1199, 1222 (Dietzinger); deutlich nochmals EuGH Slg. 2000, 117 Rn. 17 (Estee-Lauder): „Ist der Wortlaut einer Gemeinschaftsvorschrift in ihren verschiedenen sprachlichen Fassungen im Lichte der Entstehungsgeschichte der Vorschrift und der Materialien, auf die die Parteien sich in ihren beim Gerichtshof eingereichten Erklärungen gestützt haben, so widersprüchlich und mehrdeutig, dass sich ihm keine Antwort auf die Frage nach seiner Bedeutung entnehmen lässt, so ist für seine Auslegung auf den Zusammenhang der Vorschrift und auf das mit der Regelung verfolgte Ziel abzustellen.“
[33]
Das beobachtet auch Franzen, in: Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 1997, S. 285, 286 f.; ebenso W.-H. Roth, BGH-Festgabe, 2000, Band 2, S. 847, 873.
[34]
Näher Riesenhuber/Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, § 10 Rn. 22 ff.
[35]
EuGH Slg. 1982, 3415 Rn. 20 (C.I.L.F.I.T.); nochmals EuGH Slg. 2000, 1741 Rn. 24 ff. (Berliner Kindl); auch EuGH Slg. 1999, 7081 Rn. 23 (Adidas).
[36]
Schulze/Schulte-Nölke, Auslegung europäischen Privatrechts, 1999, S. 143, 159; Schulze, ebenda, S. 9, 13; zum vergleichsweise geringen Stellenwert der Wortlautmethode umfassend Anweiler, Auslegungsmethoden, 1997, S. 145 ff., 168 ff.
[37]
Lesenswert Potacs, EuR 2009, 265; auch Franzen, Privatrechtsangleichung, 1999, S. 452 ff.; Streinz, FS Everling, 1995, S. 1491.
[38]
Buck, Über die Auslegungsmethoden, 1998, S. 208 ff.; Everling, JZ 2000, 217, 223.
[39]
Nur EuGH Slg. 1999, 7081 Rn. 24 (Adidas); Franzen, Privatrechtsangleichung, 1999, S. 453.
[40]
Riesenhuber/Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, § 10 Rn. 4 ff.; ausdrücklich verwendet der EuGH den Begriff der autonomen Auslegung, wenn es um Übereinkommen geht, vgl. zum EuGVÜ (jetzt EuGVVO) EuGH Slg. 1997, 3768, 3795 (Benincasa) (zum Verbraucherbegriff); auch bei der Auslegung des Vertrags geht er oftmals rein autonom vor, siehe etwa EuGH Slg. 1982, 1035, 1048 ff. (Levin); vgl. aber auch Habersack, WM 2000, 981, 984, der „autonom“ als eigenständig in Hinblick auf die Methode versteht.
[41]
Grabitz/Hilf/Nettesheim/Mayer, Das Recht der EU, Band I, Art. 19 EUV Rn. 53; vgl. auch die Entscheidung EuGH Slg. 1994, 1311, 1321 (Christel Schmidt), die Franzen, in: Jahrbuch junger Zivilrechtswissenschaftler 1997, S. 285, 287 ff., gerade auf die Frage der autonomen Auslegung hin analysiert hat; ders., Privatrechtsangleichung, 1999, S. 478 ff., setzt sich ausführlicher und zugleich kritisch mit der autonomen Auslegung von Richtlinien durch den EuGH auseinander, die er wegen des den Richtlinien innewohnenden Bezugs zum nationalen Recht für bedenklich hält.
[42]
Früh etwa EuGH Slg. 1982, 1363 Rn. 19 f. (Pommerehnke), wo „Kaufvertrag“ ausdrücklich abweichend vom nationalen Recht verstanden wird; das aufgreifend auch EuGH NJW 2017, 3215 Rn. 34 (Schottelius); zum Begriff des Verkäufers EuGH NJW 2017, 874 Rn. 28 (Wathelet); näher W.-H. Roth, BGH-Festgabe, 2000, Band 2, S. 847, 873.
[43]
Diese Mischung aus autonomer Auslegung und anderen Erwägungen (etwa Auslegung nach der lex fori) lässt sich gut am Beispiel der EuGVVO (früher EuGVÜ) erkennen. Autonom erfolgte z.B. die Auslegung des Begriffs „Verbrauchervertrag“ in EuGH Slg. 1993, 139 Rn. 18 (Shearson Lehman Hutton), sowie EuGH Slg. 2005, 439 Rn. 31 (Gruber).
[44]
Everling, ZEuP 1997, 796, 802; Anweiler, Auslegungsmethoden, 1997, S. 277 ff.; kritischer Riesenhuber/Schwartze, Europäische Methodenlehre, § 4 Rn. 24 ff.
[45]
Schulze, ZfRV 1997, 183, 188; Grundmann, Europäisches Schuldvertragsrecht, 1999, S. 130 ff., 138; Franzen, Privatrechtsangleichung, 1999, S. 454.
[46]
Berühmt die Rechtsprechung zur Staatshaftung, etwa im Urteil Francovich, EuGH Slg. 1991, 5357; ansonsten wird die Rechtsvergleichung selten benannt, wiewohl sie in der Praxis am EuGH stattfindet, näher Henninger, Europäisches Privatrecht und Methode, 2009, S. 293 f.
[47]
So in den Entscheidungen EuGH Slg. 1998, 2843, 2869 Rn. 20 (Kefalas) und EuGH Slg. 2000, 1705, 1734 Rn. 33 (Diamantis).
[48]
Ohne Begründung ging der EuGH in der Entscheidung Dietzinger von der Akzessorietät der Bürgschaft aus. Darin liegt nichts anderes als ein vergleichender Blick auf die mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen, die sich insofern – wie der EuGH offenbar als selbstverständlich ansah – alle gleichen, EuGH Slg. 1998, 1199, 1221.
[49]
Näher zu diesem Klauselwerk auch unten Rn. 615.
[50]
So auch Schmidt, FS Großfeld, 1999, S. 1017, 1026; zum Charakter der Lando-Grundregeln nur als Grundsätze des Europäischen Vertragsrechts, von Bar/Zimmermann, Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts, Teil III, 2005, S. XIX.
[51]
Das beschreibt etwa Grundmann, Europäisches Schuldvertragsrecht, 1999, S. 133; Everling, ZEuP 1997, 796, 802; aus der Rechtsprechung selbst vgl. nur EuGH Slg. 1982, 1575 Rn. 18 ff. (AM&S); mehr Rechtsvergleichung fordert Remien, RabelsZ 62 (1998), 627, 646 vom EuGH.
[52]
Das wird ebenfalls erkennbar in EuGH Slg. 1982, 1575 Rn. 18 ff. (AM&S); mit weiteren Beispielen Anweiler, Auslegungsmethoden, 1997, S. 282 ff.; Franzen, Privatrechtsangleichung, 1999, S. 455, spricht daher nicht von einer Auslegungs- sondern von einer Arbeitsmethode.
[53]
So etwa auch EuGH NJW 2017, 3215 Rn. 39 (Schottelius).
[54]
EuGH Slg. 1982, 3415, 3430 (C.I.L.F.I.T.); EuGH Slg. 1998, 1605 Rn. 34 ff. (EMU Tabac), dazu Schmidt, RabelsZ 59 (1995), 576; Schulze/Schulte-Nölke, Auslegung europäischen Privatrechts, 1999, S. 143, 158.
[55]
So auch Anweiler, Auslegungsmethoden, 1997, S. 146 ff.
[56]
Anweiler, Auslegungsmethoden, 1997, S. 35, nennt als Grund für die Häufigkeit zu Recht die Lückenhaftigkeit des EU-Rechts. Ähnlich auch Everling, JZ 2000, 217, 220 f., der allerdings zugleich die terminologischen Unklarheiten zwischen Rechtsfortbildung und Auslegung kurzerhand umgekehrt zum Üblichen überwindet, indem er schon die Auslegung mit unter die Rechtsfortbildung fasst (S. 218); kritisch Möllers, EuR 1998, 20.
[57]
Kritisch dazu Schweitzer/Hummer/Obwexer, Europarecht, Rn. 451; differenzierend dagegen Franzen, Privatrechtsangleichung, 1999, S. 358 f.: Während das EU-Recht keine unterschiedlichen Anforderungen an Auslegung und Rechtsfortbildung kenne, müssten bei der Rechtsfortbildung in Deutschland andere Voraussetzungen erfüllt sein als bei der Auslegung. Im Ergebnis die Übereinstimmung von Auslegung und Fortbildung des Rechts betonend Esser, Grundsatz und Norm, 1990, S. 259.
[58]
EuGH Slg. 1975, 261 Rn. 3 (Reich); EuGH Slg. 1985, 3997, LS 1 (Krohn); letztlich ablehnend EuGH NJW 2014, 203 Rn. 39 (Salzgitter); gern wendet der EuGH seine eigenen Urteile „analog“ an, nur EuGH NJW 2013, 2653 Rn. 73 (VG-Wort).
[59]
Aufschlussreich die Untersuchung Ukrows, Richterliche Rechtsfortbildung, 1995, S. 70 ff., 109 ff., der sie zwar als dem EuGH geläufig erwähnt (S. 123 ff.), jedoch offenbar keiner besonderen Analyse für Wert hält.
[60]
Ein Beispiel für einen Fall, in dem eine Analogie durchaus möglich gewesen wäre und der EuGH Überlegungen dazu auffällig unterlassen hat, ist der Fall Berliner Kindl, EuGH Slg. 2000, 1741 (dazu näher unten Rn. 435).
[61]
Zur Staatshaftungsrechtsprechung im Falle der Verletzung der Pflicht zur Umsetzung von Richtlinien vgl. oben Rn. 94.
[62]
Im Gegensatz zu dem üblichen auf Normen (= Regeln) gestützten Analogieschluss Langenbucher, in: Jahrbuch junger Zivilrechtswissenschaftler 1999, S. 65, 79 ff.
[63]
Art. 6 Abs. 2 Klausel-RL enthält nur ein Verbot der Umgehung durch Rechtswahl.
[64]
Differenzierend BeckOK/Maume, BGB, § 312k Rn. 8 f.; MünchKommBGB/Wendehorst, § 312k Rn. 14 f.; anwendend jedoch OLG Schleswig, CR 2003, 300.
[65]
MünchKommBGB/Wendehorst, § 312k Rn. 14 f.
[66]
Riesenhuber/Leible/Domröse, Europäische Methodenlehre, § 8 Rn. 32 ff.
[67]
Übereinstimmung sieht auch Franzen, Privatrechtsangleichung, 1999, S. 455.
[68]
Sie hat also mit den oben (Rn. 108 ff.) vorgestellten Methoden der Auslegung des Unionsrechts selbst nichts zu tun.
[69]
Nur Lutter, JZ 1992, 593, 598; enger offenbar Franzen, JZ 2003, 321, 324, jedenfalls für den Fall, dass konkretere inhaltliche Erwägungen des Gesetzgebers erkennbar sind.
[70]
Gebauer/Wiedmann/Gebauer, Zivilrecht unter europäischem Einfluss, Kap. 4 Rn. 29, 32; Jarass, Grundfragen der innerstaatlichen Bedeutung des EG-Rechts, 1994, S. 6 ff., 9.
[71]
Nochmals Ehricke, RabelsZ 59 (1995), 599, 615 f.
[72]
Dazu, dass die Verletzung der europarechtlichen Umsetzungspflicht durch die Gerichte sogar Sanktionen zur Folge haben kann, schon oben Rn. 95.
[73]
Davon geht auch der EuGH aus, etwa in EuGH Slg. 1990, 4135 LS 2 (Marleasing); bestätigend Basedow, FS Brandner, 1996, S. 651, 657; Jarass, EuR 1991, 211, 216, spricht insgesamt von einer dem EU-Recht durch zulässige Rechtsfortbildung entnommenen Pflicht.
[74]
EuGH Slg. 1990, 4135, 4159 (Marleasing); EuGH Slg. 1994, 3325, 3357 (Faccini Dori); EuGH Slg. 2004, 8835 Rn. 113 (Pfeiffer); EuGH Slg. 2006, 6091 Rn. 108 (Adeneler); zum Ganzen ausführlich Franzen, Privatrechtsangleichung, 1999, S. 340 ff.; Riesenhuber/W.-H. Roth/Jopen, Europäische Methodenlehre, § 13 Rn. 26; Gebauer/Wiedmann/Gebauer, Zivilrecht unter europäischem Einfluss, Kap. 4 Rn. 17 ff.
[75]
EuGH Slg. 2004, 8835 (Pfeiffer); BGHZ 179, 27 (Quelle II); Herrmann, Richtlinienumsetzung durch die Rechtsprechung, 2003, S. 138.
[76]
Jarass, EuR 1991, 211, 216; Lutter, JZ 1992, 593, 605, spricht für einen der Umsetzung entgegenstehenden Willen von einem unbeachtlichen „venire contra factum proprium“.
[77]
Nur BGHZ 179, 27, 35 (Quelle II): „Der Grundsatz der richtlinienkonformen Auslegung fordert deshalb auch, das nationale Recht, wo dies nötig und möglich ist, richtlinienkonform fortzubilden.“
[78]
Zusammenfassend Gebauer/Wiedmann/Gebauer, Zivilrecht unter europäischem Einfluss, Kap. 4 Rn. 37 ff.
[79]
Grundlegend Möllers, EuR 1998, 20.
[80]
EuGH Slg. 2006, 6057 (Adeneler).
[81]
Zu diesem Zusammenhang Lorenz, LMK 2009, 273611; Jarass, EuR 1991, 211 f.; Steindorff, EG-Vertrag und Privatrecht, 1996, S. 450 f.; der EuGH verneinte in EuGH Slg. 1990, 4135 (Marleasing) die unmittelbare Wirkung einer Richtlinie (S. 4145) und sprach aus, dass stattdessen das nationale Recht richtlinienkonform auszulegen sei (S. 4146). Zur fehlenden Direktwirkung privatrechtlicher Richtlinien oben Rn. 90.
[82]
BGHZ 179, 27, 34 f. (Quelle II).
[83]
Ganz h.A.; ausführlich zu den Grenzen der europarechtskonformen Rechtsfortbildung Herresthal, EuZW 2007, 396, 399 f. Für die richtlinienkonforme Auslegung besonders deutlich Herrmann, Richtlinienumsetzung durch die Rechtsprechung, 2003, S. 138; auch Riesenhuber/W.-H. Roth/Jopen, Europäische Methodenlehre, § 13 Rn. 55.
[84]
Herresthal, JuS 2014, 289, 293 m.w.N.
[85]
Deutlich Michael/Payandeh, NJW 2015, 2392, 2395 (gegen Vorrang der Unionstreue); für Eingrenzung auch Riesenhuber/W.-H. Roth/Jopen, Europäische Methodenlehre, § 13 Rn. 57; Langenbucher/Langenbucher, Europäisches Privat- und Wirtschaftsrecht, § 1 Rn. 107; Franzen, Privatrechtsangleichung, 1999, S. 361, 403.
[86]
BVerfG NJW 2012, 669 Rn. 56; Herresthal, JuS 2014, 289, 293, 291 f.; es greifen dann die Instrumente der EU für die Verletzung der Umsetzungspflicht, dazu Rn. 94 ff.
[87]
BVerfG NJW 2012, 669 Rn. 60 ff.
[88]
BGHZ 192, 148; beispielhaft Stürner, Jura 2017, 777, 782; anders Höpfner, JZ 2009, 403, 404 f., der den Umsetzungswillen des Gesetzgebers stets hinter seine konkrete Regelungsabsicht zurücktreten lassen möchte.
[89]
EuGH Slg. 2008, 2713 (Quelle); näher zur Vorlagefrage Rn. 146, 150.
[90]
BGHZ 179, 27.
[91]
Mörsdorf, EuR 2009, 219, 230, sieht eine Grenze der richtlinienkonformen Auslegung in der Umsetzungsverweigerung des nationalen Gesetzgebers; Grosche/Höft, NJW 2009, 2416, äußern Bedenken an der vom BGH vorgenommenen Gleichsetzung des Umsetzungswillens mit dem Regelungswillen des Gesetzgebers. Deswegen könne man sich bei einem entgegenstehenden Regelungswillen nicht auf die vom Gesetzgeber zugleich beabsichtigte Richtlinienkonformität berufen.
[92]
Dafür MünchKommBGB/Wendehorst, § 312j Rn. 33; weitere Möglichkeiten vorschlagend BeckOK/Maume, BGB, § 312j Rn. 31.
[93]
Näher MünchKommBGB/Wendehorst, § 312j Rn. 33.
[94]
Umfassend Gebauer/Wiedmann/Gebauer, Zivilrecht unter europäischem Einfluss, Kap. 4 Rn. 22 f.; Riesenhuber/Habersack/Mayer, Europäische Methodenlehre, § 14 Rn. 41; Mayer/Schürnband, JZ 2004, 545; Palandt/Grüneberg, BGB, Einleitung vor § 1 Rn. 44; anregend Büdenbender, ZEuP 2004, 36, 47 ff., der die Möglichkeit eines europarechtlichen Gebots sehr weit verfolgt.
[95]
Zu dem dabei gelegentlich zutage tretenden übertriebenen Gleichbehandlungsbedürfnis Artz, BKR 2002, 603, 608; zum Sonderfall der kaufrechtlichen Gewährleistung Rn. 522.
[96]
BGHZ 138, 55, 60 f. mit zustimmender Anmerkung von Leible/Sosnitza, NJW 1998, 2507 jedenfalls für den Fall, dass die umzusetzende Richtlinie dem nationalen Gesetzgeber in der betroffenen Frage ohnehin keinen Spielraum lässt; aus dem Schrifttum z.B. Langenbucher/Langenbucher, Europäisches Privat- und Wirtschaftsrecht, § 1 Rn. 108 ff.; Lutter, JZ 1992, 593, 605; dagegen Brechmann, Richtlinienkonforme Auslegung, 1994, S. 264 f.; Ehricke, RabelsZ 59 (1995), 598, 621 f.
[97]
Röthel, ZEuP 2009, 34; auch Leible/Sosnitza, NJW 1998, 2507, 2508; für eine Verpflichtung zur richtlinienkonformen Auslegung auch schon vor Ablauf der Umsetzungsfrist Franzen, Privatrechtsangleichung, 1999, S. 300 f.
[98]
Näher Röthel, ZEuP 2009, 34.
[99]
So auch in EuGH Slg. 2006, 6057 (Adeneler); EuGH Slg. 2005, 9981 (Mangold).
[100]
Eine Gleichsetzung erfolgt in Jarass/Pieroth/Jarass, GG, Art. 23 Rn. 42.
[101]
Dazu oben Rn. 126 ff.
[102]
Insbesondere Odersky, ZEuP 1994, 1.
[103]
Schon Everling, RabelsZ 50 (1986), 193; Flessner, RabelsZ 56 (1992), 243; nachdrücklich Berger, ERPL 2001, 21; auch Taupitz, Europäische Privatrechtsvereinheitlichung heute und morgen, 1993, S. 27 ff.
[104]
So aber Odersky, ZEuP 1994, 1.
[105]
Insb. Coing, Europäisches Privatrecht, Band 2, 1989, einleitend S. 2 ff., sowie umfassend S. 249 ff.; ders., FS Dölle, 1995, S. 25; beschreibend Schulze, ZEuP 1993, 445, 464; anwendend (wenn auch nur für die „vergangenen einhundert Jahre“) Zimmermann, JZ 2000, 853.
[106]
Knütel, JuS 1996, 768.
[107]
Müller-Graff/Schulze, Gemeinsames Privatrecht, 1999, S. 127, 143 ff.; Müller-Graff/Kreuzer, Gemeinsames Privatrecht, 1999, S. 457.
[108]
Anders nur, wenn es um das Aufzeigen solcher Grundsätze geht, die bis heute gelten, dazu Schulze, ZEuP 1993, 442, 460 ff.; solche hat auch der EuGH bereits ausdrücklich erwähnt, relativierend dazu Everling, ZEuP 1997, 796, 801.
[109]
Knütel, JuS 1996, 768, 770 sowie Schulze, ZEuP 1993, 442, 460 ff.
[110]
Müller-Graff/Kötz, Gemeinsames Privatrecht, 1999, S. 155; ders., JZ 2002, 257, 260.
[111]
Von der Groeben/Schwarze/Hatje/Gaitanides, Europäisches Unionsrecht, Art. 267 AEUV Rn. 18.
[112]
Zum Vorabentscheidungsverfahren Pechstein, EU-Prozessrecht, Kap. 9; Rengeling/Middeke/Gellermann/Middeke, Handbuch des Rechtsschutzes in der Europäischen Union, § 10; Prütting, GS Arens, 1993, S. 339 ff.
[113]
Zu der Frage, ob gegen eine Vorlage eines Untergerichts ein Rechtsmittel gegeben sein sollte, Pfeiffer, ZEuP 2007, 613.
[114]
Diese Auffassung lässt auch der EuGH selbst erkennen, vgl. EuGH Slg. 2002, 4839 LS 1 und Rn. 16 (Schweden/Kenny Roland Lyckeskog); Calliess/Ruffert/Wegener, EUV/AEUV, Art. 267 AEUV Rn. 28; Rengeling/Middeke/Gellermann/Middeke, Handbuch des Rechtsschutzes in der Europäischen Union, § 10 Rn. 61; für die abstrakte Abgrenzung Bleckmann, Europarecht, Rn. 921; Dauses, Vorabentscheidungsverfahren, 1995, S. 111.
[115]
Nochmals EuGH Slg. 2002, 4839 LS 1 und Rn. 16 (Schweden/Kenny Roland Lyckeskog); auch von der Groeben/Schwarze/Hatje/Gaitanides, Europäisches Unionsrecht, Art. 267 AEUV Rn. 63; gegen die Einbeziehung der Nichtzulassungsbeschwerde mit guten Gründen Basedow, Nationale Justiz und Europäisches Privatrecht, 2003, S. 13 ff.
[116]
Gerichtskosten für die Entscheidung des EuGH fallen nicht an, für die Verteilung der außergerichtlichen Kosten gilt das nationale Kostenrecht, dazu Rengeling/Middeke/Gellermann/Middeke, Handbuch des Rechtsschutzes in der Europäischen Union, § 10 Rn. 108 ff.
[117]
Ungünstig verlief etwa der Fall Heininger, in dem der BGH die Sache nach der Entscheidung des EuGH an das OLG zurückverwies, welches dann bei erneuten Tatsachenermittlungen einen Sachverhalt feststellte, der die gesamte Vorlage überflüssig gemacht hätte (es lag nämlich keine Haustürsituation vor); in der Sache wie hier App, DZWir 2002, 232, 235; zur Vorlage durch Untergerichte auch Dauses, Vorabentscheidungsverfahren, 1995, S. 101 f.
[118]
Der EuGH hat sich zuletzt häufig mit der verwandten Frage befasst, inwiefern die Nichtigkeit von AGB von Amts wegen geprüft werden muss, obwohl das Gerichtsverfahren (z.B. wie hier im Vollstreckungsverfahren) keinerlei Prüfung vorsieht, siehe nur EuGH EWS 2013, 481 (Banco Popular Español).
[119]
Von der Groeben/Schwarze/Hatje/Gaitanides, Europäisches Unionsrecht, Art. 267 AEUV Rn. 26; Grundmann, Europäisches Schuldvertragsrecht, 1999, S. 124.
[120]
Dauses, FS Everling, 1995, S. 223, 229.
[121]
Das beobachtend auch von der Groeben/Schwarze/Hatje/Gaitanides, Europäisches Unionsrecht, Art. 267 AEUV Rn. 27.
[122]
Schon EuGH Slg. 1964, 1251, 1268 (Costa); EuGH Slg. 1995, 4165 Rn. 19 (Gebhard); EuGH Slg. 2000, 8224 Rn. 16 (Echirolles).
[123]
EuGH Slg. 1998, 7875 Rn. 19 (Ambry), Hervorhebung nicht im Original.
[124]
Schon im Fall Marleasing hat der EuGH klare Aussagen zur Auslegung der betroffenen spanischen Norm (aus dem Gesellschaftsrecht) gemacht, EuGH Slg. 1990, 4135, LS 2; wie hier etwa Hergenröder, FS Zöllner, 1998, S. 1139, 1140 f.; zum Ganzen auch Rengeling/Middeke/Gellermann/Middeke, Handbuch des Rechtsschutzes in der Europäischen Union, § 10 Rn. 41.
[125]
Vgl. nur EuGH Slg. 1999, 2969 Rn. 11 (Anssens).
[126]
Dazu ausdrücklich EuGH Slg. 1998, 4657 Rn. 30 ff. (Gut Springenheide) mit Beispielen.
[127]
So der EuGH selbst, etwa EuGH Slg. 2000, 6579 Rn. 19 (Geffroy); erläuternd EuGH Slg. 2004, 3403 Rn. 23 (Freiburger Kommunalbauten).
[128]
Basedow, AcP 210 (2010), 157 ff.; Lorenz, NJW 2011, 2241.
[129]
Der bekannteste Fall für den Black-Box-Effekt ist der Fall Christel Schmidt (EuGH Slg. 1994, 1311). Dort wurde der EuGH vom BAG gefragt, was ein Betriebsteil im Sinne der Betriebsübergangs-RL ist. Da der Gerichtshof nicht wusste, dass das BAG den Fall einer Teilzeitputzkraft zu entscheiden hatte, machte der EuGH sich keine Gedanken über die Größe und wirtschaftliche Bedeutung des Betriebsteils, sondern stellte allein darauf ab, ob es sich um eine „wirtschaftliche Einheit“ handele. Das aber musste vom BAG für die Putzkraft bejaht werden.
[130]
BGH ZIP 2002, 1197 f.
[131]
Die Verordnung über Abschlagszahlungen bei Bauträgerverträgen vom 23.5.2001, BGBl. I, 981 ff., sieht nunmehr ausdrücklich vor, dass sich die in den AGB der Bauträger vorgesehenen Abschlagszahlungen an § 3 MaBV orientieren, welcher zur Absicherung des Erwerbers insbesondere eine Vormerkung voraussetzt. Zur Vereinbarkeit dieser Regelung mit der Klausel-RL nur Staudinger, DNotZ 2002, 166, 177 ff., der eine Verletzung des europäischen Maßstabs von Treu und Glauben ebenfalls ablehnt.
[132]
BGH NJW 2006, 3200 (Quelle) – zu dem Fall auch schon oben Rn. 123. Zur Problematik der Vorlage noch unten Rn. 173; sehr bemüht auch die Vorlage des OLG Stuttgart ZIP 2006, 1943 zu einer nur noch das alte HWiG betreffenden Frage.
[133]
Prütting, GS Arens, 1993, S. 339, 343.
[134]
Näher zu dieser Problematik ausführlich Dauses, Vorabentscheidungsverfahren, 1995, S. 53 ff., 95 f.; App, DZWir 2002, 232, 234.
[135]
Näher Rengeling/Middeke/Gellermann/Middeke, Handbuch des Rechtsschutzes in der Europäischen Union, § 10 Rn. 90 ff.
[136]
Zu Änderungen der Vorlagepflicht zum EuGH durch den Vertrag von Lissabon Schröder, EuR 2011, 808.
[137]
Das war etwa nicht der Fall bei einer Vorlage des LG Hannover zur Verbrauchsgüterkauf-RL. Hier wäre die Entscheidung des EuGH nicht relevant gewesen, weil es im Ausgangsfall um einem Werkvertrag ging, so dass die Richtlinie gar nicht eingriff, EuGH NJW 2017, 3215 (Schottelius); näher Rengeling/Middeke/Gellermann/Middeke, Handbuch des Rechtsschutzes in der Europäischen Union, § 10 Rn. 47.
[138]
Ständige Rechtsprechung, etwa EuGH NVwZ-RR 2013, 735, Rn. 34 ff. (MA); EuGH Slg. 2005, 10013 Rn. 36 (Mangold); EuGH Slg. 2006, 6091 Rn. 42 (Adeneler) sowie m.w.N. Heß, Europäisches Zivilprozessrecht, § 12 Rn. 20; Dauses, Vorabentscheidungsverfahren, 1995, S. 104 ff.
[139]
EuGH Slg. 1995, 4921, 5060 (Bosman); dazu Kohler, ZEuP 1996, 452, 453.
[140]
Ebenfalls ständige Rechtsprechung, zuletzt deutlich EuGH ZUR 2014, 230, Rn. 27 ff. (Fish Legal).
[141]
In EuGH Slg. 1986, 1885, 1896 f. (Bertini) mahnt der EuGH zwar eine Stellungnahme des nationalen Gerichts zur Entscheidungserheblichkeit an, lehnt aber die Vorlagefrage letztlich trotz deren Fehlens nicht ab; siehe auch EuGH Slg. 1995, 4921, 5060 (Bosman); EuGH Slg. 2004, 4883 Rn. 29 (Plato).
[142]
So Ress, FS Jahr, 1993, S. 339, 347 f., 366.
[143]
Basedow, FS Brandner, 1996, S. 651, 663; ders., AcP 210 (2010), 157, 163 f.
[144]
EuGH Slg. 1982, 3415, LS 5 (C.I.L.F.I.T.); auch EuGH Slg. 1997, 4411 Rn. 15 (Ferriere Nord); EuGH Slg. 2003, 10239 Rn. 118 (Köbler).
[145]
Die Meinungsverschiedenheiten haben allerdings ihre Wurzeln eher darin, dass die Formel des EuGH als zu weit empfunden wird. Dann sollte allerdings klargestellt werden, dass eine Argumentation gegen das C.I.L.F.I.T.-Urteil des EuGH vorliegt und keinesfalls mit diesem. Siehe etwa die Auffassung von Heß, ZZP 108 (1995), 59, 85 f., nur grundsätzliche Rechtsfragen sollten vorgelegt werden; zu Reformdiskussionen Rösler, Europäische Gerichtsbarkeit auf dem Gebiet des Zivilrechts, 2012, S. 319 ff.
[146]
BGH NJW 2005, 1045; BGHZ 110, 47, 68 ff., 72; BGHZ 129, 353, 360 f.; großzügig auch BGHZ 138, 321, 324 (mit einer Übertragung der Entscheidung Dietzinger – zur Haustürgeschäfte-RL – auf die Verbraucherkredit-RL).
[147]
Ausdrücklich weist der EuGH in EuGH Slg. 1997, 4411 Rn. 15 (Ferriere Nord), darauf hin, dass es nicht reicht, wenn die Sprachfassung in einem Mitgliedstaat klar und eindeutig ist.
[148]
So aber BGHZ 129, 353, 360 f.; Coester, FS Heinrichs, 1998, S. 99, 104; Canaris, EuZW 1994, 417; dagegen auch Franzen, Privatrechtsangleichung, 1999, S. 285 f.; Basedow, FS Brandner, 1996, S. 651, 664; Lipp, JZ 1997, 326, 331; auf abweichende Entscheidungen der Gerichte anderer Mitgliedstaaten bezogen Schulze-Osterloh, ZGR 1995, 170, 178 f.
[149]
So auch Basedow, FS Brandner, 1996, S. 651, 664; Franzen, Privatrechtsangleichung, 1999, S. 289. Darauf, dass dieser Zweifel bestehen wird, wenn der EuGH sich im Bereich der betreffenden Rechtsfrage überhaupt noch nicht geäußert hat, weist Hommelhoff hin (BGH-Festgabe, 2000, Band 2, S. 889, 893). Für eine niedrige „Schwelle des Zweifels“ auch Dauses, Vorabentscheidungsverfahren, 1995, S. 97.
[150]
So etwa in EuGH NJW 2015, 927 (Novo Nordisk Pharma), wo es um die Reichweite der Produkthaftungs-RL ging; allgemein Bülow, WM 2013, 245.
[151]
Daneben gibt es einige kollisionsrechtliche Bestimmungen, die verlangen, dass ein „enger Zusammenhang“ zwischen dem Vertrag und dem Mitgliedstaat besteht: Art. 6 Abs. 2 Klausel-RL und Art. 4 Abs. 4 Rom I-VO; genannt wird weiterhin Art. 6 Produkthaftungs-RL (vgl. § 3 ProdHaftG), „Berücksichtigung aller Umstände“.
[152]
Zum Transparenzgebot als Prinzip des Verbrauchervertragsrechts auch noch unten Rn. 260 ff.
[153]
Vorsicht muss hier in Bezug auf die Grundfreiheiten gelten. Steht zu befürchten, dass diese durch die Entscheidung beeinträchtigt werden, so kann sich daraus ein eigenständiger Grund zur Vorlage ergeben!
[154]
Keinerlei Beschränkung der Vorlagepflicht durch die Acte-clair-Doktrin sieht aber Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, 2004, S. 384.
[155]
Umfassend dazu Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, 2004, S. 353 ff.
[156]
So Schulze/Brandner, Auslegung europäischen Privatrechts, 1999, S. 131, 136; Coester, FS Heinrichs, 1998, S. 9, 104; Coester-Waltjen, Jura 1997, 272, 275; Wolf/Horn/Lindacher/Wolf, AGB-Recht, 1999, Art. 3 RL Rn. 2; Basedow, Nationale Justiz und Europäisches Privatrecht, 2003, S. 9 f.; Müller-Graff/Müller-Graff, Gemeinsames Privatrecht, 1999, S. 9, 64; Weatherill, ERPL 1995, 307, 316 ff.
[157]
Franzen, Privatrechtsangleichung, 1999, S. 536 ff.; Heinrichs, NJW 1998, 1447, 1454 f.; Borges, Die Inhaltskontrolle von Verbraucherverträgen, 2000, S. 81; Joerges, ZEuP 1995, 181, 199; H. Roth, JZ 1999, 529, 535 f. (keine Kompetenz des EuGH); eine pragmatische Haltung (Vorlage nur in geeigneten Fällen) vertritt Grabitz/Hilf/Pfeiffer, Das Recht der EU, Band IV, 2009, A 5 Rn. 41.
[158]
W.-H. Roth, FS Drobnig, 1998, S. 135.
[159]
Ebenda, S. 135, 141 ff. Diesen Lösungsweg deutet auch schon Canaris an, EuZW 1994, 417.
[160]
EuGH Slg. 2004, 3403 (Freiburger Kommunalbauten).
[161]
Ebenda, Rn. 21.
[162]
BGH ZfIR 2005, 300; zu einer anderen Konstellation BGH NJW-RR 2005, 1292.
[163]
EuGH Slg. 2000, 4941 Rn. 21 ff. (Océano). Der EuGH fand, bei der dort zu prüfenden Gerichtsstandsklausel stehe das Missverhältnis außer Frage; so ausdrücklich auch in der Entscheidung Freiburger Kommunalbauten, EuGH Slg. 2004, 3403 Rn. 23.
[164]
EuGH Slg. 2009, 4713 (Pannon); EuGH Slg. 2010, 10847 (VB Pénzügyi Lízing).
[165]
Ähnlich wie hier Pfeiffer, NJW 2009, 2369.
[166]
Näher Riesenhuber/Röthel, Europäische Methodenlehre, § 11 Rn. 12 ff.
[167]
Nur Staudinger/Wendland, BGB, § 307 Rn. 119.
[168]
Nochmals EuGH Slg. 2004, 3403 Rn. 21 (Freiburger Kommunalbauten); Franzen, Privatrechtsangleichung, 1999, S. 554 ff.
[169]
BGH NJW 2006, 3200.
[170]
So auch Lorenz, NJW 2006, 3203.
[171]
EuGH Slg. 2000, 1741 (Berliner Kindl); Art. 2 Abs. 1 lit f) der alten Verbraucherkredit-RL; vgl. auch die Entscheidung Heininger, EuGH Slg. 2001, 9945 und dazu ausdrücklich BGHZ 150, 248.
[172]
Schulze/Schulze, Auslegung europäischen Privatrechts, 1999, S. 9, 18 f.
[173]
Noch deutlicher Schulze, ebenda.
[174]
EuGH Slg. 2006, 371 (Ynos).
[175]
Vgl. zu den Entscheidungen des EuGH schon vorstehend; siehe ausführlich auch EuGH Slg. 1997, 4291 Rn. 23 ff. (Giloy); EuGH Slg. 1997, 4161, LS 1 (Leur-Bloem); aus dem Schrifttum nur Büdenbender, ZEuP 2004, 36, 53 ff.
[176]
EuGH Slg. 1995, 615 (Kleinwort Benson); zur Abgrenzung auch EuGH Slg. 2003, 1 Rn. 89 ff. (BIAO).
[177]
EuGH Slg. 1999, 7748 Rn. 19 ff. (Pfennigmann).
[178]
Das Übereinkommen betrifft Gebühren für die Nutzung von Straßen und bezieht sich auf die Richtlinie 93/89/EWG des Rates vom 25. Oktober 1993 über die Besteuerung bestimmter Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung sowie die Erhebung von Maut- und Benutzungsgebühren für bestimmte Verkehrswege durch die Mitgliedstaaten (ABl. 1993 L 279 S. 32).
[179]
Vgl. nur EuGH Slg. 1998, 7083 (Hartmann); dazu auch EuGH Slg. 1999, 7748 Rn. 19 ff. (Pfennigmann) – das ist unproblematisch, da das Abkommen eindeutig kein EU-Recht ist.
[180]
BVerfGE 133, 277 Rn. 91; hinweisend auch BVerfGE 135, 155 Rn. 177.
[181]
BVerfGE 73, 366 (Solange II); BVerfGE 135, 155 Rn. 177 ff.
[182]
Im Ergebnis ebenso Schnorbus, RabelsZ 65 (2001), 656, 700 ff.
[183]
BVerfGE 75, 223, 245; BVerfGE 135, 155 Rn. 177 ff.
[184]
Calliess, NJW 2013, 1905; Finck/Wagner, NVwZ 2014, 1286; auch BVerfG NJW 2010, 1268, dazu Thomale, JuS 2010, 339 (Klausur).
[185]
So BVerfG NJW 2001, 1267 f.; skeptisch zur Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde insgesamt Hirte, Wege zu einem europäischen Zivilrecht, 1996, S. 43 f. m.w.N.; zur jüngeren Rechtsprechung vgl. auch BVerfG NJW 2011, 288, Rn. 45 ff.; mit Anmerkung Bäcker, NJW 2011, 270.
[186]
Heß, ZZP 108 (1995), 59, 69; Dauses, Vorabentscheidungsverfahren, 1995, S. 153 ff.; Everling, Vorabentscheidungsverfahren, 1986, S. 63 ff.; Rengeling/Middeke/Gellermann/Middeke, Handbuch des Rechtsschutzes in der Europäischen Union, § 10 Rn. 101; anders aber Pechstein, EU-Prozessrecht, Rn. 866 ff. sowie auch Rn. 906 f., der für die Auslegungsfrage von einer echten Rechtskraft „erga omnes“ ausgehen will.
[187]
Siehe z.B. EuGH Slg. 1981, 1191 (ICC); EuGH Slg. 1986, 947 (Wünsche); dazu auch Rengeling/Middeke/Gellermann/Middeke, Handbuch des Rechtsschutzes in der Europäischen Union, § 10 Rn. 102; Everling, Vorabentscheidungsverfahren, 1986, S. 61; genauer Dauses, Vorabentscheidungsverfahren, 1995, S. 148 ff. Zur Wirkung grundlegend BVerfGE 73, 339, 370 (Solange II); anwendend z.B. BVerfGE 75, 223, 234.
[188]
Von einer „Einheit“ spricht Prütting, GS Arens, 1993, S. 339, 343. Zum Charakter als Zwischenverfahren schon soeben Rn. 153.
[189]
Everling, Vorabentscheidungsverfahren, 1986, S. 66; Dauses, Vorabentscheidungsverfahren, 1995, S. 155; ähnlich auch von der Groeben/Schwarze/Hatje/Gaitanides, Europäisches Unionsrecht, Art. 267 AEUV Rn. 90 ff., die von einer nur tatsächlich rechtsbildenden Kraft spricht.
[190]
So vor allem Pechstein, EU-Prozessrecht, Rn. 862 ff.
[191]
So hat er, ganz im Gegensatz zu dem in Deutschland üblichen Verständnis (und über § 11 UKlaG hinausgehend), entschieden, dass die Wirkung eines Urteils, das die Nichtigkeit einer AGB feststellt, von Amts wegen auch allen anderen von der Klausel betroffenen Verbrauchern zugutekommen müsse, EuZW 2012, 786 (Invitel).
[192]
Hergenröder, FS Zöllner, 1998, S. 1139, 1143 f.; Rengeling/Middeke/Gellermann/Middeke, Handbuch des Rechtsschutzes in der Europäischen Union, § 10 Rn. 104.
[193]
Ähnlich Langenbucher, in: Jahrbuch junger Zivilrechtswissenschaftler 1999, S. 65, 76. Zu „rechtskulturellem Widerstand“ gegen diese Rechtslage hat Bydlinski, BGH-Festgabe, 2000, Band 1, S. 3, 6 aufgerufen. Er erkennt in den Entscheidungen des EuGH eine Bindungswirkung, die stärker sei als die gesetzliche, weil selbst eine Überprüfung auf ihre Verfassungsmäßigkeit nicht möglich sei.
[194]
Denn dann liegt ein offenkundiger und erheblicher Verstoß gegen EU-Recht vor, vgl. ausführlich die Entscheidung EuGH Slg. 1996, 1026, 1032 (Brasserie du Pêcheur); anwendend etwa auch EuGH Slg. 1998, 1531, 1534 (Norbrook Laboratories).
[195]
Ablehnend m.w.N. EuGH Slg. 2010, 10309 Rn. 33 ff. (Albron Catering); EuGH Slg. 2010, 2735 Rn. 91 ff. (Bressol); EuGH Slg. 2006, 199 Rn. 49 ff. (Skov); besonders umstritten war die Frage des Wirkungsbeginns der Urteile des EuGH für die in einigen Mitgliedstaaten (wie in Deutschland) geltenden Wettverbote, dazu EuGH Slg. 2007, 2271 (Unibet) sowie aus deutscher Sicht BVerfGE 115, 276.
[196]
Gelegentlich wird ein Vergleich zum BVerfG gezogen. Dort bietet allerdings § 31 BVerfGG eine klare und zugleich differenzierende Rechtsgrundlage.
[197]
Nochmals Bydlinski, BGH-Festgabe, 2000, Band 1, S. 3, 6 f.
[198]
EuGH Slg. 1981, 1191 (ICC); auch schon EuGH Slg. 1963, 63, 81 (Costa).
[199]
Art. 99 VerfO-EuGH; dazu z.B. EuGH EuZW 2015, 28 Rn. 12 f. (BestWater International).