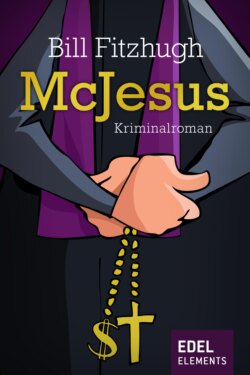Читать книгу McJesus - Bill Fitzhugh - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеGeduckt hinter einem gewaltigen Laster, hatte Dan Steele nur einen Gedanken. »Wie zum Teufel ist sie an die Kanone gekommen?«
Der Mann in dem weißen Jackett, der sich neben ihm hinter dem Laster versteckte, zuckte die Schultern. »Woher soll ich das wissen? Wir sind in L.A.«
Dan zupfte an seinem Kinnbart, während er überlegte, was er mit dieser Frau machen sollte, die im Pflegeheim eine Geisel genommen hatte und sich jetzt mit einer Waffe hinter dem Steuer eines Sechszylinder-Pontiac verschanzte. Dan hatte in seinem Job täglich mit Krisen zu tun; und gewöhnlich war er ruhig und konzentriert, wenn irgendwo Sand ins Getriebe kam, aber das hier war ein anderes Kaliber. Das hier schien Dan persönlich zu nehmen.
Es war erst kurz nach zehn, aber bereits dreißig Grad heiß. Celsius. Für das San Fernando Valley bedeutete das: ein neuer elender Tag mit gelbbrauner Heißluft und zu erwartendem Smogalarm. Dan richtete sich vorsichtig auf, bis er sich im Seitenspiegel des Lasters sehen konnte. Dass er wie ein verschwitzter Cop in einem guten Anzug aussah, fand er den Umständen angemessen, obwohl er in Wirklichkeit Kreativdirektor einer Werbeagentur war.
Äußerlich betrachtet war Dan ein Typ, den man bei einer Bierwerbung mit kickenden Fußballern sehen würde, im Gegensatz zu den weniger gut aussehenden Mitspielern, die nur als Spot-Hintergrund dienen würden. Im College zählte er zu den guten Schwimmern. Inzwischen hatte er ein bisschen Fett angesetzt, aber Schwimmringe hatte er nicht. Die bogenförmigen Stirnfalten, die wie kleine Wellen von seinen Augenbrauen ausgingen, ließen ihn wie einen fröhlichen Menschen aussehen, auch wenn das im Augenblick nicht seiner Stimmung entsprach. Sein dunkles Haar war modisch gestylt. Mit einem passablen Körper, einer gepflegten Erscheinung und einem nicht zu knappen Einkommen schien Dan alles zu haben, was das Herz begehrt. Doch er war lange genug in der Werbebranche, um besser als mancher andere zu wissen, dass die Dinge nicht immer das waren, was sie zu sein schienen.
Er schob die Armani-Sonnenbrille auf seinem glatten Nasenrücken ein Stückchen höher. Dann blickte er schnell über die Motorhaube des Trucks. Die Frau und ihre Geisel waren zehn Meter entfernt. Dan duckte sich wieder und wandte sich an den Mann in dem weißen Jackett. »Okay, wir machen es so«, sagte Dan, als führte er hier das Kommando. »Ich lenke sie ab. Sie schnappen sie sich.«
»Sie schnappen sie.«
Dan verhehlte nicht seine Verärgerung. Was bildete sich dieser Sechs-Dollar-die-Stunde-Knilch ein? Aus Gewohnheit taxierte er den Mann nach Marketing-Lifestyle-Segmenten: ledig, Highschool-Abschluss, Mietshauswohnung, häuslicher Biertrinker, Sportsendungen, untere Mittelklasse, Nichtwähler – ein perfektes Exemplar aus der Gruppe, die im Werbegeschäft »langweilige Stadt-Singles« hießen. Und war das gegenwärtige Szenario nicht ein perfektes Beispiel dafür, warum demografische Unterscheidungen überhaupt gemacht wurden? Leute wie Dan Steele rannten nicht hinter Lastwagen hervor, um bewaffnete Verrückte zu überwältigen. Das war eine Aufgabe für gemietete Polizisten und andere ehrgeizige Kleinverdiener. Leider teilte der Mann in dem weißen Jackett Dans sozialdarwinistische Ansichten nicht, und Dan saß in der Patsche.
Er legte die Hände trichterförmig um den Mund und rief. »Also gut, jetzt reicht es! Auf drei kommen wir raus! Das ist deine letzte Chance!« Er wartete kurz, um zu sehen, ob die Sache geritzt war, aber die Geiselnehmerin reagierte nicht. Dan nahm einige Scheine aus seiner Jackentasche und wandte sich an den langweiligen Stadt-Single. »Sie gehen da hin«, sagte er und zeigte nach Osten. »Und ich gehe da hin.« Er zeigte nach Westen. Dann drückte er dem Mann zwei Zwanziger in die Hand. Der Mann nickte, und Dan begann zu zählen: »Eins! Zwei!« WUMM! WUMM! Bei dem satten Ton der zwei auf der anderen Seite ihres Verstecks einschlagenden Patronen zuckte Dan zusammen. »Drei!« Dan drehte sich zu dem Mann in Weiß um. »Los!« Der Mann stopfte sich die vierzig Dollar in die Tasche und rannte los. Er hatte sich höchstens vier Schritte von dem Laster entfernt, als die Frau erneut schoss. Blutrot explodierten die Schüsse auf dem weißen Jackett des Mannes. Er taumelte rückwärts und ging neben Dan zu Boden. »Großer Gott!« Damit hatte Dan nicht gerechnet – nicht mit eiskaltem Mord. Augen und Mund des Mannes standen weit offen. Er war dreimal getroffen. Sein Atem ging stoßweise, während er mit der Hand die blutige Brust betastete. »O mein Gott! O mein Gott!«
»Ich glaub das nicht!«, rief Dan. »Sie ... sie hat Sie erschossen!«
Das Gesicht des Mannes entspannte sich etwas. Plötzlich sah er nicht wie jemand aus, der drei Kugeln in den Oberkörper bekommen hatte. »Warten Sie mal ...« Der Mann untersuchte seine Wunden, dann steckte er den blutigen Finger in den Mund und schmeckte, was da so rot war. Er spuckte aus.
Dan begriff, dass hier etwas nicht stimmte. Er streckte die Hand aus, um die Wunden selbst zu untersuchen. »Was zum Teufel ist das?« Er rieb das Blut zwischen den Fingern, dann roch er daran. »Sie schießt mit Farbpatronen?«
Der Mann im weißen Jackett richtete sich verwirrt auf. »Sie hat gesagt, dass sie bewaffnet ist. Sie hat nicht gesagt, womit.« Plötzlich packte der Mann Dan am Hemd und zog ihn dicht an sich heran. »He, Sie Arschloch«, sagte er. »Sie sind nicht losgerannt.« Er war stinksauer. »Sie haben gesagt: Auf drei! Und einen Scheiß sind Sie losgerannt!«
»Bin ich doch«, beharrte Dan. »Aber ich – eh ... Ich habe mir den Knöchel verstaucht.« Er rieb sich den Fuß und verzog das Gesicht. »Au! Ich glaube, er ist ziemlich schlimm verstaucht.« Vorsichtig tastete er seinen Knöchel ab. »Er könnte auch gebrochen sein. Da bin ich mir gar nicht so sicher.«
»Mhm.« Der langweilige Stadt-Single kaufte ihm die Geschichte nicht ab. »Und was jetzt?«
Dan versuchte, sich eine salomonische Lösung auszudenken, als sein Handy piepte. Dan wischte seinen roten Finger an der weißen Jacke des Mannes ab, dann zog er das Handy wie einen Revolver. »Steele.«
»Welche willst du zuerst hören?« Es war Rose, seine Assistentin in der Werbeagentur. Ihr Lieblingsspiel war »Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten«.
»Die schlechte«, sagte Dan. Er hörte einen Moment zu, dann blickte er Hilfe suchend zum Himmel. »Was?« Er lehnte den Kopf gegen die Lastwagentür. »Das ist doch ein Witz.«
»Nein«, sagte sie. »Ich mache keine Witze. Ich habe keine Zeit, Witze zu machen bei all der Arbeit, die mir mein idiotischer Boss aufbrummt, und besonders nicht angesichts der Tatsache, dass sein idiotischer Boss soeben alle Abteilungsleiter zu einer Dringlichkeitssitzung einberufen hat. In einer halben Stunde hast du hier zu sein.«
Dan spähte über den Laster zur Geiselnehmerin. »Hör zu, Rose. Ich muss mich hier noch mit einem kleinen Problem herumschlagen. Ich komme, sobald ich kann.«
»Du wirst dich mit dem Problem ›Arbeitslosigkeit‹ herumschlagen müssen, wenn du deinen traurigen Hintern nicht rechtzeitig ins Büro schaffst.«
Dan fragte sich, womit er das alles verdient hatte. »Rose, Darling, tu mir einen Gefallen und spiel auf Zeit. Melde eine Bombendrohung, mach ein kleines Feuer. Sei kreativ!«
»Bei meinem Gehalt? Vergiss es. Aber jetzt die gute Nachricht. Beverly Dingsda oder wie sie heißt hat angerufen. Sie ist in der Stadt und will dich sehen. Eiteitei. Du hast noch neunundzwanzig Minuten.« Klick.
Dan lächelte plötzlich und dachte an ganz andere Dinge, während er sein Handy in das weiche, warme Etui steckte. Das war in der Tat eine gute Nachricht. Beverly war die Frau seiner feuchtesten Träume. Sie war eine Werbespot-Regisseurin mit dem Körper einer Pornoqueen. Bei einem Essen vor ein paar Monaten, als sie bei einem von Dans Fernsehspots Regie führte, gestand sie, dass sie einen exotischen sexuellen Appetit habe, der noch nie richtig befriedigt wurde. Seitdem war kein Tag vergangen, an dem Dan nicht an ihr Geständnis und die darin enthaltenen Möglichkeiten dachte. Beverly hatte versprochen, Dan anzurufen, wenn sie das nächste Mal in der Stadt sein würde. Und siehe da! Sein Tag war gekommen.
Jetzt musste er nur noch dieses Geiseldrama beenden und rechtzeitig zur Sitzung erscheinen. Doch er wusste auch, dass es praktisch unmöglich war, in weniger als dreißig Minuten von Northridge nach Century City zu kommen, selbst wenn er sich sofort auf den Weg machte. Er brüllte über den Lastwagen hinweg: »Ich habe keine Zeit mehr für diesen Quatsch! Also, was ist jetzt?«
Die Frau brüllte zurück. »Lebendig kriegt ihr Bullen mich nicht!« Sie lachte verrückt wie ein gackerndes Huhn.
»Großartig«, sagte Dan. »Jetzt ist sie James Cagney.« Dan hatte schon viel zu viel Zeit mit dieser Sache verschwendet. Er hatte andere Dinge, wichtigere Dinge, zu tun, und von diesen hier hatte er die Schnauze gestrichen voll. Er war sich nicht sicher, was ihn mehr ärgerte: dass er sich mit dieser verrückten Frau auseinander setzen musste oder dass er jemanden bezahlt hatte, es für ihn zu tun. Ich reiße mir den Arsch auf für das Geld, das ich kriege, dachte er. Warum bekomme ich so wenig für mein Geld? Wo ist die Beschwerdeabteilung? Dan legte die Hände um den Mund und brüllte erneut: »Ich komme jetzt rüber und dann reden wir! Und untersteh dich zu schießen!« Dan wartete auf eine Antwort, aber es kam keine. »Ich bin unbewaffnet!«
Der Mann im weißen Jackett sah Dan an. »Sind Sie verrückt? Sie wird Ihnen diesen Anzug ruinieren.«
»Ja«, sagte Dan. »Manchmal kommt man sich wie ein Idiot vor und manchmal nicht.« Er zog sein Jackett aus und hängte es an den Seitenspiegel. Dann wappnete er sich innerlich und richtete sich auf. Eine Sekunde später explodierte eine dunkelrote Farbpatrone auf seinem blütenweißen gestärkten Hemd. Er holte tief Luft. »Verdammt«, schrie er. »Wirf die Knarre weg, Mom. Die Show ist gelaufen!«
Fünf Minuten später stand Dan wie ein zorniges Performance-Kunstwerk im Büro des Altenheims. Sein Hemd war ruiniert, seine Laune nicht minder. Er holte sein Scheckbuch hervor und warf einen Blick auf die Schwester hinter dem Schreibtisch. Demografisch war sie »Stadtmitte Dienstleistung«. Sie war eine Dosenfutter essende, Massenblätter lesende, nicht ganz allein stehende Mieterin mit stark überzogenem Dispositionskredit. »Können Sie ihr nicht mehr Thorazin oder etwas Ähnliches geben?«, fragte Dan.
»Ihre Mutter bekommt kein Thorazin«, erwiderte die Schwester. »Sie ist auf Divalproex Natrium.«
Und das aus gutem Grund. Nach jahrzehntelangen, immer stärkeren Stimmungsschwankungen hatte man bei Dans Mom eine Zyklothymie diagnostiziert. Sie war manisch-depressiv und ein Paradebeispiel für das, was in der Psychiatrie als periodisches Irresein bezeichnet wird. In ihren manischen Phasen war sie wundervoll. Die Manie äußerte sich gewöhnlich in harmlosen Eskapaden wie zum Beispiel einer Geiselnahme mit einer Farbpistole in dem Heim, wo sie lebte. Auf der anderen Seite konnten ihre Depressionen lähmend sein. Ein überwältigendes Gefühl von Verzweiflung und Leere nahm ihr jedes Interesse an einer Tätigkeit. Sie hatte keinen Appetit, und wenn die Depression ohne Behandlung verlief, konnte sie im Nu bis zu fünfzehn Pfund abnehmen, und das bei einem Körper, der sich eine solche Radikalkur nicht leisten konnte. Manchmal war sie vom Tod besessen. In ihrem Krankenbericht wiederholte sich der Eintrag »suizidgefährdet«.
Ihr Name war Ruth. Als Dan und sein Zwillingsbruder Michael Kinder waren, hatten sie ihre Mutter mehr als einmal weinend und in Fötusstellung auf dem Fußboden liegend gefunden.
Weil sie keine Vergleichsmöglichkeit hatten, nahmen sie an, jede Mom würde sich so benehmen. Doch schon damals war Ruth eine von vielen Millionen, die an einer nicht diagnostizierten Gemütskrankheit litten. In ihrer Ahnungslosigkeit und weil ihr gar nichts anderes übrig blieb, hatte sie einfach versucht, damit klarzukommen – auch wenn sie nicht dahinter kam, warum sie sich so oder so fühlte, und sich selbst die Schuld dafür gab –, um ihre zwei Jungen großzuziehen, deren Vater verschwunden war und der sie am Rand der Armutsgrenze zurückgelassen hatte.
Die Armut hasste Dan am meisten, damals und heute – wenigstens dachte er das. Weil sie arm waren, mussten sie sich erniedrigen und Almosen annehmen. Armut und Erniedrigung waren in der Tat das, worunter Dan in seiner Kindheit am stärksten litt. Und weil er auch vor dem Fernseher aufwuchs, wurde er permanent von Werbespots berieselt, die er als armer Junge nur als Hohn und Spott empfinden konnte. Als er von der Highschool abging, war Dan wie alle amerikanischen Teenager ungefähr 360 000-mal mit Werbung für die begehrenswerten und begehrenswert machenden Produkte konfrontiert worden, die für den amerikanischen Konsumenten zu haben waren – aber nicht für ihn. Als Kind wünschte sich Dan nichts mehr, als schnell erwachsen zu werden und Konsument zu sein, um all die Sachen zu haben. Wenn er das alles hatte, dachte er, dann würde er glücklich sein und bräuchte sich nie mehr zu erniedrigen.
Als Dan und Michael älter wurden, erkannten sie, dass das Verhalten ihrer Mutter nicht normal war, und brachten sie zu einem Arzt. Genauer gesagt gingen sie mit ihr zu mehreren Ärzten, von denen jeder eine andere Diagnose stellte. Der erste sagte, sie sei manisch-depressiv III; der zweite hielt sie für manisch-depressiv I, der dritte für manisch-depressiv II. Es sei eben keine exakte Wissenschaft, sagten sie. Und obwohl diese Diagnosen nicht übereinstimmten, kamen sie der Sache doch so nah, dass Ruth geholfen werden konnte.
Eine Weile bekam sie Lithium, aber nachdem dieses Medikament bei Patienten, die »rasch zirkulierten« – was bei Ruth in letzter Zeit der Fall gewesen war –, nicht so gut wirkte, wurde sie auf Divalproex umgestellt, das tadellos wirkte, solange sie es nahm.
»Nun gut, dann geben Sie ihr mehr Divalproex«, sagte Dan zu der Schwester. Er blickte nervös auf seinen Kontostand. Nur gut, dass ich zwei Jobs habe. Er brauchte den Doppelverdienst, um sich seinen gehobenen Lebensstil leisten zu können und für seine Mutter das Heim und die Psychopharmaka zu bezahlen. Es läuft immer aufs Geld hinaus, dachte er.
»Sie braucht keine höhere Dosis«, sagte die Schwester. »Sie muss nur das, was wir ihr geben, auch nehmen. Und das tut sie nicht immer.« Mit ihrem Ton wollte die Schwester Dan sagen, wenn es ihm nicht passe, wie man sich hier um seine Mom kümmerte, könne er sie ohne weiteres mitnehmen und selbst sehen, wie schwierig sie war.
Der langweilige Stadt-Single mit seiner verschmierten Jacke stand ein paar Schritte entfernt und hielt Ruth energisch am Arm fest. Sie wand sich wie ein großer ergrauter Köderfisch an der Angel. Ruth war Mitte sechzig, aber sie sah älter aus. Sie hatte silbrig-blaue Augen, aus denen die gleiche Zähigkeit und Mutwilligkeit sprach, die ihre zierliche Figur ausdrückte. »Ich verstehe nicht, was die ganze Aufregung soll«, sagte sie. »Ich habe mich nur ein bisschen amüsiert. Warum kann ich nicht bei dir wohnen?«
Dan schrieb einen Scheck aus und sagte, ohne seine Tätigkeit zu unterbrechen: »Mom, du weißt, ich liebe dich. Aber ich bin kein Babysitter. Und wenn du dich erinnerst, habe ich eine wichtige Präsentation verpasst, als die Polizei dich damals beim Joggen auf dem Sunset Boulevard aufgegriffen hat.«
»Ich habe mir nur Bewegung verschafft«, sagte Ruth trotzig.
»Wie es der Doktor verlangt hat.«
»Du warst splitternackt«, sagte Dan.
»Ja, das war ich, nicht wahr?« Ruth lächelte selig. Dann drückte sie auf die Schuldgefühltube. »Michael würde sich um mich kümmern.«
Dan hörte auf zu schreiben und sah seine Mutter an. »Ja, Mom, aber er ist nicht hier, oder?« Er nahm sich nicht die Mühe, seine Verbitterung zu verstecken. Sein eineiiger Zwillingsbruder hatte sich aus dem Staub gemacht und ihm die alleinige Sorge für ihre Mom überlassen, sowohl in finanzieller als auch emotionaler Hinsicht. Dan riss den Scheck aus dem Heft und gab ihn der Schwester.
Der langweilige Stadt-Single wandte sich ab, um Ruth wegzubringen. »Sie sollten etwas Eis auf den verstauchten Knöchel legen«, sagte er über die Schulter.
Die Schwester warf einen Blick auf Dans Scheck. »Tut mir Leid, Mr. Steele. Es sind jetzt viertausend pro Monat.«
Die Frau, die dem Kreditsachbearbeiter gegenübersaß, trug Ordenstracht. Im Gegensatz zu den meisten Nonnen, die sich für das Tragen von Alltagskleidung entschieden hatten, trug Schwester Peg immer noch Tracht und besonders, wenn sie zur Bank gehen musste. Sie erhoffte sich davon einen gewissen Rührungseffekt, weil die meisten Menschen romantische Vorstellungen über Nonnen hatten.
Früher war die Ordenstracht einer Nonne eine so deutlich ausgeprägte Uniform, dass jemand, der sich damit auskannte, schon auf eine Entfernung von hundert Metern sagen konnte, ob eine Nonne dem Dritten Orden des heiligen Franz von Assisi oder den Schwestern Unserer Lieben Frau von Namur angehörte. Man konnte sie ebenso wenig verwechseln wie einen Baseballdress mit einem Hockey-Outfit.
Schwester Pegs Habit war einzigartig. Die Falten hatten etwas von den Barmherzigen Schwestern, Schulterpasse und Kräuselung des Oberteils von den Karmeliterinnen, und die losen Ärmel erinnerten an die Weißen Schwestern des Kardinals Lavigeri. Ihre Tracht vermittelte den Eindruck von Gottesfürchtigkeit, Frömmigkeit und Entschlossenheit. Auch wenn es vielleicht nicht möglich war, den Orden zu bestimmen, dem Schwester Peg angehörte, war sie zweifellos eine Nonne oder genauer gesagt eine Ordensschwester, weil Nonnen ein feierliches Gelübde ablegen und gewöhnlich in Klausur leben, während die Schwestern, wenn sie wollen, Blue Jeans tragen und zu Starbucks gehen können.
Das Gesicht von Schwester Peg, das unter einer Haube hervorschaute, die zu einem Teil minoritisch anmutete und zu zwei Teilen denen der Reformierten Zisterzienserinnen von La Trappe glich, war süß und sanft. Sie war vielleicht Ende zwanzig oder Anfang dreißig – es war schwer zu sagen, weil ihre Kleidung nur Hände und Gesicht frei ließ. Aber unter all den Verhüllungen war Schwester Peg möglicherweise eine ganz hübsche Frauensperson.
Doch für Mr. Larry Sturholm spielte das alles keine Rolle. Er musste sich um die Geschäfte kümmern, und im vorliegenden Fall ging es um die ausstehenden Zahlungen für eine Hypothek, auf der Schwester Pegs Name stand. Larry saß hinter seinem schäbigen Sachbearbeiterschreibtisch im Erdgeschoss einer Bankfiliale in einer unansehnlichen Gegend des San Fernando Valley. Er war mager, was seinem bescheidenen Einkommen entsprach, und sein Hemdkragen saß locker um seinen Hühnerhals. Mr. Sturhooms Augen schienen für ihre Höhlen eine Nummer zu groß und sahen aus, als könnten sie ihm jeden Moment herausfallen.
Schwester Peg saß Mr. Sturholm gegenüber und fingerte an ihrem Rosenkranz, während Larry in seinen Unterlagen blätterte. Schließlich blickte er auf. »Verzeihen Sie, Schwester, was sagten Sie eben?« Er schien recht gutmütig zu sein.
»Also, es ist so«, begann sie. »Als ich das letzte Mal hier war, habe ich mit einer Mrs. Barclay gesprochen, und sie sagte, nachdem ich guten Willen bewiesen hätte und zahlte, was ich zahlen konnte, würde uns die Bank die Hypothek nicht kündigen. Aber dann erhielten wir diese gerichtliche Verfallserklärung. Und deshalb bin ich hier.« Sie lächelte schüchtern und fuhr mit ihren stummen Gebeten fort.
»Haben Sie gesagt: ›uns‹?« Mr. Sturholm runzelte verwirrt die Stirn und sah sich die Akte nochmals an. »Ich verstehe nicht, was Sie mit ›uns‹ meinen. Ihr Name ist als einziger eingetragen.« Er drehte den Ordner um, damit Schwester Peg selbst Einblick nehmen konnte.
»Nun ja, theoretisch bin ich diejenige, die mit den Zahlungen im Verzug ist«, sagte sie. »Mit ›uns‹ habe ich die Leute im Care Center gemeint. Die Menschen, um die ich mich kümmere.«
»Oh, natürlich«, sagte er mit einem leisen Lachen. »Diese Art von ›uns‹. Ich dachte schon, Sie meinten, da gäbe es noch jemand anderen, der bezahlen könnte.« Er blickte wieder in seine Unterlagen. Dann sah er Schwester Peg an. »Schwester, sagen Sie, in welcher Verbindung stehen Sie zur katholischen Kirche?«
Schwester Peg blickte erschrocken auf. »Wie meinen Sie das? Ich bin eine Nonne.« Sie sagte das, als gäbe es dazu nicht mehr zu sagen.
»Ich habe mich nur gefragt, ob ich nicht mal mit jemandem in der Diözese wegen dieser Zahlungsprobleme sprechen sollte. Sind Sie dort in einem Angestelltenverhältnis?« Er blätterte in den Papieren, als suche er etwas, dann blickte er lächelnd auf. »Wissen Sie, ich war bis zur zehnten Klasse in einer katholischen Schule. Bei den guten alten Barmherzigen Schwestern, die Sie bestimmt auch kennen.«
Schwester Peg lächelte ängstlich und nickte, ohne Larry anzusehen.
Larry deutete auf sie. »Sie gehören nicht zu ihnen, richtig? Ich meine, ich erkenne das an Ihrer Tracht. Es sei denn, sie hat sich verändert. Ist schon eine Weile her, dass ich in der zehnten Klasse war.« Er verdrehte die Augen und wandte sich wieder seinem Ordner zu. »In welchem Orden sind Sie?«
Schwester Peg ließ die Hände in den Schoß fallen und versuchte, nicht allzu verzweifelt auszusehen. Sie fragte sich, warum solche Sachen für die Leute so wichtig waren. »Mr. Sturholm. Es ist unwichtig, welchem Orden ich angehöre. Wichtig ist, das Care Center über Wasser zu halten.«
Larry zuckte die Achseln. Sie benahm sich wie eine Nonne, dachte er, das war schon mal sicher. Er blätterte einige Seiten weiter, las ein paar Klauseln des Vertrags; dann deutete er auf eine Stelle. »Ah, hier ist es«, sagte er. »Jetzt sehe ich das Problem.« Er schüttelte traurig den Kopf, als handelte es sich um einen Fehler, der häufig gemacht wurde.
Schwester Peg war erleichtert. »Wundervoll«, sagte sie. »Ich wusste, es konnte sich nur um eine Verwechslung handeln. Ich weiß, wie so etwas passieren kann.« Ihr Rosenkranz rückte eine Perle weiter.
»Das Problem war Mrs. Barclay«, sagte Larry. »Sie wurde vor zwei Monaten entlassen, und ich habe jetzt die von ihr bearbeiteten Kredite geerbt.« Er wies auf einen hohen Aktenstapel an einer Ecke seines Schreibtischs.
»Man hat sie gefeuert?«, sagte Schwester Peg überrascht. »Aber sie war so zuvorkommend.«
»Jaja«, sagte Larry traurig. »Es heißt, sie sei recht freundlich gewesen.« Er faltete die Hände auf seinem Schreibtisch. »Glauben Sie mir, Schwester, ich wünschte, wir könnten unser Geld einfach verschenken. Aber ... Nun, ich denke, Sie werden das verstehen.«
Larry lächelte Schwester Peg freundlich an. »Ich wünschte, ich könnte etwas für Sie tun, Schwester. Ehrlich. Aber es ist meine Aufgabe, alle rückständigen Zahlungen einzutreiben.« Mr. Sturholm hob die Hände, um auszudrücken, dass ihm nichts anderes übrig blieb. »Ich weiß, es wird nicht leicht sein, aber Ihnen wird bestimmt etwas einfallen.« Er lächelte wieder. »Wie heißt es doch so schön: Die Wege des Herrn sind unerforschlich, nicht wahr?« Er schloss die Akte und legte sie in den Korb »nicht bezahlt«.
Das war nicht die Antwort, um die Schwester Peg so inbrünstig gebetet hatte. Wenn sie keinen Aufschub erreichte oder Mr. Sturholm nicht dazu bewegen konnte, die Akte für eine Weile zu verlegen, würde sie das Care Center verlieren. Und wenn das geschah, würden hilflose Menschen auf der Straße sitzen. Schwester Peg hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht, für diese Menschen zu sorgen. Jedes Mal, wenn sie jemanden aufnahm, schwor sie einen heimlichen Eid. Sie versprach, sich um diesen Menschen zu kümmern, egal, was passieren würde. Und sie nahm dieses Versprechen sehr ernst.
Das Care Center war ein großes altes Haus in einer ärmlichen Gegend in Sylmar, ein paar Meilen nordöstlich der alten San Fernando Mission. Schwester Peg führte das Haus seit etlichen Jahren. Sie und einige freiwillige Helfer taten, was sie konnten, um sich der Menschen anzunehmen, die durch die Löcher im Netz der wenigen noch übrig gebliebenen Regierungsprogramme zur Unterstützung der Armen gefallen waren. Das Care Center war vom Gesundheitsamt des Bezirks als freie Sozialeinrichtung zugelassen. Es nahm verlassene und misshandelte Kinder auf, Drogenabhängige, verarmte alte Menschen, Prostituierte und Mitglieder verbrecherischer Gangs, die versuchten, ein neues Leben anzufangen, und auch jeden anderen, dem das Care Center helfen konnte.
Was die Hypothek betraf, so hatte Larry Sturholm leider Recht. Trotz größter Bemühungen hatte es Schwester Peg nicht mehr geschafft, das Geld für die ausstehenden Tilgungsraten zusammenzubringen. Im Lauf der vergangenen acht Jahre hatte sich für Schwester Peg und andere Helfer wie sie die Zahl der Hilfsbedürftigen vervierfacht. Nachdem sich herausgestellt hatte, wie gering die Gewinnspanne bei Investitionen in Armut war, hatte der private Kapitalsektor nicht so reagiert, wie sich das die Republikaner gedacht hatten. Die Kirche musste, zum Teil wegen mangelnden Zulaufs, den Gürtel enger schnallen, so dass ihre finanzielle Unterstützung jetzt geringer ausfiel als früher. Aber wie dem auch sei. Schwester Peg war mit den Tilgungsraten für die Hypothek drei Monate im Verzug, und sie und die übrigen Bewohner des Care Centers mussten sich mit der Tatsache abfinden, dass sie in rund dreißig Tagen auf die Straße gesetzt wurden.
Mr. Sturholm stand auf, um anzudeuten, dass das Gespräch beendet war. »Also dann, viel Glück, Schwester«, sagte er. »Ich sag Ihnen was. Ich werde Augen und Ohren nach einem billigen Objekt für Sie offen halten.«
Schwester Peg schickte sich an zu gehen. Sie war entmutigt, aber nicht niedergeschlagen. Mit zögernden Schritten ging sie zur Tür. »Oh, warten Sie, Schwester«, rief Larry Sturholm. Sie blieb stehen. Vielleicht war Mr. Sturholm doch noch eine Lösung für ihr Problem eingefallen. Als sie sich umdrehte, streckte ihr Mr. Sturholm die Hand entgegen. »Hier«, sagte er. »Nehmen Sie doch einen unserer kostenlosen Kalender mit.«
Scott Emmons saß vor dem Schreibtisch der Personalchefin, um die jährliche Bewertung seiner betrieblichen Leistung über sich ergehen zu lassen. In Scotts Magen hatte sich so viel Säure angesammelt, dass er das Wort Erleichterung auch mit sämtlichen Buchstaben des Alphabets nicht hätte buchstabieren können. Scott war ein dreiundvierzig Jahre alter Werbetexter der zweiten Garnitur, der sich nie auf sein Aussehen hatte verlassen können, um im Leben voranzukommen. Er war schmächtig und von käsiger Gesichtsfarbe als Folge seiner Abneigung gegen körperliche Bewegung und zu vieler Jahre unter Neonbeleuchtung. Zu allem Überfluss war Scott mit der Mode gegangen und hatte sich eine Heimdauerwelle verpasst. Mit seinen dünnen, mühsam in lahme braune Löckchen gezwirbelten Fusselhaaren sah er aus wie ein minderbemittelter Woody Allen. Die Personalchefin hieß Leslie Zimmer. Sie war jung und forsch, mit dem ganzen Selbstbewusstsein, zu dem ein nagelneuer Magisterabschluss in Betriebswirtschaft berechtigt.
»Scott, kommen wir zur Sache«, sagte sie. »Sie sind wie lange in der Prescott Agency?«
»Ungefähr zehn Jahre.«
»Und wie viele Clios haben Sie gewonnen?«
Scott antwortete mit einem Achselzucken.
»Effys?«
Scott schüttelte den Kopf.
»Irgendwelche anderen Auszeichnungen?«
»Ich war in der engeren Wahl für eine Addy-Nominierung wegen meiner Flohhalsband-Kampagne.«
Leslie blickte auf Scotts Akte. »Das war wann?«
»Vor acht Jahren.«
»Mhm.« Leslie notierte sich das.
Scott hatte zeit seines Berufslebens in der Werbung gearbeitet, und er hatte so gut wie nichts vorzuweisen. Außer der Flohhalsband-Kampagne konnte er sich nur noch einer Etikettenaufschrift rühmen, die in einem kleinen Absatzgebiet im Mittelwesten für ein paar Wochen zum Slogan geworden war. Alles, was er für seine Arbeit bekam, waren ein Jahresgehalt von 29 000 Dollar und eine lausige Rente, und in L.A. kam man weder mit dem einen noch mit dem anderen weit. Verständlich, dass Scott auf eine Gehaltserhöhung hoffte, aber Leslie schien nicht in diese Richtung zu steuern.
»Woran arbeiten Sie zurzeit?«
Scott reckte sich. »An einer Werbung in einem regionalen Radiosender für eine neue Slipeinlage«, sagte er munter. »Sie ist ziemlich gut.«
Leslie schien davon wenig beeindruckt. »Scott, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie müssen mit den anderen Schritt halten. Bringen Sie einen neuen Kunden. Entwickeln Sie eine neue Kampagne für einen vorhandenen Kunden – irgendetwas. Andernfalls fürchte ich, werden wir Ihnen kündigen müssen. Verstehen Sie, was ich Ihnen sage?«
Scott konnte es nicht fassen. Sie wollten ihn feuern? Ihm drohte die Luft wegzubleiben. Wenn er seinen regelmäßigen Gehaltsscheck nicht mehr bekam, würden ihn allein die Mindesteinzahlungen auf seine Kreditkartenkonten bei lebendigem Leib auffressen. Scott wusste, dass er nie wieder einen Job bei einer anderen Agentur bekommen würde – nicht bei seiner mageren Erfolgsbilanz. Wenn er nur noch die Schecks von der Arbeitslosenunterstützung bekam, müsste er wieder zu seinem Vater ziehen, und das wäre schlimmer, als gleich zu sterben. Wenn man tot war, brauchte man sich von seinem Vater nicht ständig anzuhören, was für ein Loser der Herr Sohn war. Scott wollte Leslie fragen, wie zum Teufel er Preise gewinnen solle, wenn er nie etwas Besseres bekam als Flohhalsbänder und Slipeinlagen, aber er hatte nicht den Mut, eine solche Frage zu stellen.
Leslie sah ihn über den Schreibtisch hinweg an. Der Mann tat ihr Leid, und nicht nur wegen der Frisur. »Ich sag Ihnen was«, sagte sie. »Mr. Prescott hat eine Konferenz anberaumt. Es geht um einen neuen Kunden. Ich sehe zu, dass Sie dabei sein können. Aber Sie müssen mit etwas aufwarten, sonst ...«
Dan glaubte an Gott ebenso wenig wie an den Weihnachtsmann, aber nachdem er es aus der Mitte des San Fernando Valley bis zu seinem Parkplatz in Century City in weniger als dreißig Minuten geschafft hatte, ohne jemanden totzufahren, war er geneigt, es zu versuchen. Weil er jedoch auf Mr. Prescotts Dringlichkeitskonferenz in einem mit Farbe bekleckerten Hemd erscheinen musste, glaubte er eher, wenn denn ein theologisches Wesen in sein Leben hineinwirkte, dass es der Teufel war.
Im Ganzen genommen, hatte Dan jedoch allen Grund, mit seinem Leben zufrieden zu sein. Er hatte sich in der Werbebranche von ganz unten bis zum Kreativdirektor bei der Prescott Agency hochgearbeitet, einer angesehenen Agentur mittlerer Größe mit Sitz in Los Angeles. Dan war berühmt für die zahlreichen humorvollen Spots, die er für California Air gemacht hatte. Die Kampagne war so erfolgreich, dass California Air unter den regionalen Luftfahrtgesellschaften die Nummer eins wurde, nachdem sie ein Jahrzehnt lang das Schlusslicht gewesen war. Diese Kampagne gewann laufend jede bedeutende Auszeichnung, und Dan hatte sich damit einen Namen gemacht.
Dann geschah etwas, das nur in Hollywood und dann meistens auch nur in Filmen passieren konnte. Dan erhielt einen Anruf von Cinema on Demand, dem heißesten und gefragtesten neuen Kabelkanal auf dem Kontinent. COD, wie sich der Sender nannte, bereitete eine satirische Comedy-Show vor, die wöchentlich gesendet werden sollte, und dies ohne Rücksicht auf Zensurrichtlinien und Verhaltenskodex der Netzbetreiber und Berufsverbände. Unter anderem sollte auch die Werbung auf die Schippe genommen werden, und Dan sollte diese Parodien schreiben und produzieren. Die Bezahlung war großartig, und niemand konnte sagen, wohin eine Nennung im Vor- oder Abspann eines Fernsehfilms oder ein paar Auszeichnungen von Cable Ace in einer Stadt führen konnten, in der so verzweifelt nach guten Leuten gesucht wurde, dass sogar jemand wie Pauly Shore einen Preis erhielt.
Normalerweise war den Kreativkräften einer Werbeagentur eine solche Nebentätigkeit nicht erlaubt. Aber Dans Chef, Oren Prescott, war geradezu begeistert davon. So wie Oren die Sache sah, rückte ihn Dans Arbeit bei der Show in die Nähe einiger Berühmtheiten, und das konnte für den einen oder anderen künftigen Werbefeldzug von Nutzen sein.
Die Comedy-Show wurde entsprechend den Anfangsbuchstaben des neuen Kabelkanals COD Comedy on Demand genannt. Dan war der Produzent für die Commercials on Demand, die bei dieser einmal die Woche gesendeten Show gezeigt wurden. Sein Job bestand darin, alle zwei Wochen eine Parodie auf das Werbefernsehen zu konzipieren, auszuarbeiten und zu produzieren. Rechnete Dan seine Arbeitszeit bei COD und in der Prescott Agency zusammen, kam er nicht selten auf eine Achtzig-Stunden-Woche. Aber ihm gefiel der Hollywood-Glamour, und die zusätzliche Kohle gefiel ihm auch.
Während Dan mit dem Aufzug in den dreißigsten Stock des Century-City-Bürohauses fuhr, dachte er an die Parodie für diese Woche. Er wollte etwas über Anwaltskanzleien machen, wusste aber noch nicht, wie er rangehen sollte. Wie immer, wenn er versuchte, sich spontan etwas einfallen zu lassen, begann er mit den Fingern zu schnippen. Er drehte den Oberkörper nach links und nach rechts und schnippte und schnippte. Er sah aus wie ein von der Taille abwärts gelähmter Flamenco-Tänzer. Manchmal kamen die Ideen einfach so, manchmal musste er dafür arbeiten. Als er das zwanzigste Stockwerk passierte, sah das COD dieser Woche nach Arbeit aus.
Die Türen des Aufzugs öffneten sich vor dem Eingang zur Prescott Agency. Wie immer war der Empfangsbereich voll von ernsten jungen Leuten, die auf ihren großen Durchbruch hofften. Bewerbungsmappen, Lebensläufe und theatralisches Haarezurückwerfen bestimmten die Szene. Dan stieg aus dem Aufzug und watete durch die Menge. Die Empfangsdame blickte auf.
»Hübsches Hemd«, sagte sie. »Handgemalt?«
»Geschenkt, Süße.« Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen – es sei denn, ihm falle etwas Besseres ein als die Wahrheit. Als er den Konferenzraum betrat, hatte er eine Idee. Er legte die Hand auf die verfärbte Brust, setzte eine gequälte Miene auf und stürzte in den Saal.
Allen stockte der Atem. »Mein Gott, Dan«, stieß jemand hervor. »Was ist passiert?«
Dan zog eine kleine Grimasse und winkte mit der freien Hand ab. »Keine Angst. Sieht schlimmer aus, als es ist.«
»Es sieht aus, als wärst du angeschossen!«
Dan setzte sich an seinen Platz am Konferenztisch. »Nein. Irgendein Punk ist in der Tiefgarage auf eine Frau losgegangen. Mit einem Messer. Ich glaube, sie war schwanger. Ich hab versucht, ihm das Messer wegzunehmen, aber er hat mich erwischt – hier, ziemlich nah am Herzen, meinte jedenfalls der Sanitäter. Dann ist noch die Polizei gekommen, und na ja – deshalb meine Verspätung. Tut mir Leid.«
Eine Meinungsumfrage zu Dans Geschichte hätte ergeben, dass sich unter den Anwesenden vier Gruppen gebildet hatten. Die erste Gruppe war die der beruflich Unerfahrenen, sie überlegten demografisch und schluckten Dans faustdicke Lüge wie einen Big Mac. Die zweite Gruppe dachte: »Bullshit!« In der dritten Gruppe wussten alle, dass die Geschichte erfunden war, aber sie fanden sie gut. Und in der vierten und letzten, zu der auch Dans Chef gehörte, fragte man sich: »An welchem Herzen?«
Oren Prescott saß am oberen Ende der riesigen Schiefertischplatte. Er war ein aalglatt aussehender Werbekaufmann in den Sechzigern, weißhaarig und noch gut in Schuss. Er war sonnengebräunt, aber nicht auf die ledrige Art, und sah so clever und durchtrieben aus, wie er war. Demografisch ausgedrückt, war Oren ein diplomierter, dreifach Alimente zahlender, Spesenkonten missbrauchender Investmentfondsbesitzer. Lifestylemäßig gehörte er in den Sektor »dynamische Randgruppe«.
Auf den anderen Plätzen rund um den Konferenztisch saßen die verschiedenen Abteilungsleiter – an der Wand zwei Medienkaufleute, ein weiblicher Artdirector und Scott Emmons. Oren nickte Dan zu. »Ich werde es kurz machen, damit Sie sich nähen lassen können oder was immer nötig sein wird«, sagte er. Mr. Prescott war besorgt, weil er für die Arbeit an dem Projekt, das er ankündigen wollte, einen lebenden Dan brauchte. Oren legte beide Hände auf die Tischplatte, dann erhob er sich langsam, bevor er in die Runde blickte. »Heute Morgen habe ich erfahren, dass Fujioka Electronics einen neuen Laden sucht.«
Ein aufgeregtes Raunen ging durch den Saal. Der Fujioka-Etat betrug hundert Millionen Dollar im Jahr. In den vergangenen zehn Jahren war Fujioka bei Hawkins & Nelson, einer der ältesten und größten Werbeagenturen der Welt. Das Problem bei einer so großen Agentur war, dass man bei einer Gruppe von eingefahrenen Textern landete, deren an sich schon retardierte schöpferische Arbeit durch einen Haufen Bürokratie zusätzlich verlangsamt wurde. Jetzt wollte Fujioka frischen Wind in die Segel bekommen mit einer Gruppe brillanter junger Leute, die die alten Lügen auf aufregend neue Weise erzählen konnten. Das zumindest hatte Oren Prescott gehört. Die Wahrheit war jedoch wie immer etwas komplizierter und lautete so, dass dem Marketingleiter von Fujioka Gerüchte über eine von ihm nicht vorgesehene Änderung seiner Karriere zu Ohren gekommen waren, woraufhin er eine sofortige Überprüfung der Werbemaßnahmen in die Wege leitete in der Hoffnung, ein halbes Jahr Zeit zu gewinnen, bevor er geschreddert beim Alteisen landete.
»Mein Gott, Oren, ist das Ihr Ernst?« Dans Gedanken begannen zu rasen. Das war eine Möglichkeit, den Durchbruch zu schaffen. Wenn er Fujioka für die Agentur gewinnen könnte, musste ihn Oren zum Partner machen, wenn er nicht wollte, dass Dan zum Kunden überlief und auf eigene Rechnung arbeitete.
Scott wusste das ebenfalls. Das waren keine Flohhalsbänder oder Slipeinlagen. Das war genau das, was er brauchte. Er holte seinen Notizblock hervor und schrieb in kühnen Buchstaben »Fujioka!« über die Seite.
»Sie wollen mehr ... Pep«, sagte Oren, womit er sein Denken der alten Schule verriet.
Scott notierte: mehr Pep.
»Sie bringen neue elektronische Geräte auf den Markt, die größer und leistungsfähiger sind als alles Bisherige«, sagte Oren.
»Und sie wollen eine Kampagne, die die Leute aus den Sesseln hebt.«
Scott kritzelte: leistungsfähiger als alles Bisherige.
Oren schlug mit den Handflächen auf den Konferenztisch. »Wir reden hier über etwas, bei dem es mehr knistert als bei einer Steaksaucen-Werbung!«
Mehr Knistern, schrieb Scott. Er unterstrich das Wort »mehr« und betrachtete es. Oren redete weiter, aber was er sagte, drang nicht mehr in Scotts Bewusstsein. Scott begann, alle »Mehrs« auf seinem Notizblock einzukringeln. Dann zog er Linien, die sie miteinander verbanden, und einen Augenblick später dämmerte es ihm. Er hatte es. Er hatte den Slogan, die Bildelemente, die Strategie. Scott war auf dem Weg nach oben.
»Leute«, sagte Oren. »Wenn wir Fujioka an Land ziehen könnten, würde das unseren Umsatz verdoppeln.« Langsamer und leiser fügte er hinzu: »Wenn wir es nicht schaffen, diesen Etat zu bekommen ...«
Die Beendigung des Satzes erübrigte sich. Oren ließ die Drohung einen Moment in der Luft hängen.
»Dan, Sie machen sich sofort an die Arbeit. Ich will bis zum Büroschluss morgen etwas auf meinem Schreibtisch haben. Und machen Sie sich keine Gedanken wegen der Strategie. Die können wir später so hinfrisieren, dass sie zu einer guten Idee passt.«
Während Dan die Linke auf seine Pseudowunde drückte, begann er mit der Rechten zu schnippen. Er verdrehte die Augen, dass sie fast in seinem Kopf verschwanden. »Schon dabei, Sir.« Schnipp, schnapp, schnipp schnipp schnapp.
Scott war wie gelähmt. Er saß da und versuchte zu sagen: »Mr. Prescott, ich habe eine Idee.« Es war eine Idee, von der Scott glaubte, dass sie brillant war – natürlich nicht in dem Sinn wie vielleicht die Erfindung eines Heilmittels gegen Krebs, wohl aber insofern, als Scott glaubte, dass sie etwas anzapfte, was bei den Amerikanern eine Faszination für Sätze wie Where’s the beef? bewirkte. Es war, kurz gesagt, die beste Idee, die Scott Emmons je haben würde. Leider sagte Oren, bevor Scott den Mut aufbringen konnte, selbst etwas zu sagen: »Okay, Leute, das war’s für heute. Bangt um eure Zukunft! Und jetzt zurück an die Arbeit!«
Scott verachtete sich, weil er den Mund nicht aufgemacht hatte. Er hörte im Geist die Stimme seines Vaters, die ihn erinnerte, was für eine Flasche er war. »Du würdest einen Diamanten nicht mal erkennen, wenn du ihn in der Hand hättest«, war eine seiner bevorzugten Redensarten. Scotts Vater glaubte, dies sei die beste Methode, in seinem schwachen Sohn einen starken Charakter aufzubauen. Aber irgendwie hatte die Methode nicht funktioniert, und jetzt war Scott – zumindest seiner eigenen Meinung nach – genau das, was ihm sein Dad vorausgesagt hatte: ein Verlierer.
Mr. Prescott hielt Dan auf dem Weg nach draußen an und erkundigte sich nach seiner Arbeit bei COD.
Scott stand nur ein paar Schritte entfernt, doch er war unfähig, sich bemerkbar zu machen. Er wollte sprechen, aber er konnte es einfach nicht, und bestimmt nicht, weil er es nicht genügend versuchte. Seit einem halben Jahr hörte sich Scott Motivationskassetten an in der Hoffnung, im Beruf aggressiver zu werden. Er fragte sich, warum die Ergebnisse so lange auf sich warten ließen. Auf dem Beipackzettel war die Rede von zwei Wochen. Scott beschloss, in seine Kabine zurückzugehen und sich noch eine Kassette anzuhören.
Oren gab Dan einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter. »Morgen Nachmittag auf meinem Schreibtisch«, sagte er. »Und vergessen Sie nicht – ich will, dass es knistert.«
»Betrachten Sie es als erledigt.« Dan klatschte in die Hände. »Ich habe bereits eine prima Idee.« Prescott ging den Flur entlang, während Dan stehen blieb und dachte, dass er alles andere hatte, nur keine Idee.
Dan ging in sein Büro, und während er sich ein sauberes Hemd anzog, begann er, seinen Terminplan neu zu ordnen. Er würde COD für einen Tag zurückstellen müssen. Die Fujioka-Kampagne war eine Riesenchance, die nicht vertan werden durfte. Also, alles, was er jetzt brauchte, war Inspiration. Dan hob die Hände an die Stirn, um sein Blickfeld nach rechts und links abzuschirmen, und begann sein Ritual. Schnipp, schnapp, schnippschnippschnapp. Als Erstes suchte er wie immer einen Aufhänger. »Fujioka ... Fujioka ... ist besser als eine Glasscherbe im Auge ... als ein Holzsplitter im Auge ... als mit einem Gummiknüppel eins übergezogen zu bekommen. Mh, Fujioka ... nicht einfach eine weitere japanische Firma, die alles besser macht als die Amerikaner ...« So ging das eine Stunde lang.
Dan versuchte es mit geschlossenen Augen, mit Kopfstand und Atemanhalten. Er legte sich wie ein Opferlamm auf seinen Schreibtisch. Er saß im Lotossitz auf dem Boden. Er stand auf und lief hin und her. Schnippschnappschnippschnapp. Aber es tat sich nichts. Er fuhr auf seinem Stuhl Karussell, als die Sprechanlage brummte. »Scott Emmons möchte Sie sprechen«, sagte Rose.
»Schicken Sie ihn zum Teufel.« Dan fuhr weiter Karussell.
»Er sagt, es sei sehr wichtig.«
»Bestimmt.« Dan hielt seinen Stuhl an. »Also schicken Sie ihn schon rein.«
Scott öffnete die Tür und streckte den Kopf durch den Spalt.
»Mr. Steele?«
»Es heißt ›Dan‹.«
»Dan, richtig. Tut mir Leid.« Zwei Worte, und schon hatte er es vermasselt. In der Werbung galt es als ungeschriebenes Gesetz, dass auf die förmliche Anrede »Mr.« oder »Mrs.« verzichtet wurde. Dass allen Angestellten gestattet war, den Chef beim Vornamen zu nennen, sollte ihnen das Gefühl geben, mit allen gleichgestellt zu sein, und es sollte verhindern, dass Förmlichkeiten den freien Kreativitätsfluss beeinträchtigten. Jüngere Angestellte konnten auf diese Weise bei ihren Vorgesetzten unbefangen gute Ideen äußern, die dann in der Befehlskette weitergegeben wurden, bis sie sich jemand am oberen Ende zu Eigen machte. Wie vieles in der Werbung war auch dies ein leicht zu durchschauender, aber erstaunlich erfolgreicher Trick.
»Ich habe eine Idee, die ich mit Ihnen besprechen möchte«, sagte Scott. »Es geht um Fujioka.«
Dan warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Zwei Minuten.« Er wollte nicht unhöflich sein, sondern nur schnellstens wieder allein gelassen werden.
Aber Scott begann sofort an sich und seiner Idee zu zweifeln. Was war in ihn gefahren? War er verrückt geworden? Scott beschloss, diese Motivationskassetten auf der Stelle wegzuwerfen, wenn Dan ihm sagen sollte, dass seine Idee nichts tauge. Er sah nicht ein, warum er sich diese Tortur antun sollte, nur weil irgendein gerade in Mode gekommener Norman Vincent Peal positives Denken verkaufte.
Für Dan fiel Scott lifestylemäßig unter »Möchtegernaufsteiger«. Scott Emmons war ein Paul McCartney hörender, auf Partnervermittlung angewiesener, für United Way spendender Ein-Zimmer-Apartment-Mieter und Hobby-Modellbauer. »Zeit ist Geld«, sagte Dan.
»Ja, richtig«, meinte Scott. Mit beiden Händen hielt er einige lose Blätter, die noch warm vom Drucker waren. Er räusperte sich. »Ich glaube, ich habe die Antwort auf die Fujioka-Frage.« Zaghaft hob er die Papierbögen etwas höher.
»Das sagten Sie schon.« Dan blickte auf seine letzten Telefonnachrichten und verweilte einen Moment schwelgerisch bei der Nachricht von Beverly. »Gestoppt sind fünfzig Sekunden. Ich warte.«
Bis auf ein Blatt breitete Scott alles, was er mitgebracht hatte, auf Dans Schreibtisch aus. Es waren Computerausdrucke – erste Layout-Skizzen für Anzeigen, ein bisschen Grafik und Musterbeispiele, die Scott auf seinem Computer in den letzten Stunden zusammengestoppelt hatte. Es war alles ziemlich primitiv, zugegeben, aber gleichzeitig hatte es etwas Inspiriertes. Dan sah es sofort.
»Es ist ein umgekehrtes Zen-Ding, okay?« Scott deutete auf eines seiner Blätter. »Hier ist unser Sprecher. Ein alter, weiser Japaner, der so redet wie ... wie Meister Po über Kung Fu.«
»Po war Chinese«, sagte Dan und blickte wieder auf die Uhr.
»Dreißig Sekunden.«
Scotts Magen krampfte sich zusammen, während er fortfuhr und sich nur eines wünschte: das hier hinter sich zu haben.
»Chinese. Okay. Jedenfalls sitzt er im Lotossitz, richtig? Er sitzt an einem Teich, in dem sich das Fujioka-Logo spiegelt.« Dan blickte gelangweilt auf Scotts Papiere. »Ja, ja, ja.« Er gähnte.
Scott starb tausend Tode, aber es gab kein Zurück. »Okay. Sie wissen, wie sich Fujioka darstellen will – alles unter dem Gesichtspunkt größer, lauter, bunter. Richtig? Und hier ist der Slogan.« Mit einer Geste, der jeder Schwung fehlte, brachte Scott das letzte Blatt zum Vorschein, das er hinter dem Rücken gehalten hatte. Er hielt es hoch, damit Dan es sehen konnte, und las laut vor: »More is more – mehr ist mehr.« Er machte eine kleine Pause, um es wirken zu lassen. »Verstehen Sie? Es ist eine Abwandlung des Zen-Mottos ›Weniger ist mehr‹. Aber mehr ist mehr, verstehen Sie? Es ist ...«
»Ich verstehe schon. Jeder Idiot würde es verstehen, okay?« Dan wusste sofort, dass Scott die perfekte Kampagne für Fujioka erfunden hatte. Sie war elegant, sprach genau die demografische Zielgruppe und ihr aufgeblasenes Prestigedenken an, und – was das Beste war – sie saß auf Anhieb. Unter diesen Umständen konnte Dan nur eines sagen: »Das ist Scheiße. Warum stehlen Sie mir damit meine Zeit?«
Genauso gut hätte Dan den armen Scott mit einem Heftklammerentferner ausweiden können. »Scheiße?«, sagte Scott fragend.
Dan sah sich plötzlich vor einem Konflikt. Viele an seiner Stelle hätten sich dieser Idee angeschlossen und am sicheren Ruhm partizipiert. Aber nachdem sich der Preis für Moms Heim schon wieder erhöht hatte, konnte er sich das nicht leisten. Er brauchte diese Kampagne für sich allein. »Scott«, sagte er, »ich weiß, Sie meinen es gut, und ich weiß, Sie hätten gern die Stelle des zweiten Kreativdirektors, aber ich finde, das hier ist es ganz einfach nicht. Trotzdem – ein guter Versuch.«
Scott wäre am liebsten gestorben. »Ist die Idee wirklich so schlecht?«, fragte er.
»Lassen Sie es mich auf die ‹ Weniger ist mehr›-Art sagen ... ja. Ich meine es nicht böse, aber Fujioka würde sich niemals dafür begeistern. Wenn wir ihnen damit kämen, wären sie eine Stunde später bei Ogilvy.« Dan schob die Seiten zusammen.
»Wer hat das noch gesehen?«
»Niemand«, sagte Scott. »Warum?«
Dan warf den Stapel in den Papierkorb. »Lassen Sie es dabei. Oren reagiert alles andere als freundlich, wenn sich Angestellte über das Teamkonzept hinwegsetzen. Capisce?«
Scott hörte die väterliche Schelte. Das kleine Ego, das ihm geblieben war, schrumpelte noch mehr. Traurig blickte er auf den Papierkorb. »Könnte ich das zurückhaben?«, fragte er schüchtern. »Es ist die Mastercopy.«
Dan winkte ab. »Scott, es ist Zeitverschwendung. Besser, Sie vergessen das Ganze. Und nun raus mit Ihnen. Ich habe zu tun.« Er griff nach dem Telefon und wählte.
Emmons ging, gebeugt und niedergeschlagen, einmal mehr in seiner Selbsteinschätzung bestätigt, dass er nichts auf der Platte hatte. Als sich die Tür hinter ihm schloss, legte Dan den Telefonhörer auf und schüttelte verwundert den Kopf. Er nahm Scotts Entwürfe aus dem Papierkorb. More is more. Seine Augen leuchteten. Warum war ihm das nicht selbst eingefallen?