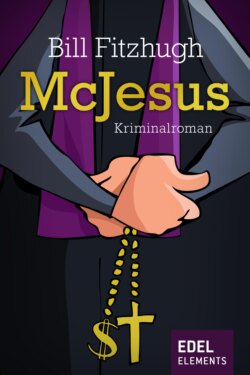Читать книгу McJesus - Bill Fitzhugh - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеEs war fast Mitternacht. Schwester Peg fuhr den Sepulveda Boulevard entlang auf der Suche nach einer Nutte. Sie fuhr sehr langsam, aus mehreren Gründen. Erstens wollte sie die Mädchen sehen, die in dieser Nacht arbeiteten. Zweitens traute sie den Bremsen von Bertha nicht, die ein 26 Jahre alter Chevy Suburban und das einzige Transportmittel des Care Centers war. Jedes Mal, wenn sie auf die Bremse trat, gab Bertha ein hässlich schurrendes Geräusch von sich. Sie brauchte neue Bremsbeläge, aber die kosteten Geld – Geld, das Schwester Peg nicht hatte.
Schwester Peg kroch über die Kreuzung an der Nordoff und weiter den Boulevard hinunter und sah sich die Mädchen an den Ecken und Straßenrändern an. Manche erkannten den alten Chevy und winkten der Nonne am Steuer zu. Sie war hier eine vertraute Erscheinung, da sie den Boulevard seit Jahren abfuhr. Manchmal hielt sie bei den Mädchen an, aber heute hatte sie dazu keine Zeit. Schwester Peg suchte ein besonderes Mädchen, und bis jetzt war sie nirgends zu sehen.
Während Schwester Peg Richtung Parthenia Street fuhr, sah sie sich bei einem Blick in den Rückspiegel zufällig selbst. Sie war seit halb sechs Uhr morgens auf den Beinen. Sie hatte das Frühstück gemacht, etliche Waschmaschinenladungen gewaschen, Bettpfannen geleert. Eine Stunde lang hatte sie auf einen Bürokraten der Bundesregierung gewartet, der ihr schließlich mitteilte, dass das Care Center für das von ihm verwaltete Sozialprogramm nicht qualifiziert war. Sie hatte das Mittagessen gekocht, das Essen serviert, die Küche sauber gemacht, und dann wiederholte sich das Ganze, bis sie endlich gegen elf Uhr das letzte Licht ausmachen konnte. Es war ihr üblicher Alltag, und in den letzten Jahren war es ihr gelungen, dieses Pensum zu schaffen, ohne das Aussehen einer wandelnden Leiche anzunehmen. Aber seit ihrem Gespräch mit Mr. Sturholm in der vergangenen Woche begann sie den Druck zu spüren. Sie berührte die Fältchen an ihren Augen und fragte sich, wie lange sie schon da waren. Früher war ich hübscher, dachte sie.
Kurz hinter dem Roscoe Boulevard entdeckte Schwester Peg endlich das Mädchen, das sie suchte. Josie war groß und schlank und hatte langes, glattes, zitronengelbes Haar. Sie trug ein glänzendes schwarz-rotes Schlauchkleid, das vorne über ihrem üppigen, aber straffen Busen tief ausgeschnitten war, und stand auf zehn Zentimeter hohen glitzernden Plateausohlen, die nach unten hin breiter wurden und bei Jobs im Stehen mehr Standfestigkeit boten. Das eng anliegende Outfit sagte über Josies Beruf ebenso viel aus wie die Kutte über den von Schwester Peg.
Schwester Peg bremste und schlingerte auf den Bordstein zu. Josie kam auf ihren Plateausohlen angetrippelt, bückte sich zum Beifahrerfenster und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Hi, Kleine«, sagte sie. »Voulez, voulez, voulez-vous?« Josie fand, dass Französisch sexy klang.
»Arbeitest du?«, fragte Schwester Peg.
»In dem Fummel geh ich bestimmt nicht in die Kirche«, sagte Josie. »Was willst du hier?«
»Das Übliche.« Schwester Peg sah sich rasch um, ob sie beobachtet wurden.
»Du magst das echt, hm?«
Schwester Peg nickte. »Ich hab doch immer nur das eine im Kopf«, gestand sie.
»Sag ich doch.« Josie zuckte die Schultern und blickte den Gehsteig entlang, während sie ihren langen Rücken streckte. Diese Nummer zog Josie jedes Mal ab, wenn die Nonne vorbeikam. Und jedes Mal spielte die Nonne mit.
Dann sagte Schwester Peg: »Also, steigst du jetzt ein oder nicht?«
Josie verdrehte die Augen und legte den Kopf kokett zur Seite. »Okay. Aber nur für eine Minute. Heute muss es schnell gehen.« Sie öffnete die Wagentür und schob sich auf den mit Klebeband geflickten Beifahrersitz.
»Du siehst gut aus«, sagte Schwester Peg. Sie befühlte den elastischen Stoff auf Josies Bein. »Das ist schick. Bringt deine Figur voll zur Geltung.«
Josie wackelte mit dem Kopf. »Zeig, was du hast, Darling, sonst läuft nichts.« Sie sah Schwester Peg an. »Du siehst müde aus. Bist du sicher, dass du dabei nicht einschläfst?«
Schwester Peg lächelte matt. »Ich probier es.«
Josie seufzte. »Okay, Schwester. Dann wollen wir mal.«
»Nicht hier«, sagte Schwester Peg. »Gehen wir lieber woandershin. Ich will nicht, dass jemand einen falschen Eindruck bekommt.« Eine Minute später hielten sie auf einem dunklen Parkplatz hinter einem Drugstore. Schwester Peg schaltete den Motor aus und drehte Josie den Rücken zu. »Du weißt gar nicht, wie dringend ich das brauche«, sagte sie. Es war nicht ihr erstes Zusammensein, und wenn es nach Schwester Peg ging, war es auch nicht das letzte. Sie brauchte den kleinen menschlichen Kontakt, und den fand sie nur hier.
Josie legte die Hände auf Schwester Peg, und während sie ihr Wunderwerk vollbrachte, stöhnte Schwester Peg wollüstig. »O Gott, ja. Das tut gut.« Josie wusste genau, wo es die Nonne haben wollte. »O ja, genau da.« Schwester Peg schloss die Augen. »Fester«, sagte sie. »Ich bin nicht aus Porzellan.« Schwester Peg krümmte den Rücken und drückte ihn gegen Josies erfahrene Hände.
Josie war nicht nur eine Nutte, sondern auch eine teilzeitbeschäftigte Masseurin. »Mädchen, du bist aber auch verspannt«, sagte Josie. »Möchtest du über was reden?«
»Erst will ich die Knoten in meinen Schultern loswerden. Reden werde ich später.«
Josie knetete die verspannten Muskeln wie Brotteig. Nach ungefähr zehn Minuten war Schwester Peg eine wachsweiche Nonne. Sie hob den Kopf und sagte leise: »Sie wollen uns per Zwangsvollstreckung auf die Straße setzen.« Ihr Kopf sank ein wenig nach vom. »Und ich habe Angst.«
Josie kannte Schwester Peg lange genug, um zu wissen, dass sie sich nicht leicht Angst einjagen ließ, und wenn, dann gab sie es gewöhnlich nicht zu. Folglich bedeutete dieses Eingeständnis, dass es diesmal um das Care Center noch schlechter stand als gewöhnlich. »Was ist mit der Frau in der Bank, von der du gesagt hast, dass sie dir hilft?«
»Sie haben sie gefeuert. Anscheinend war sie zu kundenfreundlich.« Schwester Peg drehte sich zu Josie um. Sie neigte den Kopf zur Seite, und etwas in ihrem Nacken löste sich plötzlich. »Ahhh.«
»Keine Ursache.« Josie legte ihre plateaubeschuhten Füße auf das Armaturenbrett. »Ich würde dir ja gern helfen, aber ich muss für mich selbst sorgen. Du verstehst, was ich meine?«
Schwester Peg legte ihre Hand auf Josies Hand. »Du könntest uns beiden helfen, wenn du die Straße sausen lassen würdest«, sagte sie. »Komm zu uns ins Care Center. Ich brauche deine Hilfe. Denk an all diese Kids.«
Josie nickte. »Und das hier soll ich alles aufgeben?« Sie lachte nervös.
»Ich weiß, dass dabei nicht viel Geld herausspringt«, sagte Schwester Peg. »Aber du wirst nicht verprügelt und hast praktisch keine Chance, dir eine Berufskrankheit zu holen.«
»Ein toller Handel, den du mir da vorschlägst, Schwester.« Josie griff unter ihren elastischen Gürtel und brachte mehrere Kondome zum Vorschein. »Aber sieh her, ich bin vorsichtig.« Josie zog eines ihrer langen Beine unter das andere und drehte sich auf dem Sitz, so dass sie Peg gegenübersaß. »Außerdem bin ich nicht mehr das schwache kleine Ding von früher.« Sie spannte ihren Bizeps. »Ich bin inzwischen zäher, härter und um einiges klüger.«
Schwester Peg hob die Hand und schob Josies zitronengelben Pony zur Seite. »Nun, bei allem Respekt, Frau Professor. Die Härte sieht man.«
Schwester Peg und Josie hatten sich vor beinahe sieben Jahren kennen gelernt, kurz nachdem Josie von zu Hause weggelaufen und in die Fänge eines Zuhälters geraten war, der Probleme mit seinem Jähzorn hatte. Josie war mit dick verschwollenen Augen auf Peg zugetaumelt und hatte sie um Hilfe gebeten. Peg brachte sie ins Care Center, wo sie eine Weile blieb, bevor sie zu ihrem alten Leben zurückkehrte. Seitdem war Schwester Peg hinter Josie her, um sie von der Straße loszueisen. »Hast du die Tests machen lassen?« – »Nicht nötig«, sagte Josie und hielt Peg ein Kondom hin. »Duschhauben! Die kennst du doch noch?«
»Bitte«, sagte Schwester Peg. »Tu es für mich. Die Tests sind kostenlos.«
»Ja, ich weiß«, sagte Josie. Sie hasste es, an Aids zu denken. Sie hatte ein Dutzend Freundinnen daran sterben gesehen und wusste, dass auch sie leicht angesteckt werden konnte, weil sich manche Kerle weigerten, ein Kondom zu benutzen. »Ich muss wieder an die Arbeit«, sagte sie. »Und du gehörst ins Bett.«
Schwester Peg fuhr zum Sepulveda Boulevard zurück. Josie stieg aus. Dann bückte sie sich zum Fenster und sagte: »Macht zwanzig Dollar, Schwesterherz.«
»Okay«, sagte Schwester Peg. »Mein guter Rat kostet vierzig, also schuldest du mir zwanzig.«
»Verdammt.« Josie holte irgendwo aus ihrem Lycraschlauch einen Zwanzig-Dollar-Schein hervor. »Aber ich will nicht, dass du dir irgendeinen billigen Wein dafür kaufst. Füttere lieber deine Kinder damit.«
Schwester Peg nahm den Zwanziger. »Danke, Josie. Du bist ein Engel.«
Dan fand, er habe für heute genug getan. Nachdem er das Geiseldrama im Altenheim beendet hatte, mit Müh und Not pünktlich bei Orens Sondersitzung erschienen war und Scotts Idee geklaut hatte, verbrachte er den Rest des Nachmittags mit der Ausarbeitung des More is more-Stoffs. Dabei war es spät geworden, und er hatte noch den Parodiespot für COD zu präsentieren. Außerdem musste er sich eine Strategie ausdenken für den Fall, dass es Scott einfallen würde, wegen des Plagiats zu mosern, bei dem es sich zufällig um sein geistiges Eigentum handelte. Dan hatte keine ethischen Bedenken wegen seines Umgangs mit der More is more-Idee. Es war eine rein geschäftliche Angelegenheit, und jeder, der nicht wusste, wie die Dinge liefen, konnte daraus nur lernen.
Doch von seiner Karriere einmal abgesehen, war Dans größtes Anliegen im Augenblick, die abenteuerlustige Werbeleiterin Beverly ins Bett zu kriegen. Er hatte sie in ihrem Hotel erreicht, und sie hatte ihn auf einen Drink nach ihrem Geschäftsessen eingeladen. Im Grunde brauchte er nicht mehr zu tun, als ein paar Drinks zu spendieren und körperlich zu funktionieren. Er hatte seit einem Vierteljahr keusch gelebt, so dass er, was Letzteres betraf, ganz zuversichtlich sein konnte. Er hatte wundervolle Visionen von gymnastischem Sex, die es ihm irgendwann unmöglich machten, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Also machte er Feierabend und ging zu seinem Wagen.
Er legte das Fujioka-Material in den Kofferraum seines funkelnagelneuen Mercedes und fuhr auf dem Olympic Boulevard Richtung Küste. Er hätte auch den Freeway nehmen können, aber er fuhr lieber gemütlich auf dem breiten Boulevard, weil er hier in seinem fantastischen deutschen Auto gesehen werden konnte. Genau genommen war es natürlich nicht sein Wagen. Er hatte ihn nur geleast, und genau genommen hätte er sich ein solches Leasing-Auto auch nicht leisten können. Aber Image war alles in Los Angeles – schon gar im Werbegeschäft –, und so entschied sich Dan für das Ego und gegen finanzielle Solidität. Außerdem rechnete er damit, dass er nach dem Verkauf seines Werbekonzepts an Fujioka ein Eckbüro, eine beträchtliche Prämie und ein Angebot für eine Partnerschaft bekommen würde. Das würde ihm mit Sicherheit zustehen. Und damit wären seine Probleme gelöst oder zumindest bezahlt.
Dan hielt an der Ampel der Cloverfield und träumte ein bisschen von Beverly, als er eine Frauenstimme hörte: »Entschuldigen Sie.« Es war eine Frau, die vom Mittelstreifen aus bettelte. »Haben Sie etwas Kleingeld übrig?« Sie hielt ihm die Hand hin, weder duckmäuserisch noch aggressiv. Sie wiederholte nur müde ihre Frage. »Kleingeld? Ich brauche etwas zu essen«, sagte sie.
Almosen. Dan hatte generell ein Problem mit Almosen, aber diese Art von Mildtätigkeit war ihm besonders zuwider – nicht, weil sie den Empfänger zum Kind machte oder dessen Motivation untergrub, sich einen Job zu suchen, sondern weil sie ihn an seine armselige Kindheit erinnerte und wie er sich geschämt hatte, Almosen annehmen zu müssen. Dan verstand nicht, warum er so reagierte. Eigentlich sollte er Mitleid empfinden, nachdem es ihm einmal genau so oder zumindest fast genau so gegangen war. Bedauerlicherweise wog das, was Dan von früher mit sich herumschleppte, schwerer als seine altruistischen Instinkte, und das führte zu einem inneren Konflikt, der ihn armen Menschen gegenüber befangen machte.
Der Autofahrer hinter Dan hupte, als die Ampel auf Grün schaltete. Dan nahm rasch einen Vierteldollar aus dem Kleingeldfach und warf ihn der Frau zu. »Schönen Tag noch«, sagte er, als er losfuhr. Die Frau las den Sticker auf Dans Stoßstange. He who dies with the most toys wins – Wer mit dem meisten Spielzeug stirbt, gewinnt.
Zehn Minuten später fuhr Dan in die gesicherte Parkgarage seines eleganten Apartmenthauses in Santa Monica. Wie der Wagen überstieg auch die Vierzimmerwohnung mit fantastischem Blick auf den Ozean Dans finanzielle Mittel. Aber Dan hatte ein stark ausgeprägtes Gefühl für das, was ihm zustand, und deshalb lebte er an der Bucht.
Dan ging auf seine Wohnung zu, den torfigen Geschmack des Single Malt Scotch schon fast auf der Zunge. Während er vor der Tür mit seinen Schlüsseln und den Fujioka-Papieren hantierte, fühlte er plötzlich jemanden in seinem Rücken. Er hörte ein Geräusch und sah einen Mann im Schatten stehen. Dan beeilte sich, die Tür aufzuschließen, aber dann fiel ihm der Schlüsselbund aus der Hand. Der Mann räusperte sich. »Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an«, sagte er.
Die Stimme klang schrecklich vertraut, doch Dan fühlte sich trotzdem bedroht. Er drehte sich um und hob drohend seine Papiere. »Leg dich nicht mit mir an, Kamerad.«
»Es spricht, der solches bezeugt«, sagte der Mann im Schatten und wechselte das Standbein.
Wieder kam es Dan vor, als würde er mit sich selbst reden. »Ich reiß dir den Arsch auf«, sagte er in der Hoffnung, brutaler zu wirken, als er in Wirklichkeit war.
»Nicht nötig, Bruder.« Der Mann trat ins Licht. Schlichte schwarze Hose, schwarzes Hemd, weißer Stehkragen. Ein Priester. Er war genauso groß wie Dan, nur ein wenig schlanker, und wenn er sich einen Bart wachsen ließe und einen Anzug anzöge, hätte er in der Prescott Agency in Dans Büro spazieren können, ohne dass sich jemand nach ihm umgedreht hätte.
Dans Gesicht verzog sich zu einem breiten Lächeln.
Kein Wunder, dass ihm die Stimme vertraut vorkam. Sie gehörte seinem Zwillingsbruder. »Michael!«, rief er. »Mich laust der Affe! Der Schutzheilige der Nassauer! Was tust du hier?«
»Schön, dich wiederzusehen«, sagte Pater Michael. Er ging auf seinen Bruder zu, um ihn zu umarmen, aber Dan zögerte. Bei dem Beruf, den er ausübte, waren Umarmungen unter Männern eher selten, deshalb streckte er die Hand aus, um Michael die Hand zu schütteln. Doch dann zog er sie rasch zurück. Michael lächelte wie ein Heiliger und drückte seinen gefühlsgestörten Bruder an die Brust.
»Ich dachte, du bist in Afrika«, sagte Dan hinter dem Ohr seines Bruders.
»Ich bin eben zurückgekommen.«
Dan löste sich aus der Umarmung und legte die Hände auf Michaels Schultern. »Es tut gut, dich wiederzusehen.« Dann schloss er die Wohnungstür auf. »Vermutlich bist du nicht gekommen, um eine Einzahlung zu machen?« Er sprach in einem Ton, der sich zwischen »Du schuldest mir immer noch das Geld« und »Ich will dir nur das Leben ein bisschen sauer machen« bewegte.
»Das ist lange her.« Mit einer Handbewegung deutete Michael an, wie lange es her war.
»Eintausend Dollar, Bruderherz. Was ist bloß aus ›Du sollst nicht stehlen‹ geworden?« Dan sah seinen Bruder mit hochgezogenen Brauen an, bevor er die Tür öffnete. Dann verbeugte er sich und sagte mit der einladenden Handbewegung eines Portiers: »Nach Ihnen, bitte.«
»Vielen Dank.« Pater Michael ging in die Wohnung und stellte seinen kleinen Koffer ab.
Dan und Michael waren katholisch erzogen. Das kirchliche Leben und die moralische Unterweisung durch die Religion füllten die Lücke, die durch das zerrüttete Elternhaus entstanden war. Nach dem College gingen sie gemeinsam auf das Priesterseminar. Doch nach einem Semester kamen Dan Zweifel, im Gegensatz zu Michael, der seine Berufung gefunden hatte und absolut glücklich war. Nach dem zweiten Semester hielt es Dan nicht mehr im Seminar. Auch er hatte inzwischen seine Berufung erkannt, und die ging in Richtung eines regelmäßigen guten Einkommens. Er machte eine Ausbildung in Marketing und Werbung und bekam einen Job.
Michael lieh sich im letzten Jahr, das er am Seminar verbrachte, tausend Dollar von Dan für Studienzwecke und um seinen alten VW-Bus wieder herzurichten. Er versprach hoch und heilig, das Darlehen zurückzuzahlen, aber bis jetzt hatte er damit noch nicht einmal begonnen. Er nahm an, dass sein gut verdienender Bruder nicht mehr darauf angewiesen war. Dan weigerte sich jedoch, die tausend Dollar zu vergessen, und sagte, es ginge hier um ein Prinzip.
Michael sah sich in Dans geräumigem Wohnzimmer um, dann ließ er sich auf das edle Sofa fallen. »Ich verstehe ja, dass du sauer bist«, sagte er, »aber du bist der Dummkopf, der einem zur Armut verpflichteten Mann Geld geliehen hat.«
»Ich dachte, du würdest von der Kollekte etwas abzweigen, um mir mein Geld zurückzuzahlen.« Dan ging zu seiner hochmodernen Phono- und Fernsehanlage – er tat dies so automatisch, wie er atmete – und schaltete den Fernseher ein. Dann dämpfte er den Ton und drückte »Random Play«, auf seinem 100-Scheiben-CD-Player. »Ich dachte nicht, dass du nach Afrika verschwinden würdest.« Als die Musik aus den verborgenen Lautsprechern drang, ging Dan zur Bar. »Ich habe einen sehr teuren Single Malt Scotch, einen schwer aufzutreibenden Single Barrel Bourbon und einen fabelhaften Wodka aus einer sehr exklusiven russischen Brennerei. Ich schlage vor, wir nehmen zuerst einen Schluck Scotch und gehen dann zum Verschnitt über.«
Michael richtete den Zeigefinger auf Dan. »Für dich war Teilen immer ein Problem.«
»Ich habe den Mutterleib mit dir geteilt, oder nicht? Das ganze Fruchtwasser und was sonst noch alles.« Er füllte zwei dicke Kristallgläser ein paar Finger hoch mit schottischem Malzwhisky. »Das berechtigt dich nicht zur Teilhabe an meinem Einkommen. Die Gesetze für Gütergemeinschaft finden keine Anwendung in utero oder wenigstens sollten sie das nicht.« Er ging zum Sofa und reichte Michael ein Glas. Sie stießen an und tranken. »Und wie sieht’s aus auf dem schwarzen Kontinent?«
»Düster«, sagte Michael. »Und es wird jeden Tag schlimmer.« Er rieb sich den steifen Nacken, während er mit einem Dutzend Horrorgeschichten über die Flüchtlingslager in Afrika aufwartete. Er sprach von Hunderten von Kindern, die er jede Woche sterben sah; und dass das einheimische Militär regelmäßig die Vorräte der Hilfsorganisationen stahl. Er zeichnete ein grausiges Bild der Verhältnisse, die sich seiner Meinung nach noch verschlechtern würden. Die Uno könne die örtlichen Machthaber und Regime noch so oft anprangern und verurteilen – in Afrika könne sich niemand etwas dafür kaufen. »Was die Menschen dort brauchen, sind Lebensmittel und Geld.«
Dan schüttelte den Kopf. »Wann wirst du lernen, dass noch so viele milde Gaben nicht helfen. Diese Leute müssen lernen, sich selbst zu helfen. Zeig einem Mann, wie man fischt. Nur so hilfst du ihm.«
»Weh euch Reichen, denn ihr habt euren Trost dahin«, sagte Michael.
»Jaja, und du machst heute mal Pause«, sagte Dan. »Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel gesehen? Besonders gut siehst du nicht aus. Bist du in Ordnung?«
»Das ist einer der Gründe, warum ich zurückgekommen bin. Ich hatte ein paar gesundheitliche Probleme. Ein Arzt vom Roten Kreuz sagte, ich bräuchte etwas Ruhe und anständiges Essen.«
»Wetten, dass ich dich aufpäppeln kann?«, sagte Dan. »Hast du eine Unterkunft?«
»Ich dachte, dass ich vielleicht ein paar Tage bei dir bleiben könnte, bis ich etwas gefunden habe.«
»Kein Problem«, sagte Dan. »Aber niste dich nicht zu sehr ein. Das hier ist keine billige Absteige für heruntergekommene Priester.« Trotz seiner verbalen Stichelei freute sich Dan, seinen Bruder wieder zu sehen. Er war der einzige Mensch, mit dem sich Dan wirklich verbunden fühlte, und dieses Band war stark.
Pater Michael hob sein Glas: »Auf Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei«, sagte er. »Aber für mich ist Nächstenliebe das Wichtigste.«
Dan beugte sich vor und stieß mit Michael an. »Weil wir gerade von Nächstenliebe sprechen«, sagte er. »Erinnerst du dich an Mom?«
Pater Michael leerte sein Glas. »Mom? Kommt mir nicht bekannt vor.«
Dan lehnte sich in seinem Sessel zurück. »Aber ja doch.« Er hielt die Hand einen Meter über den Boden. »Ungefähr so groß. Eine süße kleine Verrückte, für die ich in den letzten vier Jahren vierzigtausend per annum ausgegeben habe. Wie gut kannst du kopfrechnen?«
Michael schnitt eine Grimasse. »Sie ist nicht verrückt, Dan. Sie ist unbefangen.«
»Aha. Dann lass dich mal vor einer wichtigen Konferenz mit einer Farbpistole beschießen.«
»Okay, sie ist eine unbefangene Manisch-Depressive. Wie geht es ihr?« Pater Michael schob den Unterkiefer von einer Seite zur anderen, um seine verkrampften Muskeln zu lockern.
»Es geht ihr gut, solange sie ihre Medikamente bekommt. Aber selbst dann ist sie nicht ganz zurechnungsfähig.«
Sie sprachen eine Weile über Ruth, und bald waren sie bei Kindheitserinnerungen angelangt, und es waren zum größten Teil die guten. Sie tranken noch etwas mehr, und die Unterhaltung sprang von einem Thema zum anderen, wie das Gespräche über eine gemeinsame Vergangenheit so an sich haben. Sie wussten genau, auf welchen Knopf sie beim anderen drücken mussten, und sie taten es aus purem Spaß. Nach ein paar Stunden waren sie wieder da, wo sie angefangen hatten, und sprachen über ihre Mutter.
Pater Michael setzte sich auf dem Sofa gerade hin. »Sie ist der andere Grund, warum ich zurückgekommen bin.«
Dan stand auf und schenkte eine weitere Runde ein. »Oh?« »Du hast deinen Teil getan«, sagte Michael. »Jetzt bin ich hier, um den meinen zu übernehmen.«
Dan lächelte. »Also, nichts für ungut, Bruder. Es wurde allmählich auch Zeit. Aber wo willst du das Geld hernehmen?« »Ein Monsignore Matthews von der Diözese Los Angeles hat mir in einer Sozialstation, die sich Sylmar Care Center nennt, eine Stelle verschafft. Ich werde dort arbeiten und Mom mitnehmen.«
Dan sah seinen Bruder misstrauisch an. »Du meinst, ich bin aus dem Schneider?«
»Du bist frei wie ein Vogel«, sagte Pater Michael.
Dan konnte es kaum glauben. Das war wie eine dreißigprozentige Gehaltserhöhung. Wenn dann noch die Prämie für die Fujioka-Kampagne dazukäme, wäre Dan ein gemachter Mann.
»Und wie sieht dieses Care Center aus?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Michael. »Ich weiß nur, dass es von einer Nonne namens Schwester Peg geleitet wird und dass sie wie alle karitativen Einrichtungen, die sich um Arme kümmern, zu wenig Geld haben.«
Dan wollte weder über Sozialarbeit noch über die Armen sprechen, deshalb brachte er das Gespräch auf sich. Zwanzig Minuten lang erzählte er stolz von seinem Job bei COD und prahlte mit den Vorzügen eines doppelten Einkommens.
Pater Michael sah sich in der gut eingerichteten Wohnung um.
»Ich vermute, das erklärt deinen Vergnügungspalast hier in diesem Haus von Sodom und Gomorrha.«
»Lass dich nicht von Äußerlichkeiten täuschen.« Dan schnaubte verächtlich. »Ich stecke bis zum Hals in Schulden.«
»Herzlichen Glückwunsch. Und was ist mit den zarten Banden?«
»O verdammt!« Dan schoss aus seinem Sessel und stürzte zum Telefon. »Nein, nein und noch mal nein«, rief er, während er wie wild auf die Tasten drückte. Er hatte Beverly völlig vergessen. »Komm schon, komm schon«, flehte er das Telefon an. »Biiitte!« Vor eineinhalb Stunden hätte er sich mit Beverly treffen sollen. Trotzdem. Vielleicht konnte er noch ein bisschen Telefonsex bekommen. »Nimm ab, nimm schon ab.« Ihm wurde ganz schlecht, als die Bilder von den kleinen Perversitäten, die er sich von Beverly erwartet hatte, nur noch flimmerten wie eine Mattscheibe ohne Bild. »Ja, Zimmer 703! Schnell!«
Pater Michael sah sich diese Verzweiflung ein Weilchen an, dann schloss er die Augen, atmete tief ein und versuchte, sich zu entspannen. Er genoss die angenehme Wirkung des Whiskys. Die Spannung in seinem Kiefer löste sich etwas.
An Stelle von Telefonsex bekam Dan den Anrufbeantworter. Er stammelte eine Nachricht, erkannte aber bald, dass er nur Zeit verschwendete. Er knallte den Hörer auf das Telefon und blickte zu Michael. »Hoffentlich bist du ordentlich stolz auf dich«, sagte er. »Du wirst nie erfahren, wie viele Sünden du heute verhindert hast. Und ich werde es auch nie wissen.« Dan kippte seinen Drink und schenkte sich einen Doppelten nach. »Verdammt! Wegen diesem Mädchen wurde Sünde überhaupt erfunden!« Dan wusste sich nicht anders zu helfen. Wenn er schon nicht an lasterhaften sexuellen Aktivitäten teilnehmen konnte, musste er wenigstens die Befriedigung haben, einem anderen Mann zu sagen, wie nah er einem solchen Erlebnis gekommen war.
Michael hörte sich geduldig und nicht ohne Interesse an, was Dan mit Beverly geplant hatte. Als Dan geendet hatte, sah ihn Michael nachdenklich an. »Du denkst also nicht daran, dich in nächster Zeit häuslich niederzulassen und eine Familie zu gründen?«
»Mann, das ist echt stark«, schnaubte Dan, während er zu einem Schrank im Flur ging. »Ich hatte bis heute Abend eine verrückte Mutter, die mich vierzigtausend im Jahr kostete, und einen Bruder, der ein Armutsgelübde abgelegt hat.« Er nahm ein Kissen und ein paar Decken aus dem Schrank. »Ich brauche mehr Familie so dringend wie Prostatakrebs.«
»Du brauchst eine Familie«, entgegnete Michael. »Jemand, für den du sorgen musst, für den du jeden Tag aufstehst und da hinausgehst.« Er zeigte mit dem Finger auf seinen Bruder. »Du wirst sehen, eines Tages ...«
Dan dachte an seine Fujioka-Präsentation. Dann warf er Michael das Bettzeug zu. »Bei allem Respekt, Pater. Ich habe tausend andere Gründe, um morgens aufzustehen. Und deshalb gehe ich jetzt ins Bett.«
Um sechs Uhr am nächsten Morgen trank Dan seinen Kaffee auf dem Balkon, der auf die Santa Monica Bay hinausging. Er versuchte sich einzureden, dass mit Beverly noch nicht alles verloren war. Er würde ihr einen Strauß Rosen schicken und das Beste hoffen. Dans Optimismus war getragen von dem herrlichen Blick auf das Meer und seinen Zukunftsaussichten. Der Himmel war klar. Die Stille des Meeres wurde nur von den Delfinen unterbrochen, die auf dem Weg entlang der Küste an die Oberfläche kamen, um Luft zu schnappen. Es war der perfekte Anfang für Dan Steeles perfektes Leben.
In ein paar Stunden würde er seinem Chef eine erstklassige Präsentation für einen Einhundert-Millionen-Dollar-Etat liefern. Und als ob das noch nicht genug der guten Dinge gewesen wäre, hatte er plötzlich eine Superidee für seine COD-Parodie auf die Rechtsanwälte. Eine halbe Stunde später war der Spot geschrieben. Verdammt, dachte er, besser kann es gar nicht werden.
Dann machte er einige Anrufe, um den Tag in Gang zu bringen. Drehorte mussten gefunden, Sets aufgebaut werden. Das COD-Besetzungsteam musste die Schauspieler vorsprechen lassen und sie bis zwei Uhr unter Vertrag und einsatzbereit haben. Nach der Fujioka-Präsentation würde Dan den Rest des Tages mit der Aufzeichnung und der Bearbeitung des COD-Spots verbringen. Am nächsten Tag würden er und Oren die More is more-Kampagne bei Fujioka vorstellen, und Dan würde in die Ruhmeshalle der Werbung einziehen.
Das einzige Haar in der Suppe war Scott Emmons. Dan hatte Scotts Idee geklaut, weil er sich finanziell in einer verzweifelten Lage befand. Doch wenn Michael ihm nun die Sorge um Ruth abnahm, würden sich seine Finanzen erheblich verbessern. Dan begann darüber nachzudenken, ob er sich Ruhm und Verdienst mit Scott teilen sollte. Auf diese Weise bräuchte er nicht mehr zu befürchten, dass Scott ihn denunzierte. Und wenn die Popularität von COD weiterhin zunahm, wären seiner Zukunft keine Grenzen gesetzt. Trotzdem war es sehr verlockend, die More is more-Idee für sich allein zu beanspruchen. Um acht Uhr war er in Orens Büro und machte die Präsentation. Dan wartete auf Orens Reaktion. Wenn er die Idee idiotisch fand, könnte Dan – zumindest teilweise – Scott dafür verantwortlich machen. Fand er sie gut, war es vielleicht am besten, Scott gegenüber fair zu sein.
Endlich blickte Oren von den Unterlagen auf. »Verdammt«, sagte er.
»Verdammt gut oder verdammt schlecht?«, fragte Dan.
»Verdammt gut!«, sagte Oren. »More is more. Das ist ein gottverdammter Volltreffer.« Oren schlug mit der flachen Hand auf den Schreibtisch. »Ich werde das Fujioka-Meeting für morgen ansetzen. Bringen Sie das jetzt zur Grafik. Und verändern Sie nichts.« Dan rührte sich nicht. Er stand da, blickte aus dem Fenster und dachte an Scott. »Gibt’s noch ein Problem?«, fragte Oren.
Das Problem war, dass Dan keine Lust hatte zu teilen. »Nein, keine Probleme«, sagte er. »Ich habe nur an den COD-Spot gedacht, den ich heute Nachmittag drehe.« Vielleicht informierte er Oren später über Scotts Beitrag. Im Augenblick musste er verhindern, dass Scott Emmons von der Fujioka-Sache Wind bekam. Er rief ihn an und bat ihn, zu den Dreharbeiten bei COD mitzukommen.
Eine Stunde später waren sie in einem Tonstudio in Burbank, wo der erste Abschnitt des Spots aufgenommen wurde. Sie verbrachten den Rest des Tages zusammen. Scott nützte die Gelegenheit und streichelte Dans Ego pflichtgetreu alle halbe Stunde. Dan fing an, ihn zu mögen. Vielleicht würde er Oren später anrufen und ihm sagen, dass die More is more-Idee von Scott stammte. Vielleicht.
Die Aufnahmen klappten tadellos. Der Sprecher spielte seinen Part eiskalt. Er war ein alter Bühnenschauspieler mit Hängebacken, der in seinem dunklen Anzug mit Fliege ohne weiteres Juraprofessor an einer Ostküsten-Eliteuniversität hätte sein können. Wenn er mit dem Hochmut des alten Geldadels über seine Brille plierte, hörte man ihn förmlich sagen: »Wir machen Geld auf die altmodische Art. Wir verdienen es.« Zwischen jeder Aufnahme und jeder neuen Kameraeinstellung rief Dan bei Beverly an, aber er erreichte immer nur den Anrufbeantworter. Dan und Scott verbrachten den Rest des Tages in einem Schneideraum, bis der Spot schließlich in einem Stück von Anfang bis Ende zu sehen war.
Der Spot eröffnete mit einer Außenaufnahme auf einer regennassen Straße. Polizeifahrzeuge mit Blinklichtern sperrten den Verkehr, während sich die Polizisten bemühten, einen offensichtlich betrunkenen Mann zu überwältigen, der so nackt war, wie Gott ihn geschaffen hatte. Sobald die Situation klar war, kam der Sprecher ins Bild und sprach ernst und mit perfektem Kingsfield-Akzent den Text.
»Sie sind betrunken, Sie sind bekifft, und Sie sind nackt«, sagte er. Er wandte sich dem Schauplatz zu, während er eine Montage mit rasch aufeinander folgenden Bildern kommentierte: »Ein Zwölfjähriger mit zwei Kilo Heroin ist mit Handschellen an ihr Handgelenk gefesselt.«
Schnitt und Weitwinkelaufnahme vom Verhör des Verdächtigen durch die Polizei. »Sie sind im Besitz eines rauchenden Revolvers, und die Polizei fängt an, peinliche Fragen zu stellen, die Sie nicht beantworten können.«
Schnitt auf extreme Nahaufnahme des Sprechers, der über seine Brille hinweg direkt in die Kamera blickte. »Sie benötigen möglicherweise juristischen Beistand«, sagte er.
Der Sprecher ging über einen Flur auf eine eindrucksvolle Nussbaumtür zu, auf der in Goldbuchstaben der Name einer Rechtsanwaltssozietät stand. »Wenn Sie sich in einer heiklen Situation befinden und der normale Rechtsweg nicht auszureichen scheint – wenden Sie sich an Staengel, Schnüffel, Kraut und Marx. Wir helfen Ihnen, egal was es Sie kostet.«
Der Sprecher öffnete eine Tür, und man sah einen glücklichen Klienten, der einen Scheck ausstellt und einem Anwalt die Hand schüttelt. »Bei Staengel, Schnüffel, Kraut und Marx sind Ihr Recht und Ihr Scheckbuch in guten Händen.« Der glückliche Klient dreht sich um, und es zeigt sich, dass er der Verdächtige ist, der in der ersten Szene verhaftet wurde.
Schnitt auf eine Akte, auf die ein Stempel gedrückt wird mit der Aufschrift »Entlassen«.
»Staengel, Schnüffel, Kraut und Marx – Wir stehen über den Dingen, nur für Sie.«
Der Spot endete mit dem Firmenlogo – einer großen goldenen, sich drehenden Schraube.
Alle Anwesenden gratulierten Dan. Scott sagte, er fühle sich besonders geehrt, dass er bei der gesamten Produktion dabei sein durfte. Dan lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und fühlte sich wie ein kleiner James Cameron. Sein Tag war nahezu perfekt gelaufen. Gerührt von all den lachenden Gesichtern und den herzlichen Glückwünschen regte sich bei Dan das Bedürfnis, großzügig und zumindest ein wenig ehrlich zu sein. Er ging zum Telefon, um Oren anzurufen. Scott sollte seinen Anteil an der More is more-Idee haben. Doch als er den Hörer abnahm, platzte ein Toningenieur in den Schneideraum und rief, sie sollten den Monitor auf einen der lokalen TV-Sender schalten.
Das erste Bild kam aus der Kamera eines Hubschraubers. Es zeigte einen Neunachser-Sattelschlepper, der von mehreren Polizeifahrzeugen mit Blaulicht verfolgt wurde. Der Hubschrauberpilot sagte, der Laster würde auf dem Balboa Boulevard Richtung Süden fahren und beschleunigen. Als Nächstes sah man einen Reporter neben einem alten Chevrolet, der vorne völlig platt gedrückt war. Es folgten Filmaufnahmen von der vorangegangenen Verfolgungsjagd.
»Kurz nachdem diese Jagd begann«, berichtete der Reporter aus dem Off, »als der Sattelschlepper von der Chatsworth auf den Balboa Boulevard einbog, überrollte er mit den Hinterrädern die Motorhaube dieses Impala und zermalmte den gesamten vorderen Teil des Wagens mit dem elf Tonnen schweren Anhänger. Der Fahrer kam gottlob mit dem Schrecken davon.«
Dan und die anderen im Schneideraum johlten vor Begeisterung. Sie schalteten von Sender zu Sender, um zu sehen, wer die besten Bilder hatte. Wie es aussah, hatte der Sattelschlepper bereits eine ziemliche Schadensspur hinterlassen. Aufgrund der unsteten Fahrweise des Schleppers vermuteten einige Reporter, dass der Fahrer, der den Schlepper entwendet hatte, unter dem Einfluss von Psychopharmaka oder Amphetaminen oder möglicherweise beidem stand.
Es hieß, dass die Polizei von L.A. zwei Dutzend Fahrzeuge aus allen Ecken des San Fernando Valley auf den Sattelschlepper angesetzt hatte, um ihn einzukreisen, und die Californian Highway Police errichtete Straßensperren an allen Zufahrten zur 405 zwischen den Freeways 101 und 118. Fernsehen und Radiostationen verfolgten die Ereignisse mit insgesamt zehn Hubschraubern, zwei Flugzeugen und sechs Übertragungswagen. Alle ursprünglich angesetzten Programme waren unterbrochen zugunsten dieser hoch brisanten Jagd.
Dan beugte sich zu Scott und sagte: »Das Einzige, was die Einschaltquoten noch verbessern könnte, wäre eine kleine Schießerei.« Scott lächelte und hatte das Gefühl, einen bedeutenden Freund gewonnen zu haben.
Die Leiter der Nachrichtenredaktionen nennen den Großraum Los Angeles einen »gereiften« Nachrichtenmarkt. Was sie damit meinen, ist, dass die Stadt voll von Irren ist, die bereit sind, öffentlich alle Arten von Verbrechen zu begehen, weil sie – und das ist ihnen voll bewusst –, wenn sie erwischt oder getötet werden, live im Fernsehen zu sehen sind. Jüngste Untersuchungen ergaben, dass dieses Wissen nicht nur nicht abschreckt, sondern diese Leute tatsächlich motiviert. Folglich berichteten die Nachrichtenteams der Augenzeugen- und Action-Sendungen im Großraum L.A. pro Kopf gerechnet über mehr Verfolgungen, stümperhafte Banküberfälle mit Schießereien und über Selbstmörder, die sich auf den Freeways überfahren lassen, als alle anderen Nachrichtenteams auf der Welt. Während die Verfolgung weiterging, konnten die Nachrichtensprecher mangels genauerer Informationen über die Hintergründe des Geschehens nur spekulieren. Der Sprecher einer Fernsehstation meinte, es bestünde die Möglichkeit, dass der Sattelschlepper mit biologischen Waffen beladen war – möglicherweise mit Nervengas – und dass der Fahrer einer militanten islamischen Organisation angehören könnte. Das Einzige, was seine wilden Vermutungen stützte, war die Aussage des Mannes, der seinen Sattelschlepper mit laufendem Motor an einer Straße hinter einem Industriegelände stehen gelassen hatte, auf dem es neben anderen Firmen auch einige Hersteller für biotechnische Geräte gab. Als der Lkw-Fahrer seinen Papierkram im Büro erledigt hatte und wieder herauskam, war der Schlepper verschwunden.
BOING! Der Sattelschlepper schnitt eine Kurve und schrammte einen nagelneuen Porsche. »Wow!«, sagte der Cutter. »Das wird jemanden ’ne Stange kosten.«
Der Reporter legte die Hand an seinen Kopfhörer. »Wie ich höre, fährt der Sattelschlepper in Richtung Van Nuys Airport«, sagte er. Eine Viertelmeile vor dem Schlepper legten Polizisten eine Nagelsperre. Dann zogen sie sich mit ihren Autos zurück und entsicherten ihre Waffen. Der Schlepper fuhr mit permanent röhrendem Horn direkt auf sie zu. Der Fahrer des Schleppers sah den Spikesstreifen zu spät. Reifen platzten, der Fahrer verlor die Kontrolle, und das Riesengerät rumpelte auf einen Acker, wo es im weichen Boden stecken blieb. Die Polizisten umstellten die Fahrerkabine und richteten die Waffen auf beide Türen.
Die Männer im Schneideraum schlossen Wetten ab über den Ausgang der Schießerei. »Zwanzig Dollar, dass er tot ist, bevor er mit den Füßen den Boden berührt«, sagte Dan.
Bevor jemand auf seine Wette eingehen konnte, streckte der Wahnsinnsfahrer die Hände aus dem Fenster und winkte auf ungewöhnlich freundliche Weise. Ein Reporter sagte, die Polizei spreche über Megafon mit ihm. Eine Sekunde später öffnete sich die Tür an der Fahrerseite. Der Hijacker hielt sich an dem verchromten Haltegriff fest und ließ sich auf das breite Trittbrett über dem Tank herunter.
Der Cutter traute seinen Augen nicht. »Ach du heiliger Strohsack!« Er begann zu lachen.
»Es ist eine niedliche alte Lady«, sagte Scott.
Dans Kopf landete mit einem dumpfen Laut auf dem Monitor-Schaltpult. »An dieser Lady ist nichts niedlich«, sagte er. »Nicht das Geringste.« Dans so perfekt gelungener Tag war plötzlich und unwiderruflich im Eimer. Nach diesem Schlag konnte er es sich nicht mehr erlauben, die Wahrheit über die Fujioka-Idee zu sagen. Er würde die ganze verdammte Prämie brauchen – und noch einiges dazu.
Ruth hatte, auch wenn es nicht ihre Absicht gewesen war, nicht nur einen sündteuren Porsche zu Schrott gefahren, sondern auch Scott Emmons’ Karriere endgültig ruiniert.
Die Augen von Mr. Smith waren leer. Seine Stimme klang hohl. Er war neunundachtzig und würde die Neunzig nicht mehr erleben. Sein Geruchssinn war abgestorben. Er konnte nicht mehr sehen, und Töne waren nur noch undeutliche Geräusche. Er konnte die Welt, in der er so elend dahinsiechte, nicht mehr wahrnehmen. Steif und mit hängendem Kiefer lag er auf seinem Bett und blies stinkenden Atem aus seiner schwarzen Lunge. Hätte er sich einen Arzt leisten können, hätte dieser unter anderem festgestellt, dass Mr. Smiths Schweißdrüsen so atrophiert waren, dass seine Haut demnächst die Beschaffenheit von Salzcrackern haben würde. Und ein Rechtsanwalt hätte gesagt, dass es höchste Zeit wäre für ein Testament.
Aber Mr. Smith hatte nichts zu vererben. Und noch trauriger war, dass er niemanden hatte, dem er etwas hätte vererben können. Seine Frau und seine beiden Kinder waren vor ihm gestorben. Er hatte keine Geschwister, keine Verwandten, keine alten Freunde. Irgendwo in Arkansas lebte ein Enkel, der sich jedoch einen Teufel um den alten Mann scherte. Mr. Smith, dessen Leben so alltäglich war wie sein Name, war völlig allein, wäre da nicht eine Frau gewesen, die etwas Ähnliches schon einmal erlebt hatte.
Schwester Peg war eine geborene Peggy Morgan. Sie wuchs in einer zufriedenen Mittelklassefamilie im kalifornischen San Bernardino auf. Ihr Vater war ein freundlicher stiller Mann, der eine kleine Zulieferfirma für Elektroartikel besaß. Ihre Mutter machte die Buchhaltung. Peg war das einzige Kind und eine erstklassige Schülerin. Sie ging zur Sonntagsschule, und ein paar Mal im Jahr begleitete sie eine Freundin in die katholische Kirche, weil ihr die bunten Glasfenster so gefielen.
In dem Frühjahr, als Peg das erste Jahr auf der Highschool war, wurde bei ihrem Vater Krebs diagnostiziert. Peg verbrachte jeden Tag dieses Sommers im Krankenhaus bei ihrem Vater und las ihm vor, während er zusehends verfiel. Die Behandlung war teuer, und sie mussten das Geschäft verkaufen, um die Krankenhausrechnungen zu bezahlen. Trotz aller Bemühungen der Ärzte starb Mr. Morgan Anfang September.
Nun saß Schwester Peg um drei Uhr morgens im Care Center am Bett von Mr. Smith. Sie hielt seine kraftlose, fleckige Hand, aber sie dachte an ihren Vater. Mr. Smith’ Puls war in den letzten Tagen immer schwächer geworden. Schwester Peg wusste, dass er bald sterben würde. Seine trüben Augen starrten zur Decke. Er konnte nicht blinzeln und er konnte nicht weinen, obwohl er beides gern getan hätte. Er fuhr sich mit der ledrigen Zunge über die Lippen und flüsterte: »Es ist kalt.«
Schwester Peg hatte ihn bereits mit drei schweren Wolldecken zugedeckt. Nun zog sie ihm die obere bis ans Kinn und stopfte sie sanft unter das Kopfkissen. »So«, sagte sie, »so ist es besser.« Ihre Stimme klang angenehm und beruhigend. Sie legte die Hand auf seine Stirn; dann strich sie ihm über die eingefallene Wange. Sie wollte ihn wissen lassen, dass jemand da war, dass sich jemand um ihn kümmerte.
Im Haus herrschte überall Ruhe. Die Kinder schliefen, und die Polizeihubschrauber flogen über anderen Teilen des Valley Streife. Schwester Peg nahm das Buch vom Fußende des Betts und rückte die trübe Lampe näher heran. Sie beugte sich nah zu Mr. Smith’ Ohr, damit er sie hören konnte. »Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob«, begann sie. »Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse.«
Trotz seiner Blindheit sah Mr. Smith das Ende herannahen. Er begann zu zittern, nicht wegen der Bibelworte, sondern im Todeskampf, als sich seine letzten Atemzüge durch die verschleimte Luftröhre quälten.
Schwester Peg blickte auf Mr. Smith’ Leiche und hoffte, dass sie ihm das Gefühl gegeben hatte, in Würde zu sterben. Sie ahnte, wie schrecklich es war, so allein zu sein in einer so schrecklichen Welt. Und als Mr. Smith ihre Hand losließ, fragte sie sich, ob das wirklich schon alles war.