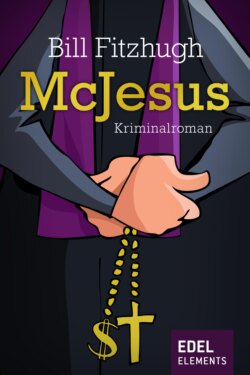Читать книгу McJesus - Bill Fitzhugh - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеSie hat vergessen, ihre Medizin zu nehmen«, sagte Dan. »Rechtlich ist sie für ihre Taten nicht verantwortlich, oder?«
Die Polizistin, die am Schreibtisch vor ihrem Computer saß, blickte auf. »Keine Sorge«, sagte sie. »Wenn Ihre Mutter nicht zurechnungsfähig ist, hat sie keine Probleme.«
Dan atmete erleichtert auf. »Gut«, sagte er. »Vielen Dank.« »Natürlich muss jemand für den Schaden aufkommen«, sagte die Polizistin. »Und ich nehme mal an, das werden Sie sein.« Sie lächelte und nahm ihre Arbeit wieder auf.
Beim Verhör sagte Ruth, sie habe nur die Flugzeuge am Van Nuys Airport starten und landen sehen wollen. Weil vom Altenheim niemand sie hinbringen wollte, beschloss sie, allein hinzugehen, aber nach einer Meile oder so sei sie müde geworden. Da habe sie den Sattelschlepper mit dem laufenden Motor gesehen. Als Nächstes erinnerte sie sich nur noch, dass das Ding dreißig Meilen in der Stunde fuhr und sie es nicht anhalten konnte. »Es tut mir Leid, wenn ich Probleme gemacht habe«, sagte sie.
Trotzdem geriet Ruth in die Mühlen der Justiz. Sie musste mit mehreren Anklagen rechnen wegen böswilliger Täuschung, schweren Diebstahls, Fahrerflucht, um nur einige zu nennen. Bevor diese Anklagen erhoben werden konnten, musste sie sich einer Überprüfung ihrer Zurechnungsfähigkeit unterziehen. Sie musste dem Haftrichter vorgeführt werden, und das alles konnte erst einen Tag später geschehen. Inzwischen würde sie die Gastfreundschaft des Steuerzahlers genießen.
Um zwei Uhr morgens war Dan zurück in Santa Monica. Michael saß in der Küche und schluckte Aspirin. Er sagte, ihm tue alles weh, als würde er eine Grippe bekommen. Dan riet ihm, schleunigst gesund zu werden und Mom in das Care Center zu schaffen, bevor ihm noch weitere Ausgaben entstünden.
Am nächsten Morgen machte Dan zwei Telefonanrufe, bevor er ins Büro ging. Er rief Scott an und bat ihn, in die Produktion zu fahren und dort zu warten, bis der Cutter die letzten Schnitte am Staengel-Schnüffel-Spot gemacht hatte. Dann sollte er das Band zum COD-Hauptbüro bringen und dafür sorgen, dass es der Produktionsleiter bekam. Anschließend rief Dan den Cutter an und sagte ihm, er könne sich mit dem Spot Zeit lassen.
Nachdem Emmons aus dem Weg geräumt war, fuhr Dan zur Arbeit, um zu sehen, wie man in der Grafikabteilung vorangekommen war. Er fand ein völlig verwüstetes Büro vor – überall Pizzakartons, Pappbecher, leere Getränkedosen, Bierflaschen, Kaffeetassen, ein Spiegel mit weißen Pulverresten und jede Menge volle Aschenbecher. Die gesamte Grafikabteilung plus etliche freie Mitarbeiter hatten die ganze Nacht für die Fujioka-Präsentation gearbeitet. Es war schwer zu sagen, wer schlechter aussah, die Grafiker, die 26 Stunden nicht geschlafen hatten, oder Dan, der eine unruhige Nacht hinter sich hatte wegen der Rechnung, die seine Mutter am Abend zuvor hatte auflaufen lassen.
Dans Laune hob sich etwas, als er sah, was die Grafikabteilung in der vergangenen Nacht geschafft hatte. Die Gestaltung war funktional, aber witzig, und das Logo der Gesellschaft organisch integriert. Er hoffte nur, dass der multikulturelle Appeal groß genug sein würde, um die Herren bei Fujioka zu überzeugen.
Die Präsentation begann um drei Uhr. Oren und Dan lieferten eine makellose Vorstellung. Eine Stunde später verließen sie den Konferenzraum mit einem Einhundert-Millionen-Dollar-Etat in der Tasche und bestellten sofort einen Partyservice, um den Start in die More is more-Kampagne gebührend zu feiern.
Wenige Stunden später war der Konferenzraum der Prescott Agency völlig verwandelt. An den Wänden hingen Fujioka-Logos und Dutzende der neuen More is more-Poster. In der Mitte des Konferenztisches hatte der Caterer in Anspielung auf das Motiv der Werbekampagne einen kleinen, trotzdem sagenhaft teuren spiegelnden Teich aus erstklassigem Belugakaviar geschaffen. Am Rand des Teichs saß ein großer Marzipan-Zen-Meister im Lotossitz. Die restliche Tischfläche war mit pikanten Köstlichkeiten voll gestellt, die dem Thema entsprechend gestaltet waren – zum Beispiel kleine Stereoanlagen aus Ziegenkäse und Großbildfernseher aus Gänseleberpastete.
Die Bars an beiden Enden des länglichen Raums waren von den durstigen Angestellten belagert. Die Stimmung war bestens, man gratulierte sich und prostete sich zu.
Dan setzte eine begeisterte Miene auf und machte auf Enthusiasmus, aber er merkte, dass er allmählich nachließ. Müde verzog er sich in eine Ecke und schaute der Feier zu. Genießen konnte er sie nicht. Er wusste, dass er Scott nicht auf die Dauer hinters Licht führen konnte; und wenn Scott herausfand, was geschehen war – nun, Dan wollte lieber nicht daran denken. Alles, woran er im Augenblick dachte, war Schlafen. Er unterdrückte ein Gähnen und lüpfte seine Armani-Brille etwas, um sich die Augen zu reiben.
»Ich hätte etwas gegen Müdigkeit«, sagte eine Stimme. Es war André von der Grafik. André war ein ganz tüchtiger Grafiker, wurde aber vor allem wegen seiner zuverlässigen Kokain-Connections gehalten, die es der Grafikabteilung ermöglichten, mit Eilaufträgen wie dem von letzter Nacht fertig zu werden. André lächelte schüchtern und strich mit dem Finger über seine Oberlippe.
Dan zögerte. Er hatte seit wer weiß wann nicht mehr geschnupft. Gerade jetzt schien es eine großartige Idee zu sein. Er fragte sich nur, ob es guter Stoff war oder einer, der schon ein Dutzend Mal gestreckt worden war. »Ist es stärker als Puderzucker?«, fragte er.
André zwinkerte. »Ein Tupfer reicht, um Sie munter zu machen.«
»Wie viel?«, fragte Dan und rieb den Daumen gegen die Fingerkuppen.
André legte Dan die Hand auf die Schulter. »Das geht auf Kosten des Hauses«, sagte er, während er mit der anderen Hand ein braunes Fläschchen in Dans Jackentasche verschwinden ließ. »Herzlichen Glückwunsch, Dan. Denk gelegentlich an mich, wenn du im großen Eckbüro sitzt.« André wandte sich ab und steuerte die Herrentoilette an.
Dan war schon jetzt etwas munterer geworden. Er ging zur Bar, holte sich einen neuen Drink und wollte sich eben davonschleichen, um eine Line zu ziehen, als er von Oren aufgehalten wurde. »Nun, hast du schon die Pressemeldung aufgesetzt?« Dan sah ihn verwirrt an. »Wegen des Etats?«
Oren lächelte und legte den Arm um Dan. »Wegen des neuen Partners der Prescott Agency« Er drückte Dan kräftig die Schultern.
Dan hatte das Gefühl, sein Leben in einer Achterbahn zu verbringen. Im Augenblick sauste sie in den Himmel. »Partner? Du willst mich auf den Arm nehmen.«
»Mit solchen Dingen scherze ich nicht«, sagte Oren. »Du hast eben unseren verdammten Gesamtumsatz verdoppelt. Ich schätze, wenn ich dich nicht einsteigen lasse, wirst du deinen eigenen Laden aufmachen und Fujioka mitnehmen.«
Dan strich sich den Bart und genoss diesen Augenblick. Es war der Augenblick, auf den er gewartet und den er seiner Meinung nach auch verdient hatte. »Oren, ich möchte nur sagen ...«
»Du Dieb! Du hundsgemeiner Dieb!«
Das wollte ich eigentlich nicht sagen, dachte Dan. An der Tür war eine heftige Bewegung entstanden, und Dan sah aus dem Augenwinkel, dass Scott Emmons wie ein Kung-Fu-Kämpfer auf ihn zuflog.
»Du Hurenbock hast meine Idee geklaut!« Scott prallte gegen Dan und warf ihn rücklings auf den Konferenztisch. Dan flog das Glas aus der Hand, das den Marzipan-Zen-Meister enthauptete, bevor es auf dem Boden landete. »Ich zerleg dich mit einer verdammten Kettensäge!«, brüllte Scott.
Oren zog sich aus der Kampfzone zurück und dachte, dass Scott aussah, als meinte er, was er sagte.
»Schafft mir den Kerl vom Hals!«, schrie Dan. »Nun macht schon!«
Wie sich herausstellte, war Scott, nachdem er den Staengel-Schnüffel-Spot bei COD abgeliefert hatte, in die Agentur zurückgekommen, um zu sehen, ob er noch etwas für Dan tun konnte, bevor er nach Hause ging. Dans nichts ahnende Assistentin erzählte Scott, dass Dan den Fujioka-Etat an Land gezogen hatte mit seiner fantastischen More is more-Idee und dass im Konferenzraum eine große Party lief, um das Ereignis zu feiern. Sie lud Scott zu der Party ein.
Und Scott ging hin. »Du dreckiger Bastard!«, brüllte Scott. Oren war entsetzt. Er wollte nicht, dass man seinen kreativsten Mitarbeiter mit einer Kettensäge zerlegte. Trotzdem war er nicht bereit, sich in das Handgemenge einzumischen und zu riskieren, Ziegenkäse aufs Hemd zu bekommen. Aber irgendetwas musste er tun. »Ruft den Sicherheitsdienst!«, rief er.
Während Scott den Kopf des dreckigen Bastards und hundsgemeinen Diebs beutelte und in den Kaviarteich tunkte, gelang es Dan, sich zu besinnen. Er rang mit Scott, bis sie auf dem Boden landeten, wo sie verbissen weiterkämpften. Unter wüsten Beschimpfungen schlug Scott auf Dan ein und war so versessen darauf, ihm die Augen auszukratzen, dass er nicht mitbekam, was Dans Hände machten.
Einen Augenblick später kamen die Sicherheitsleute. Es waren ein paar kräftige junge Männer der Universitätsfußballmannschaft, die hier als Teilzeitkräfte arbeiteten, bis sie einen Agenten oder Sponsor fanden, der ihnen unter dem Tisch Bares reichte. Oren, der wirklich auf jede mögliche Weise helfen wollte, wies den Sicherheitsleuten die Richtung, in der die Schlägerei stattfand. Die Jungs holten Scott von Dan herunter und hielten ihn fest. Dan lag immer noch auf dem Boden. Er deutete verstört auf Scott. »Der ist verrückt!«, schrie er. »Besoffen oder was weiß ich! Haltet mir diesen Kerl vom Leib!« »Deine Hoden kriegt mein Hund zu fressen! Das schwör ich dir!«, brüllte Scott.
Er wehrte sich und stieß wilde Drohungen aus, so dass ihm einer der Sicherheitsleute eine Hand voll von dem essbaren Fernseher in den Mund stopfte. Während Scott an der Gänseleberpastete würgte, durchsuchten die Männer seine Taschen. Sie fanden Autoschlüssel, eine Brieftasche, etwas Heftpflaster und ein braunes Fläschchen mit einem kristallinen weißen Pulver.
»Sieht aus wie Methadon«, sagte einer der Männer.
Ein anderer schüttelte den Kopf. »Kokain.«
Scott drehte den Kopf und blickte über die Schulter. »Was?! Das gehört mir nicht!«
»Er ist ein gottverdammter Junkie!«, brüllte Dan. »Er ist verrückt. Ruft die Polizei! Schafft ihn raus! Er ist ein verdammter Dealer!«
In seinem ganzen armseligen Leben hatte Scott kein Haschisch geraucht, geschweige denn Kokain geschnupft. Nicht, dass er grundsätzlich etwas dagegen hatte – er hatte nur viel zu viel Angst, um so etwas zu tun. Scott wusste, dass die Sicherheitsleute keinen Grund hatten, ihm das Kokain unterzujubeln, folglich konnte es nur Dan gewesen sein. Nun war Scott wegen der Fujioka-Sache schon reichlich aufgebracht, aber das hier gab ihm den Rest. Er wurde so wütend, dass er seine Wut nicht mehr artikulieren konnte. Er lief puterrot an und sah schlicht psychotisch aus.
Die Sicherheitsleute zogen Scott an den Armen hoch und trugen ihn aus dem Saal. Da fand Scott endlich die Sprache wieder. »Der Mistkerl hat mich reingelegt! Es war meine Idee! Ich bring dich um, Steele! Verlass dich drauf! Du bist ein toter Mann!«
Oren sah zu, wie sich der immer noch auf dem Boden sitzende Dan den Kaviar aus dem gepflegten Haar kämmte. Es schien glaubhaft, dass Dan Scotts Idee gestohlen hatte. Ob das mit den Drogen stimmte, konnte er nicht beurteilen, aber er hegte den Verdacht, dass Dan dem armen Kerl den Koks in dem ganzen Durcheinander zugesteckt hatte. Ist das mein neuer Geschäftspartner? Oren verschränkte die Arme und setzte ein strahlendes Lächeln auf. Er sah aus wie ein stolzer Vater.
Pater Michael fühlte sich immer noch so, als brüte er eine Krankheit aus. Er hatte schmerzhafte Bauchkrämpfe und wäre am liebsten sofort zu einem Arzt gegangen. Aber er musste zuerst nach Van Nuys, um bei Ruths Zurechnungsfähigkeitsprüfung und ihrer Vorführung beim Haftrichter dabei zu sein. Dan sprach davon, sie einfach im Gefängnis zu lassen, aber Michael konnte ihn dazu bewegen, einen Scheck für ihre Kaution auszustellen.
Ein vom Gericht bestellter Psychiater bestätigte, dass Ruth ohne ihre Medikamente keine Kontrolle über ihre Handlungen hatte. Seine Beurteilung stützte sich auch auf die Geiselaffäre und etliche andere Vorfälle. Der Richter schloss sich der Meinung des Psychiaters an, dass Ruth strafrechtlich nicht verfolgt werden konnte. Die zivilrechtlichen Klagen auf Schadenersatz konnten damit aber nicht ausgeschlossen werden. Ruth wurde in Michaels Obhut entlassen.
An diesem Tag sah Michael seine Mutter nach fünf Jahren zum ersten Mal wieder. Er hatte sich auf ein fröhliches Wiedersehen gefreut, aber nach der Nacht im Gefängnis war Ruth erschöpft und niedergeschlagen, und Michael konnte sagen, was er wollte – seine Mom sprach nicht mit ihm. Er wusste nicht, ob sie sich aufgrund eines Stimmungstiefs so verhielt oder ob sie immer noch böse auf ihn war, weil er nach Afrika gegangen war. Er wusste, dass sie sich von ihm verlassen fühlte, als er ging, aber inzwischen, so hoffte er, war sie doch sicher darüber hinweggekommen. Er wünschte sich, dass sie sagte: »Ich liebe dich, Sohn.« Gerade jetzt hätte er ein solches Wort dringend gebraucht.
Michael dehnte seine steifen Halsmuskeln, während er Ruth aus der Polizeistation führte. Er fragte sich, warum sein Hals so verspannt war. »Ich habe hinter dem Haus geparkt«, sagte er. Sie gingen langsam über den Parkplatz zu Michaels altem VW-Bus, den er bei einem Freund untergestellt hatte, während er in Afrika war. »Wir fahren nicht mehr ins Altenheim«, sagte er. »Wir fahren nach Sylmar, wo ich arbeiten werde. Deine Sachen werden dir nachgeschickt.« Er öffnete die Wagentür, damit Ruth einsteigen konnte.
Ruth kletterte in den Bus. Michael beugte sich vor, um ihr den Gurt anzulegen. Ruth sah ihn an. »Du siehst schrecklich aus«, sagte sie. »Du solltest zum Arzt gehen.«
Sylmar, ein Stadtteil mit überwiegend Spanisch sprechender Bevölkerung, lag auf der anderen Seite der Schienen, die parallel zur San Fernando Road verliefen, ziemlich genau dort, wo die Ausläufer der Santa Susanna Mountains auf die San Gabriels treffen. Sylmar war an drei Seiten von Schnellstraßen umgeben; es war schmutzig und staubig, es gab zwar viel Grün, aber auch das war schmutzig und staubig. Im Lauf der Jahre hatte sich die Gegend zu einem Wirrwarr aus billigen Wohnhäusern und kleinen Betrieben entwickelt. Aus dem früheren Rancherland und den Zitrus- und Olivengärten war eine verlotterte Vorstadt geworden – vielleicht nicht unbedingt eine Hölle, aber gewiss nicht Pacific Palisades.
Pater Michael verließ den Freeway an der Polk Street und bog an der Adventistenkirche rechts ab. Ein paar Querstraßen weiter, nach der Kirche der Mariae Unbefleckte Empfängnis und der katholischen Kirche Die Heilige Familie erreichten sie das Care Center. Es war ein großes zweistöckiges Wohnhaus aus den dreißiger Jahren, gelb wie Wüstensand, mit einem braunen Dach und verwitterter Holzverschalung. Es stand etwas zurückgesetzt vor einem vielleicht zweitausend Quadratmeter großen Platz, auf dem zwischen Kies und niedergetrampeltem Rasen das Unkraut wucherte. An der Ostseite des Hauses lehnte eine Art Pergola, deren rückwärtiger Teil mit einer blauen zerrissenen Vinylplane abgedeckt war und offensichtlich als Garage diente. Darunter stand Bertha.
Schwester Peg kam aus dem Haus, um sie zu begrüßen. »Sie müssen Pater Michael sein«, sagte sie. »Willkommen im Care Center.«
Pater Michael versuchte, die Schwester nicht anzustarren, aber er fand ihre Augen unwiderstehlich. Sie waren braun, von einer engelhaften Liebenswürdigkeit und entzückend umrahmt von der Nonnenhaube. »Ich freue mich, Sie kennen zu lernen, Schwester«, sagte er. Er war überrascht von der Wirkung, die ihre Augen auf ihn hatten, und es dauerte etwas, bis er merkte, dass eine peinliche Pause entstanden war. »Oh! Ja, das ist Ruth, meine Mutter«, sagte er. »Es geht ihr nicht gut. Aber ich denke, sie braucht nur ein wenig Ruhe.« Ruth blickte kein einziges Mal auf und sagte kein Wort. Sie fühlte sich wie ein Ladenhüter, der von einer Ecke in die andere geschoben wird.
»Ich verstehe«, sagte Schwester Peg. »Ihr Zimmer ist hergerichtet.« Sie blickte auf ihre Uhr. »Am besten, wir gehen gleich nach oben. Danach zeige ich Ihnen alles, wenn wir noch Zeit haben.«
»Sehr gut.« Pater Michael führte seine Mom mit sanftem Druck ins Haus.
Schwester Peg fühlte sich durch Pater Michaels angenehmes Auftreten und sein zärtliches Lächeln ermutigt. Dass er neben seiner Mutter ging und nicht vor ihr, verriet die Art von Geduld, Freundlichkeit und Respekt, die die meisten Menschen nicht mehr für nötig hielten. Sie war sehr froh, dass er gekommen war.
Schwester Peg führte Pater Michael und Ruth in das Zimmer, in dem Mr. Smith gewohnt hatte. Es war das kleinste Schlafzimmer im Haus und das einzige mit Privatsphäre. Während Pater Michael den kleinen Koffer auspackte, saß Ruth auf der Kante ihres neuen Betts und blickte schweigend aus dem Fenster. »Ruh dich ein bisschen aus, Mom. Ich sehe später nach dir.« Er küsste sie auf die Stirn.
Draußen erzählte Pater Michael der Schwester die Geschichte von dem gestohlenen Sattelschlepper und versicherte ihr, dass seine Mom jetzt wieder ihre Medikamente nahm. Schwester Peg sagte, er brauche sich keine Sorgen zu machen. »Ihre Mom ist in guten Händen«, sagte sie mit einem aufmunternden Lächeln. Sie blickte wieder auf ihre Uhr. »Ich muss in einer halben Stunde auf der anderen Seite des Tals sein. Ich führe Sie ganz schnell herum. Dann muss ich los.« Sie zeigte ihm den Rest des Stockwerks. Es gab acht Schlafzimmer, die größtenteils mit älteren Bewohnern belegt waren. Am Ende des Flurs war ein Bad, das von allen benützt wurde, und daneben lag ein kleiner Aufenthaltsraum mit Tisch und Stühlen, Spielkarten und zwei alten Puzzlespielen.
Am Fuß der Treppe gab es ein weiteres Schlafzimmer, in dem ein ungefähr siebenjähriges Mädchen untergebracht war. Schwester Peg klopfte an, bevor sie hineinging. »Hi, Alissa. Das ist Pater Michael.«
Alissa sah aus ihren grünen Augen argwöhnisch zu ihnen auf. Dünne blonde Ponyfransen hingen über ihre Stirn, und sie hatte schreckliche blaugrüne Flecken im Gesicht, die offensichtlich von Schlägen herrührten. Ihre Arme sahen wie Beweismaterial für Misshandlung aus. Sie saß an die Wand gelehnt auf dem Boden und hielt eine alte Puppe auf dem Schoß.
Pater Michael wollte in das Zimmer hineingehen, aber Schwester Peg hielt ihn zurück, denn Alissa zuckte merklich zusammen. Und die plötzliche Härte in ihrem Gesicht schien zu sagen, dass sie jede Misshandlung, die ihr zugedacht war, ertragen würde. »Es ist okay«, sagte Schwester Peg. »Wir wollen dich nicht stören.«
Schwester Peg führte Pater Michael weiter den Gang entlang.
»Es war ihr Vater«, erklärte sie in abfälligem Ton. »Ich habe das Sorgerecht, bis er aus dem Gefängnis kommt.«
»Ist die Mutter auch im Gefängnis?«
»Ich weiß nicht einmal, wer sie ist«, sagte Schwester Peg. Sie sah Pater Michael an und brauchte nichts weiter zu sagen. Sie hatte solche Geschichten schon tausendmal erlebt, und er hatte bestimmt noch Schlimmeres gesehen. Schweigend gingen sie über das letzte Stück des Ganges.
Schwester Peg zeigte Pater Michael rasch die Küche, das Büro und schließlich das Fernsehzimmer, in dem viele der älteren Bewohner ihre Tage und Nächte verbrachten, um im Fernsehen ein schöneres Leben zu leben. Im Augenblick war von ihnen nur Mr. Saltzman hier, ein griesgrämiger Mann von 78 Jahren, der so aussah, als hätte er mehr mitgemacht als die meisten. Er saß auf der vorderen Kante seines Stuhls und hielt seine dicken Arme fest an die Brust gedrückt. Ein paar graue Haarsträhnen zogen sich über seinen bräunlich gefleckten Schädel. Er sah einen Sender, der die letzte Verfolgungsjagd auf den L.A.-Freeways brachte. »Dämliche Kerle«, brummte er vor sich hin. An der anderen Seite des Zimmers, an einem der Fenster, saß ein großer hispanischer Junge – ein Sechzehnjähriger im Körper eines muskulösen Achtzehnjährigen. Sein dunkles Haar war kurz geschnitten. Er trug weite Hosen und ein in allen Regenbogenfarben verfärbtes T-Shirt. Er saß mit einem Bleistift in der Hand über einen Zeichenblock gebeugt und blickte nicht auf, als Schwester Peg und Pater Michael hereinkamen. »Das ist Ruben«, sagte Schwester Peg. »Unser hauseigener Künstler.«
»Hi, Ruben«, sagte Michael und hob grüßend die Hand. Ruben blickte nicht von seiner Zeichnung auf. Pater Michael wartete einen Augenblick. »Anscheinend lässt er sich nicht ablenken.« Schwester Peg schüttelte den Kopf. »Er ist taub. Er kam vor ein paar Jahren zu uns, weil er aus einer Gang herauswollte. Jetzt gehört er zu meinen unterbezahlten Angestellten. Alles, was schwer zu heben ist, macht er. Deshalb wird er froh sein, dass Sie jetzt hier sind.« Schwester Peg stampfte einmal mit dem Fuß auf, und Ruben blickte auf. Er lächelte und zeigte ihr, woran er arbeitete. Es war keine Zeichnung. Er hatte einen Lotterieschein ausgefüllt. Im Jackpot waren 32 Millionen Dollar. Er faltete die Hände wie zum Beten und grinste.
Schwester Peg stellte Pater Michael vor, indem sie langsam, aber sehr anmutig Zeichen machte. Ruben strich sich als Antwort mit den Fingernägeln vom Hals zum Kinn. Obwohl die Geste wie eine italienische Drohung aussah, vermittelte Ruben mit seinem breiten Lächeln das Gefühl, dass er sich freute, einen unterbezahlten Kollegen zu haben. Er grüßte Pater Michael mit einer kurzen Aufwärtsbewegung des Kopfes, dann wandte er sich wieder dem Samstagslotto zu – der staatlichen Version von Hoffnung und Erlösung.
»Was malt er denn sonst so?«
»Er ist ein wahrer Zauberkünstler mit der Spraydose«, sagte Schwester Peg. »Manchmal macht er auch Plastiken. Ich glaube, er hat Talent, aber im Grunde kann ich so etwas nicht beurteilen.« Sie wandte sich um und ging zur Tür.
Pater Michael blieb unvermittelt stehen. Er hatte wieder einen dieser Bauchkrämpfe. Leicht vornübergebeugt drückte er zwei Finger unter die Rippen, um den Schmerz zu lindern. Dieser Anfall war schlimmer als die vorherigen. Wenn das nicht aufhörte, musste er einen Arzt aufsuchen.
Pater Michael folgte Schwester Peg, die stehen geblieben war, um das Ende der Verfolgungsjagd in den Nachrichten zu sehen. Inzwischen hatte der Moderator bereits eine neue Story angekündigt und schaltete um zu einem Reporter, der in einem riesigen Lagerhaus irgendwo in Los Angeles stand. »Danke, Bob«, sagte der Reporter. »Sie wissen vielleicht noch, dass man früher sagte, der Mond sei aus grünem Käse gemacht. Und wenn Sie sich mal gefragt haben, wie viel Käse man wohl dafür bräuchte, kann Ihnen der Inhalt dieses Lagerhauses eine ziemlich gute Vorstellung davon vermitteln.« Die Kamera fuhr zurück, um ein riesiges Lagerhaus zu zeigen. Der Reporter erklärte, dass das fünfundfünfzigtausend Quadratmeter große Lagerhaus bis unter die Decke mit Käse und anderen Milchprodukten gefüllt war. »Und das alles ist nichts anderes als Hartkäse von unseren kalifornischen Milchbauern. Dieses Lagerhaus ist ein Teil, und zwar nur ein kleiner Teil der komplexen Gesamtstrategie der Regierung, um die Milchwirtschaft vor einem Preisverfall durch billigere Importerzeugnisse zu schützen. Oh, und noch etwas«, sagte der Reporter. »Wenn ich wiedergeboren werden sollte, würde ich gern hier zur Welt kommen ... und zwar als Maus!« Der Reporter lachte. »Zurück ins Studio.«
»Mein Gott, wie mich so etwas ankotzt!« Schwester Peg wandte sich ab, um zu gehen.
Pater Michael folgte ihr. »Die Verschwendung oder das alberne Geschwätz?«
»Tut mir Leid, Pater. Ich will ja nicht gleich einen schlechten Eindruck machen, aber eine solche Scheiße regt mich wahnsinnig auf«
»Glauben Sie mir, ich verstehe Sie.« Er dachte an die absurde Politik von Kirche und Staat, mit der er in Afrika konfrontiert war. Dank dieser Politik gingen tonnenweise Lebensmittel und Medikamente verloren, bevor sie die kranken und hungernden Flüchtlinge erreichten. »Aber was soll man machen?«, sagte er. Es war eine rein rhetorische Frage.
»Geben Sie mir eine Minute«, sagte Schwester Peg. »Ich lasse mir etwas einfallen.« Sie blickte auf ihre Uhr. »Okay, ich muss Los. Ich seh Sie morgen früh, Pater.«
»Selbstverständlich.« Pater Michael wollte eben die Treppe hinaufgehen, um nach seiner Mutter zu sehen, als er einen weiteren Krampf bekam. Er krümmte sich vornüber und beschloss, zu einem Arzt zu gehen.
Scott Emmons lag im Bademantel auf dem Sofa und glotzte in den Fernseher. Zwischen zwei Talkshows sah er den Werbespot zum ersten Mal. Er begann mit dem Zen-Meister, der am Rand eines spiegelblanken Teichs saß. Als Scott das neonrote Fujioka-Logo sah, das sich im schwarzen Wasser spiegelte, setzte er sich so schnell auf, dass ihm kurz schwindlig wurde. Es sah genau so aus, wie er es sich vorgestellt hatte. Er rückte näher an den Bildschirm heran, während er jede Einzelheit registrierte.
Auf dem Boden vor dem Zen-Meister stand eine kleine Kompaktanlage. Sobald die Szene stand, hob der Zen-Meister die Hand und drückte die PLAY-Taste des Kassettenrecorders. Die besinnlichen Klänge eines koto schwebten wie flüssige Seide durch den Raum. Der Zen-Meister blickte ruhig auf. »Ein weiser Mann sagte einmal: weniger ist mehr.« Er hielt inne, als dächte er über den Satz nach. »Aber nach einigem Nachdenken korrigierte sich der Mann.«
Der Zen-Meister drückte die STOP-Taste und die Musik verklang. Plötzlich geriet die spiegelnde Oberfläche des Teichs in Bewegung. Das Fujioka-Logo schimmerte, während aus der schwarzen Tiefe etwas emporstieg. Ein riesiger Großbildschirm-Fernseher mit einem gewaltigen Unterbau aus Stereoanlage und großen Lautsprechern erhob sich geräuschlos aus dem Wasser und überragte den Zen-Meister, der grinsend zu dem Gerät aufblickte. Der Zen-Meister nahm eine Fernbedienung aus den Falten seines Gewandes und richtete sie auf den wundervoll glänzenden Apparat. Er lächelte, dann drückte er die PLAY-Taste.
Bildschirm und Stereo explodierten mit einem wahnsinnigen Acid-Jazz-Metal-Rap-Rock-Musikvideo. Der Zen-Meister lächelte wissend und nickte anerkennend im Rhythmus der Musik. Eine Ansagerstimme beendete den Spot mit den schlichten Worten: »Fujioka Electronics. More is more.«
Scott versuchte zu schreien, aber es kam kein Ton aus ihm heraus. Er versuchte es noch einmal mit der ganzen Kraft seiner Enttäuschung, aber umsonst. Durch die Anstrengung, die Luft aus der Lunge auf die Stimmbänder zu pressen, schwollen seine Halsschlagadern an wie dicke blaue Schlangen. Scott begann zu zittern, als er daran dachte, was Dan ihm gestohlen hatte, und als sein Gesicht rot angelaufen war und sein Körper zu platzen drohte, wurde Scott ohnmächtig und fiel mit dem Kopf auf den Sofatisch.
Dan gab Michael zwanzig Dollar und die Schlüssel für seinen Wagen. »Tu mir einen Gefallen«, sagte er, »und bleib lange weg.«
Am Freitag hatte Beverly endlich auf Dans Anruf geantwortet. Sie dankte ihm für die Rosen und sagte, sie würde Samstagabend in der Stadt sein. »Ich möchte dich sehen«, sagte sie. »Du warst ein böser Junge, mich so sitzen zu lassen. Ich denke, dafür musst du bestraft werden.«
»Ich war sehr böse«, sagte Dan. »Aber ich bin bereit, meine Strafe auf mich zu nehmen wie ein Mann. Sag mir nur, wo und wann.« »Morgen Abend bei dir, damit du mich nicht wieder so leicht versetzen kannst«, sagte sie. »Ich komme so gegen acht mit ein paar neuen Spielsachen, von denen ich annehme, dass du drauf stehst.« Klick.
Dan hatte keine Ahnung, was das für Spielsachen waren, aber er war auf jeden Fall dafür zu haben. Am Samstag ging er einkaufen. Er kaufte einen Vorrat an Batterien für den Fall, dass Beverlys Geräte Energiefresser waren. Er warf seine alten Kondome weg, deren Haltbarkeitsdatum möglicherweise abgelaufen war, und ersetzte sie durch neue. So großartig wie er sich fühlte, kamen nur die großen gerippten dunkelroten in Frage.
Wieder zu Hause, schaltete er die Stereoanlage an, und dann kochte er. Er sang laut seinen alten Lieblingssong All I ask of you ... is to make my wildest dream come true ... Er legte zwei herrliche Sägebarschsteaks in eine Marinade aus süßem Ingwer und Sojaöl, um sie später mit Frühlingszwiebeln und Shiitakes zu dünsten. Er verbrachte eine ganze Stunde, um seine Lieblingsvorspeise, eine Asienpfanne, vorzubereiten. Der Wein war ein schmeichelnder kalifornischer Chardonnay. Beverly war der Nachtisch.
Dans Timing war perfekt. Er war geduscht, geföhnt und angezogen und hatte noch zehn Minuten Zeit. Er goss sich ein Glas Chardonnay ein, legte Count-down to Ecstasy auf, setzte sich zum Entspannen auf das Sofa und dachte: Gott ist gut.
Beverly kam wie eine Sturmwolke in einer durchsichtigen Bluse und genietetem Lederkragen. Ein enger Minirock gab den größten Teil ihrer wundervollen nackten Beine frei. Satanisch grüne Augen blitzten unter einem glänzenden braunen Pony. Sie hatte einen kleinen Kosmetikkoffer bei sich, in dem Dan Beverlys bizarres Spielzeug vermutete. Dan bekam schon eine Erektion, wenn er nur daran dachte. »Die Vorspeise ist fast fertig«, sagte er, als sie ins Wohnzimmer schlenderte. »Sichuanklößchen.«
»Wir essen später«, sagte Beverly und hielt Dan an der Gürtelschnalle fest. »Zuerst bekommst du deine Strafe.« Sie führte ihn ins Schlafzimmer und öffnete seinen Reißverschluss.
»Wie schnell schaffst du es, aus diesen Hosen herauszukommen?« Dan war nackt, bevor sie »abwegige Neigungen« sagen konnte. »Möchtest du mich berühren?«, fragte Beverly. Sie legte Dans Hände auf ihre Brüste und schloss die Augen. »Möchtest du etwas mit mir machen?« Dan begann, sprachlos vor Verblüffung, an den Knöpfen ihrer Bluse zu fummeln. Beverly nahm seine Hände und schob ihn in Richtung Bett. »Leg dich hin«, befahl sie. Dan gehorchte. »Du warst sehr unartig. Ich werde nicht gern versetzt. Es ist erniedrigend.«
»Es tut mir Leid.« Dan hatte noch keine Erfahrung mit Sadomaso, deshalb wusste er nicht, was er sagen sollte. »Wirst du mich verhauen?«
»Du wirst genau das bekommen, was ein böser Junge verdient«, sagte Beverly. »Und es wird richtig geil sein.« Sie öffnete ihr Köfferchen und nahm ein Paar schön verchromte Handschellen und einige Stricke heraus. Dan schluckte aufgeregt. Er war bereit, sich zu unterwerfen, sich dominieren zu lassen, auf allen vieren zu kriechen und wie ein Wolfshund zu bellen. Er würde alles tun, was sie verlangte.
Einen Augenblick später waren Dans Beine gespreizt und an den Bettpfosten festgebunden. Beverly stieg auf das Bett und stellte sich über Dan. Langsam ging sie, ein Bein rechts, ein Bein links von ihm, auf seinen Kopf zu. »Gefällt dir, was du siehst?« Dan sah, was sie meinte. O mein Gott, sie trägt kein Höschen. Ejaculatio praecox wurde zur berechtigten Sorge. Beverly ließ sich nieder, bis sie auf Dans Brust saß. »Gib mir deine Hände«, sagte sie.
Kurz darauf waren Dans Hände an den Kopfteil des Bettes gefesselt, und er sah gespannt zu, als Beverly eine Tube mit einer Creme oder einem Gleitmittel aus ihrem Köfferchen nahm. Er konnte kaum erwarten, was sie damit machte. »Mach die Augen zu«, sagte sie. »Böse Buben dürfen nicht zusehen.«
Dan gehorchte. Er fragte sich, wie lange er an sich halten könnte. Die Luft füllte sich mit dem Duft von Minze. Dan vermutete, es sei irgendein parfümiertes Gleitmittel und konnte die Anwendung kaum erwarten.
Beverly streichelte die Innenseiten von Dans Schenkeln. »Das wird großartig«, wiederholte sie.
Dan glaubte ihr von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Er bebte vor Erregung, als Beverly ihn sanft in beide Hände nahm. Sie massierte die Creme in sein drittes Bein und dann, mit federleichter Hand, in seine Hoden. Dan wäre in diesem Moment als glücklicher Mann gestorben.
»Also«, sagte Beverly. »Tut’s dir nicht Leid, dass du mich umsonst hast warten lassen?«
Mmm, ooh, dachte Dan. Aber der Ton ihrer Stimme war nicht in Ordnung. Er schlug die Augen auf, als Beverly vom Bett kletterte. Sie schraubte den Verschluss auf ein Döschen Tigerbalsam. »Das macht richtig schön scharf«, grinste sie.
Dan begriff, dass er einem Lockvogel in die Falle gegangen war. Zuerst entschuldigte er sich. Dann bettelte er. Schließlich versuchte er, Beverly zu bestechen, aber sie war nicht interessiert. Sie klappte ihren Kosmetikkoffer zu, dann deutete sie auf Dans schwindenden Mannesstolz. »Und übrigens«, sagte sie spöttisch, »weniger ist weniger.«
Dan wimmerte, als sie die Wohnungstür hinter sich ins Schloss fallen ließ. Nie hätte er gedacht, dass ein Mädchen so grausam sein könnte.
Michael kam ein paar Stunden später zurück. Er hatte nicht die Absicht, zu seinem Bruder hineinzuschauen, doch die Hilferufe klangen so dringend und echt, dass er sie nicht ignorieren konnte. Er ging in Dans Schlafzimmer und sah ihn dort liegen. Das hervorstechendste Merkmal an ihm war sein schweißnasses, tief enttäuschtes Gesicht. Dan hob den Kopf und sah Michael an. »Vergib mir, Pater, denn ich habe gesündigt.«
Als Michael zu lachen aufhörte, band er seinen Bruder los, und schließlich gelang es ihm auch, das Handschellenschloss zu knacken.
»Ich sollte dir eine Buße auferlegen«, sagte Michael, »aber ich denke, das wäre doppelt gemoppelt.«
Es dauerte eine Weile, aber schließlich fand Schwester Peg den Mann, den sie suchte. Er saß in der Innenstadt von Los Angeles, tief versteckt in einem Gebäudekomplex, der die verschiedenen Abteilungen des kalifornischen Landwirtschaftsministeriums beherbergte.
Schwester Peg hatte einen Termin bei einem Mr. Churchill, dem Assistenten des stellvertretenden Sachbearbeiters des Amtsleiters unter dem stellvertretenden Direktor der Abteilung für Entwicklung, Planung und Management innerhalb des Amtes für Verordnungen und strategische Initiativen für das Ressort Wirtschaftspolitik und Vollzug des Landwirtschaftsministeriums. Mr. Churchill war Ende fünfzig. Er trug ein blaues Hemd, Hosenträger aus geflochtenem Leder und eine eindrucksvolle Krawatte in Rot und Gold. Eine starke Brille mit einem übergroßen schwarzen Gestell verdeckte fast sein ganzes Gesicht und vergrößerte seine Augen, dass er wie ein fischäugiger Clown aussah. Dieser Mr. Churchill tat sein Bestes, Geduld zu bewahren, als Schwester Peg erneut um eine Erklärung bat. »Aber der Käse liegt doch dort herum. Warum können Sie nicht etwas davon für die Armen abzweigen?«
Mr. Churchill seufzte, um die Nonne wissen zu lassen, dass sie sehr anstrengend war. »Weil – wenn wir den Käse verschenken, die Leute, die ihn umsonst bekommen, keinen mehr kaufen müssen, und das würde dem Sinn des Subventionsprogramm doch zuwiderlaufen, nicht wahr?«
»Aber ich spreche von Menschen, die kein Geld haben«, erwiderte Schwester Peg sehr geduldig. »Sie könnten den Käse gar nicht kaufen, selbst wenn sie es wollten. Aber sie würden sehr gerne wollen, Mr. Churchill – nur, sie können es sich nicht leisten, weil sie arm sind. Verstehen Sie, was ich meine?«
Mr. Churchill begegnete dieser Argumentation immer wieder, und sie ärgerte ihn jedes Mal. Er verstand nicht, wie in der allgemeinen Bevölkerung so viel Unkenntnis über grundlegende ökonomische Prinzipien vorhanden sein konnte. Mit Worten allein schien er nicht weiterzukommen, deshalb entschloss er sich, zu einem visuellen Hilfsmittel zu greifen. Er öffnete eine Schublade und nahm einen sauberen Bogen Millimeterpapier heraus. Dann zeichnete er mit einem schwarzen Stift ein großes »L« auf das Blatt. Er deutete auf das »L«. »Die horizontale Achse stellt den Käsepreis dar, okay?« Dann zeichnete Mr. Churchill zwei schräge, parallel laufende Linien in das »L«, die er aus einem unerfindlichen Grund mit RR und YY kennzeichnete. »Nun ist es so, dass steigende Verbrauchereinkommen die Nachfragekurve verschieben, so dass RR zu YY wird.« Er wies auf die äußere schräge Linie. »Mit anderen Worten – die Verbraucher werden bei steigendem Einkommen mehr Käse kaufen wollen, weil sie sich mehr Käse leisten können. Nachdem wir keine Kontrolle über die Verbrauchereinkommen haben, müssen wir in einem solchen Fall das Käseangebot künstlich verknappen, damit die Nachfrage nach dem vorhandenen Käse steigt und wir den Preis für die Ware stabil halten können.« Er reichte Schwester Peg das Blatt mit der Zeichnung. »Also, beantwortet das Ihre Frage?«
Schwester Peg legte das Blatt auf Mr. Churchills Schreibtisch und bat um den Stift. »Ich will nur sehen, ob ich Sie richtig verstanden habe«, sagte sie, während sie eine eigene Grafik anfertigte. »Diese Achse ist das Einkommen und diese hier die vorhandenen Tonnen Käse. Wenn also nun das Einkommen hier liegt« – Schwester Peg zeichnete eine Linie, die ein Null-Einkommen anzeigte. »Und wenn dies hier der vorhandene Käse ist« – sie zog eine Linie, die eine Menge Käse bedeutete. »Was sagt Ihnen das?« Sie machte einen kleinen schwarzen Punkt auf die Zeichnung.
Mr. Churchill blickte auf den winzigen Punkt und zuckte die Achseln. »Erklären Sie es mir«, sagte er.
»Das ist Ihr Herz, Mr. Churchill. Es ist etwas vergrößert dargestellt, damit Sie das verdammte Ding überhaupt sehen können.«
Nun war das genau die Art von Beleidigung, die sich der Assistent des stellvertretenden Sachbearbeiters des Amtsleiters unter dem stellvertretenden Direktor der Abteilung für Entwicklung, Planung und Management innerhalb des Amtes für Verordnungen und strategische Initiativen für das Ressort Wirtschaftspolitik und Vollzug des Landwirtschaftsministeriums nicht bieten lassen musste. Mr. Churchill kniff die Augen zusammen. »Schwester, vielleicht wird ein kleiner wirtschaftlicher Dämpfer Ihre Leute motivieren, sich eine Arbeit zu suchen. Dann können sie so viel Käse essen, wie sie wollen.«
Schwester Peg ließ die zehn Minuten, die sie hier saß, Revue passieren und fand, dass sie wirklich jede angemessene Zurückhaltung gezeigt hatte. Deshalb langte sie jetzt über den Schreibtisch und packte Mr. Churchill bei seinem rot-goldenen Schlips. Sie zog ihn halb über den Schreibtisch und blickte in seine Fischaugen. »Sie sind ein herzloses Stück Scheiße«, sagte sie wortwörtlich. Dann nahm sie den schwarzen Filzmarker und malte diesem Bilderbuchbürokraten einen Hitlerschnurrbart unter die Nase. »So«, sagte sie. »Helfen Sie mir jetzt oder nicht?«
»Um Gottes willen!«, sagte Mr. Churchill. »Lassen Sie mich los!« Schwester Peg zog etwas kräftiger. »Dafür bräuchte ich ein Motiv«, zischte sie. Schwester Peg hatte einen ausgeprägten Sinn für eine gerechte Verteilung des Wohlstands, selbst wenn es sich dabei um Käse handelte. Sie glaubte, das Wort vom Adel, der verpflichtet, habe auch für den Staat zu gelten, und es machte ihr ausgesprochen Freude, wenn sie etwas tun konnte, um andere von ihrem Glauben zu überzeugen.
Mr. Churchill konnte es nicht glauben. Diese verrückte Nonne kam in sein Büro gelaufen und gab ihm die Schuld für die niedrige Einkommensstufe ihres Kundenkreises – als ob die Kräfte des Marktes und eine saubere Wirtschaftspolitik mit Dingen wie Mitgefühl vermengt werden könnten.
»Ich warte«, sagte Schwester Peg und zog etwas kräftiger an dem rot-goldenen Angeberschlips.
Mr. Churchill rüttelte wie ein Hund an der Kette, um von der selbstgerechten, fanatischen Nonne loszukommen. Aber das machte die Sache nur schlimmer. Er rang nach Luft, um etwas sagen zu können, und brachte schließlich die Worte hervor: »Lassen Sie mich telefonieren ... will sehen, was ich tun kann.«
Mr. Churchill sank auf seinen Sessel zurück, während er die Schlinge um seinen Hals lockerte. Er griff nach einem Papiertaschentuch und verschmierte das Hitlerbärtchen, so dass es ihm schief im Gesicht saß wie das Bärtchen von Groucho Marx. »Weiß die Kirche, wie Sie vorgehen?«, fragte er zwischen keuchenden Atemzügen.
»Nein. Sie sagt, sie sei nicht die Hüterin ihrer Schwestern.« Mr. Churchill griff nach dem Telefon, murmelte etwas und legte wieder auf. »Hilfe ist unterwegs«, sagte er. Und schon erschienen zwei Sicherheitsbeamte, als gehöre ein solcher Vorgang zur Tagesordnung. Sie führten Schwester Peg durch das labyrinthische Gebäude und setzten sie auf dem schmutzigen Fußweg vor dem Eingang ab. Auf dem Weg nach draußen hatte einer der Wachmänner Schwester Pegs Rosenkranz zerrissen, den er ihr, bevor er ins Haus zurückging, vor die Füße warf.
Schwester Peg nahm sich vor, am Abend für Mr. Churchill zu beten. Doch dann änderte sie ihre Meinung. Sie fand, Gott habe wichtigere Dinge zu tun, als sich um einen kleinen Bürohengst zu kümmern, der sein Essen nicht mit den Armen teilen wollte. Sie sammelte die verstreuten Perlen ihres Rosenkranzes ein und überlegte, was sie als Nächstes tun könnte. Dann hatte sie eine Erleuchtung. Sie ging zu einer Telefonzelle und kramte in ihren Taschen nach Kleingeld. Sie hatte keins. Sie hielt einen Mann an. »Entschuldigen Sie, könnten Sie mir einen Vierteldollar leihen?«
Der Mann sah sie an. »Warum sollte ich Ihnen einen Vierteldollar leihen?«
Schwester Peg trat dicht auf ihn zu und schrie: »Weil ich eine Nonne bin! Jetzt geben Sie mir schon den verdammten Vierteldollar!«
Und der Mann gab ihr das Geld. Mit dem Vierteldollar rief Schwester Peg Josie an. »Hi, ich bin’s. Ich muss dich um einen Gefallen bitten.«
Die Leute im öffentlichen San-Fernando-Krankenhaus hätten nicht freundlicher sein können. Niemand fragte nach einem Einkommensnachweis oder einer Krankenversicherung. Sie nahmen Pater Michael einfach beim Wort und schickten ihn zur Untersuchung. Eine Viertelstunde später saß Pater Michael im Untersuchungsraum und wartete auf das Ergebnis der Diagnose.
Der Arzt kam herein und entschuldigte sich. Er sagte, er habe keine Ahnung, was Pater Michael fehlen könnte. »Es sei denn, Sie haben Strychnin geschluckt«, sagte er und fügte etwas über antagonisiertes Glyzin hinzu. »Ich schlage vor, Sie gehen ins Bezirks-Med-Center.«
Also fuhr er dorthin. Das Bezirkskrankenhaus war ein Tollhaus mit blutüberströmten Verletzten, verarmten schwangeren Frauen, umringt von unzähligen kranken Kindern und Menschen aus den Randbezirken des Showgeschäfts, die nicht genug verdienten, um sich eine Krankenversicherung leisten zu können. Bewaffnete Wachen standen neben den Eingängen für den Fall, dass Auftragskiller hereinschneiten, um jemandem, den sie im Vorbeifahren nur verwundet hatten, den Rest zu geben. Kinder schrien, Telefone klingelten und wurden nicht abgehoben; aus den Kabinen der Notaufnahme drang dumpfes Stöhnen, und ständig wurden Ärzte ausgerufen, die sich irgendwo melden sollten.
Inmitten dieses Tohuwabohus stand Pater Michael vor dem Fenster des Aufnahmeschalters und versuchte zu hören, was die Schwester durch den winzigen Schlitz in der kugelsicheren Glasscheibe sagte. Die Schwester sah sich sein Aufnahmeformular an. »Sie haben also gearbeitet als Gegenleistung für eine bezahlte Reise nach Afrika plus Verpflegung und Unterbringung.«
»Nun, nicht direkt«, sagte Pater Michael, während er sich über den steifen Unterkiefer strich. »Ich denke, so kann man das nicht sagen.«
Die Schwester schüttelte den Kopf. »Sehen Sie, so etwas zählt als Einkommen, und das haben Sie hier nicht angegeben.« Sie deutete auf Zeile 23 Punkt (g) auf dem Formular. »Das bedeutet, Sie können nicht auf Kosten der Öffentlichkeit behandelt werden. Tut mir Leid. Der Nächste bitte!«
Pater Michael brachte ein verständnisvolles Lächeln zustande. Er ging in den Warteraum und ließ sich in einen der harten Plastikstühle fallen. Er musste ein paar Minuten rasten, um sich zu sammeln. Er bekam einen weiteren Krampf, der so heftig war, dass er ein paar Sekunden lang keine Luft mehr bekam. Er war krank, und er wusste es. Wohin sollte er sich jetzt wenden? Er hätte bei der Kirche Hilfe suchen können, wäre da nicht in Afrika die Geschichte mit Kardinal Cooper passiert. Pater Michael hatte den Eindruck, dass diejenigen, die helfen wollten, nicht helfen konnten, und diejenigen, die helfen konnten, nicht helfen wollten. Er bückte sich, um den Schmerz zu verringern. Es ging ihm wirklich schlecht, und das Schlimmste dabei war, dass Dan seine einzige Hoffnung darstellte.