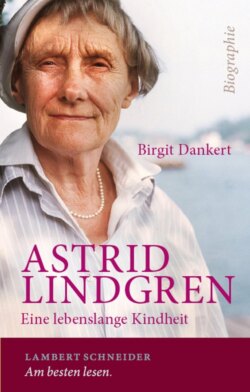Читать книгу Astrid Lindgren - Birgit Dankert - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеAstrid Lindgren starb am 28. Januar 2002 im Alter von 94 Jahren. Im Kriegsjahr 1944 veröffentlichte sie als 37-jährige Ehefrau und Mutter von zwei Kindern ihr erstes Buch mit dem programmatischen und entlarvenden Titel „Britt-Mari erleichtert ihr Herz“ (Britt-Mari lättar sitt hjärta). Fast 40 Jahre später, nachdem sie annähernd 100 selbstständige Texte verfasst und sich ein Welterfolg ohnegleichen eingestellt hatte, erschien in ihrem 74. Lebensjahr 1981 mit „Ronja Räubertochter“ ihr letzter großer Kinderroman. Sie lebte danach noch 20 Jahre – ausgezeichnet mit immer neuen Ehrungen, beschäftigt mit Neuausgaben und mit der Bearbeitung ihrer Bücher für verschiedene Medien, engagiert bei Leseaktionen und in politischen und sozialen Projekten, eingebunden in ihren Freundes- und Familienkreis. Erst altersbedingte körperliche Hinfälligkeit befreite sie von Autorenpflichten und zunehmend auch von dem Druck, öffentlichen Erwartungen an ihre Person entsprechen zu müssen.
Denn Astrid Lindgren war mit ihren Büchern, Hörspielen, Filmen und anderen medialen Adaptionen ihres Werkes, durch ihren Einsatz für gewaltfreie Erziehung und Kinderrechte sowie durch ihre Kritik an der schwedischen Steuergesetzgebung und der Massentierhaltung schon zu Lebzeiten zu einem Mythos geworden. Die Legende Astrid Lindgren droht im Verein mit der allgegenwärtigen Multimediapräsenz von Lindgren-Texten zunehmend den Blick auf Leben und Werk dieser außergewöhnlichen Frau zu verstellen. Die erfolgreichste und bekannteste Kinderbuchautorin der Welt ist nach dieser Legende die alters- und zeitlose Inkarnation einer glücklichen Kindheit, eine Bauerntochter, die sich zu einer Literatin von Weltrang entwickelt und deren erfolgreiche Biographie der heiteren Welt ihrer Bücher zu entsprechen scheint. Sie selbst war darauf bedacht, dass selbst ihre späten politischen Aktionen das öffentliche Bild von Astrid Lindgren nicht störten, sondern mit der Vorstellung einer bruchlosen Einheit von Leben, Programm, Botschaft und Werk im Einklang standen.
Aber dieses Bild ist eine Wunschvorstellung. Was sich jedem, der Astrid Lindgren begegnete, sofort mitteilen konnte, haben Forschung und von der Familie posthum ermöglichte Einblicke in ihren Lebensablauf bestätigt: Astrid Lindgren fiel der Erfolg nicht in den Schoß, sondern ihre Kinderliteratur neuen Typs ist das Ergebnis von jahrelangen literarischen Versuchen. Sie schrieb ihre Geschichten, um sich selbst zu trösten und zu stärken, und führte vornehmlich literarisch einen Kampf für Kinderrechte, Frieden und Gewaltlosigkeit. Ihre Persönlichkeit ist komplex und bedeutend vielschichtiger, als das kontinuierliche bürgerliche Leben, das der Öffentlichkeit bekannt ist, vermuten ließe.
Frühe Begabung, aber späte dichterische Kreativität nach Seiten-, Irr- und Holzwegen in journalistischen Beiträgen und trivialen Texten, die Stilisierung von Kindheits- und Bildungserlebnissen zu einem zeitlosen Kinderkosmos und schließlich die literarische Aufarbeitung von subjektiv als defizitär empfundenen Lebensumständen sowie das lebenslange Verharren in kindlichem Gefühl und Bewusstsein kennzeichnen ihr Werk. Neben, oder besser: im Zusammenhang mit ihrer schriftstellerischen Tätigkeit, mit Übersetzungen und Medienadaptionen hat Astrid Lindgren das Kinderbuchprogramm des schwedischen Verlages Rabén & Sjögren aufgebaut, profiliert und geleitet. Seit den frühen Bearbeitungen ihrer Texte für Film, Funk und Fernsehen wirkte sie auf diesem Gebiet und setzte Maßstäbe. Lindgren entwickelte sich früh zur erfolgreichen Medienmanagerin und Marketingexpertin für das internationale Lizenzgeschäft. Sie bewältigte persönliche Niederlagen, familiäres Unglück, politische Konflikte und erlebte einen frühen Medienhype, der ihr zunehmend Selbstvertrauen und Weltläufigkeit gab, aber auch ihr Privatleben prägte und zeitweise bedrohte.
Das Privatleben Astrid Lindgrens ist uns hauptsächlich aus autobiographischen Äußerungen bekannt, die sich weitgehend auf Erinnerungen aus der Familiengeschichte und der eigenen Kindheit konzentrieren. Über einige krisenreiche Jahre ihrer Jugend schwieg die Autorin bis zu ihrem 70. Lebensjahr und gab auch danach nur Einzelheiten preis, die sich zu keinem geschlossenen, stimmigen Bild zusammenfügen und den Leser leicht auf falsche Fährten locken.
Wichtige Zeugnisse – wie die Tagebücher der Kriegsjahre 1939 bis 1945 – sind nur in Ausschnitten zugänglich. Wenn sie, wie häufig und ausgiebig der Fall, über ihr Leben und ihre Gefühle befragt wurde, wich sie meistens in Anekdoten aus oder mischte Erlebtes mit literarischen Motiven. Die zugänglichen Quellen belegen, dass ihr Leben bestimmt war von ihrer Familie, ihrer Arbeit an den eigenen Texten, ihrer Verlagstätigkeit, von beruflich und/oder privat motivierten Freundschaften sowie von der Begegnung mit der heimischen Natur und von Reisen. Sie lebte, vor allem nach dem Tod ihres Mannes, mehr in weiblicher als männlicher Gesellschaft. Schönheit war für sie ein großer Wert. Nachvollziehbar ist ein seit Ende der vierziger Jahre außergewöhnlich hohes Arbeitspensum, das sie bis in die späten achtziger Jahre bei behielt. Sicher ist, dass sie von ihrer Jugend bis ins hohe Alter Erfahrungen, Gefühle und eine – nicht nur innere – eigene Welt besaß, zu der sie niemandem, der davon hätte erzählen können, Zugang gewährte. Die zahlreichen Ehrungen der mittleren und späten Lebensjahre, die Rituale der Totenfeiern und des Gedenkens gehören zum letzten öffentlichen Wirken der Autorin, das in einer breit gefächerten Erinnerungskultur fortgesetzt wird.
Als Geheimnis Astrid Lindgrens gilt in erster Linie die schwer erklärbare Faszination, die ihre Texte auf Kinder und auf Leser jeden Alters in aller Welt ausüben, ein offensichtlich – trotz räumlicher Beschränkung der Handlungsschauplätze – global wirkender Schatz der Kinderkultur. Ihre literarischen Gestalten gehen vielfach auf konkrete Vorbilder aus ihrer Lebenswelt zurück. Die meisten Geschichten spielen an wiedererkennbaren Orten. Die Zeit, in der ihre Geschichten und Romane handeln, lässt sich mit Jahreszahlen nicht eindeutig bestimmen. Vor allem in den im ländlichen Milieu angesiedelten Texten werden Motive und Stoffe vermischt, die – gemessen an den Daten ihrer Familiengeschichte – aus verschiedenen Zeitstufen stammen. Astrid Lindgren schuf sogenannte Chronotope, ,Zeit-Räume‘, in denen bestimmte Lebensformen mit einer bestimmten zeitlichen Phase der nordeuropäischen Kulturentwicklung verbunden sind, wie etwa die vorindustrielle bäuerliche Gesellschaft, die Kleinstadt im Aufbruch in die Moderne, die städtische Kleinfamilie und die ewig währenden Ferien auf einer Insel, aber auch imaginierte Phantasiewelten. Chronotope dieser Art sprechen Leser jeden Alters und vieler Kulturkreise an und könnten die weltweite Faszination erklären, die von Astrid Lindgrens Büchern ausgeht. Ihre Bücher wurden in mehr als siebzig Sprachen übersetzt. Der Internetzugang zu ihren digitalisierten Werken reißt jede noch verbliebene Schranke ein. Bei diesem Erfolg droht ihre Kunst zur ,Marke‘ zu werden – ein Prozess, an dessen Ausgangspunkt der Kampf einer jungen Autorin um Freiheit und Anerkennung stand.
Jede Annäherung an die Lebensgeschichte Astrid Lindgrens muss daher die bekannten Daten ihres Lebenslaufes mit Informationen über Entstehung, Entwicklung und ,Botschaft‘ ihres Gesamtwerkes verbinden. Ein sinnvoller Zusammenhang von Leben und Werk lässt sich aber über eine bloße chronologische Betrachtung im Sinne einer Biobibliographie nicht herstellen. Lindgrens Werke, ihre Motive und Botschaften – mögen sie auch noch so deutlich auf wiedererkennbare Stationen ihres Lebens zurückgreifen – erzählen nicht ihren Lebenslauf. Daher berichtet die vorliegende Biographie vom Leben Astrid Lindgrens zwar weitgehend chronologisch, fasst aber Lebensphasen unter charakteristischen, zentralen Begriffen dieser Jahre zusammen. Ergänzt wird die Schilderung dieser Lebensphasen durch Hinweise zur Werkentwicklung, vor allem aber durch Textbeispiele und -interpretationen, die das Lebensgefühl und die Lebensmaxime der Autorin in dieser Lebensperiode beleuchten, auch wenn diese Texte nicht zur gleichen Zeit entstanden sind.
Das vorhandene Material ist so strukturiert, dass die Verschränkungen von Leben und Werk an bestimmten Wegmarken erkennbar werden. Es handelt sich um die Lebensphasen, die von Kindheit, Kummer, Grenzüberschreitungen, Erfolg und Alter geprägt sind. Dabei stützen sich die Überlegungen zwar auch auf das Material früherer Veröffentlichungen über Astrid Lindgren, besonders auf die sonst unzugänglichen Quellen, die in der Biographie von Lindgrens Freundin Margareta Strömstedt und den Interviews von Felizitas von Schönborn und Maren Gottschalk bereitgestellt wurden. Sie folgen aber nicht den herkömmlichen Mustern, die Lindgrens Leben als geradlinig verlaufende Erfolgsgeschichte beschreiben und darin den Triumph der Humanität über die Defizite der Welt verwirklicht sehen. Die goldene Kindheit, die schwere Jugend, der sich über Nacht mit „Pippi Langstrumpf “ einstellende Erfolg, das weise Alter – Klischees dieser Art möchte die vorliegende Biographie nicht bemühen, weil sie nur hilflose Erklärungsmuster für ein gerade in seiner mangelnden Stringenz so faszinierendes Leben darstellen, dem authentischen Leben aber nicht gerecht werden.
Vielmehr geht es darum, der Person Astrid Lindgrens in einer vorurteilsfreien Zusammenschau ihres Lebens und ihres Werkes gerecht zu werden, ohne dabei bereits vorauszusetzen, dass ihre Lebensgeschichte einer schrittweisen und konsequenten Erfolgsgeschichte entspricht bzw. die geradlinige Entwicklungsgeschichte einer genialen Schriftstellerin darstellt, die schließlich zu Weltruhm gelangt. Unter dieser Voraussetzung würden die vielseitigen Tätigkeitsfelder, auf denen Astrid Lindgren sich engagierte, ebenso aus dem Blick geraten wie die Tatsache, dass sich jahrzehntelang Phasen explosiver Kreativität mit Phasen der ruhigen Aufarbeitung abwechselten, dass sich eruptive Hochgefühle nach langen Phasen von Melancholie und Trauer einstellten.
Gibt es Besonderheiten für Biographien über Autoren der Kinder- und Jugendliteratur? Ihre Sprache – auch in ihren autobiographischen Äußerungen – ist in der Regel von wohl durchdachter Einfachheit. Ein nicht unbeträchtlicher Teil ihres schöpferischen Prozesses und der Vermittlung des eigenen Werkes richtet sich an Kinder. An Kinderbuchautoren – an ihr Werk wie auch an ihre Person – werden von der Zielgruppe der Kinder einerseits und der Zielgruppe der erwachsenen, geübten Leser wie auch von Literaturpädagogen und -experten andererseits jeweils unterschiedliche Wertmaßstäbe herangetragen. Es geht dabei nicht nur um die Mehrfachadressiertheit der Kinder- und Jugendbücher, sondern auch um Verhaltensweisen, denen der Autor mit seiner Lebensgestaltung und Arbeit Rechnung zu tragen hat. So sind – ob berechtigt oder nicht – die moralischen Ansprüche an Kinderbuchautoren höher, der Wunsch nach einer Übereinstimmung von beschriebenen und gelebten Werten rigoroser. Kaum einer will seinem Kind das Buch einer fragwürdigen Persönlichkeit in die Hand geben. So gut wie jeder Lehrer erwartet bei einer Autorenlesung, dass hier eine authentische und anständige Person auftritt. Auch Biographien von Kinder- und Jugendbuchautoren stehen unter dieser Erwartung.
Astrid Lindgrens Lebenslauf zeigt, dass sie sich dieses Bedingungsrahmens zunächst nicht bewusst war, sondern dass sie ihn in einem anstrengenden Prozess der Selbstfindung erst herstellte, sich dies zur Lebensaufgabe machte und damit einen entscheidenden Beitrag zur schwedischen und europäischen Kulturgeschichte leistete. Lindgrens Biographie ist also nicht die Geschichte einer Kinder- und Jugendbuchautorin, sondern die einer Frau, die die Lebensform einer solchen Autorin mühsam errichtete und verwirklichte.
Ihre Bücher schildern hauptsächlich das Leben von Kindern, wenn auch in Gemeinschaft, in Abhängigkeit und Auseinandersetzung mit Erwachsenen. Dieser Tatbestand verführt zu der Annahme, dass in den Büchern der Autorin vorwiegend Anklänge an die eigene Kindheit zu finden seien. Die ,erwachsene‘ Astrid Lindgren in Kinderbüchern zu suchen, kommt nicht vielen Biographen in den Sinn. Aussagen über eine Kinderbuchautorin Astrid Lindgren, die älter als 20 Jahre ist, glauben viele nur aus der Themenauswahl, aus den in ihren Büchern vertretenen Wertesystemen und aus den Schreibanlässen für ihre literarische Arbeit ableiten zu können. Dabei ist es doch die erwachsene Astrid Lindgren, die diese Bücher schreibt und die zwischen den Figuren und der erzählten Zeit in ihren Geschichten einerseits und ihrer eigenen Person und ihrer Zeit andererseits unterscheidet. Auch der letzte Roman „Ronja Räubertochter“ der über 70-Jährigen lässt sich als ein Kindertraum bezeichnen.
Viele Bücher Lindgrens sind auf drei Ebenen biographisch. Die Bücher greifen authentische Orte, Figuren, Handlungsabläufe aus ihrem Leben in veränderter Form auf. Gleichzeitig aber sind sie ein Dokument der Verfassung ihrer Autorin zur Zeit der Niederschrift bzw. der Überarbeitung des Textes. Dazu gehört auch der Wille, Aspekte der eigenen Biographie hier und jetzt auf eine bestimmte Weise zu Literatur zu machen. Auf einer dritten biographischen Ebene ist jeder Text auch durch ein bestimmtes Stadium der schriftstellerischen Entwicklung Lindgrens gekennzeichnet. So greift der phantastische Kinderroman „Mio, mein Mio“ mit dem Motiv des Pflegekindes eine ihr autobiographisch bekannte Erfahrung auf. Der Roman beginnt an einem wiedererkennbaren Ort nahe ihrer Wohnung. Er ist ein Dokument der Trauer um ihren Mann, der während der Konzeption des Manuskriptes verstorben ist. Und gleichzeitig läutet er ein neues literarisches Genre und eine neue literarische Epoche, die der phantastischen Kinderromane, ein.
Die internationale, vornehmlich aber die deutsche und schwedische wissenschaftliche Forschung hat viele Einzelergebnisse zu Lindgrens Werk vorgelegt. Die Befunde sind bisher noch nicht in das allgemeine Bewusstsein über das Leben und das Gesamtwerk der Autorin eingegangen. Die biographisch interessanten Erkenntnisse dieser Untersuchungen sind hier berücksichtigt. Vielleicht muss man das Lebenswerk Astrid Lindgrens zunächst in seine Einzelteile zerlegen, um es in einem authentischen Bild neu zusammenzusetzen.
Sieben Jahrzehnte nach der Veröffentlichung ihrer ersten Kinderbücher und mehr als zwölf Jahre nach dem Tod Astrid Lindgrens muss eine Darstellung ihres Lebens weder die Gleichwertigkeit der Gattung Kinder- und Jugendliteratur noch die herausragende Qualität ihrer Werke unter Beweis stellen. Eine Biographie über Astrid Lindgren ist außerdem der Aufgabe enthoben, die Eigenarten der Person und die Existenz ihres Werkes zu rechtfertigen. Sie ist frei.