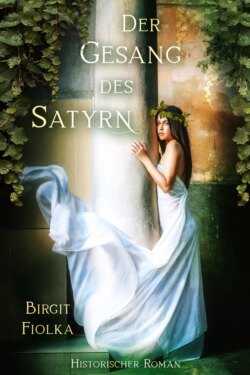Читать книгу Der Gesang des Satyrn - Birgit Fiolka - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prolog
ОглавлениеDas gleißende Licht der Mittagssonne fiel durch die Fensteröffnung und ließ den Staub der Straße gleich winzigen Flocken im Raum schweben. Es war ein schmuckloser Raum, die Wände in kühlem weißen Putz gehalten, auf den Böden nur einige Webteppiche und vor der Fensteröffnung ein Tisch aus Pinienholz mit einem zierlichen Stuhl, dessen einzige Extravaganz eine geschwungene Lehne war. Jener Stuhl war eines der wenigen Erinnerungsstücke, welche die Herrin dieses Raumes aus ihrer Vergangenheit zurück nach Megara begleitet hatten. An einem heißen Sommertag wie diesem hatte sie diesen Raum bezogen, hatte ihn mit den Erinnerungen ihres Lebens gefüllt, und an einem ebenso heißen Sommertag würde sie ihn verlassen – jenes letzte Heim in ihrem Leben, in dem es so viele Wohnstätten - gute wie schlechte - gegeben hatte. Sie war damals alleine gekommen, doch in den folgenden Jahren selten allein geblieben auf ihrer Kline. Doch in der gedrückten Stille des frühen Mittags, durch den nur dumpf die Geräusche der Straße zu ihr drangen, an jenem letzten Tag ihres Lebens war sie erneut allein, und nur ihre Sklavinnen waren bei ihr. Bald würde dieser Raum bereit für eine neue Schicksalsgeschichte sein. In dieses Haus der geflüsterten Geheimnisse kamen nur die Müden und Gescheiterten - jene, die ihre besten Zeiten bereits gelebt hatten. Hier lag das Ende ihrer Reise, verborgen unter muffigen Laken, aufdringlichen Duftessenzen und getrockneten Tränen.
Von der Schlafkline in der Mitte des Raumes drang ein leises Geräusch. Sofort ließen die beiden Sklavinnen, wie sie es ihr ganzes Leben auf ein Zeichen ihrer Herrin hin getan hatten, von ihrer Arbeit ab und wandten sich ihr zu. Sie war alt geworden, müde und runzelig, trocken und staubig wie das Haus, und mit ihr waren auch ihre Sklavinnen gealtert.
„Thratta, Kokkaline“, erklang die brüchige Stimme der Herrin, welche ihren melodiösen Klang nie ganz verloren hatte; wie der Nachhall eines schönen Festgesangs schien er das Bild des Alters und Zerfalls verhöhnen zu wollen. „Kommt und setzt euch zu mir, denn dieses ist der letzte Tag meines Lebens. Ich will ihn mit euch verbringen, die ihr mich besser kennt, als je ein Mann mich gekannt hat. Ihr seid die Einzigen, welche sich der großen Hetäre Neaira und der Frau, die ich stets bemüht war zu sein, erinnern werden. Denkt immer daran, wenn mein Leib zu Staub geworden ist und ich mich nicht mehr wehren kann, so oft sie meinen Namen auch mit Verachtung aussprechen.“
Thratta schluchzte. Sie war schon immer die sanftmütigere und sensiblere der beiden Sklavinnen gewesen. Kokkaline nahm ihre Hand, wie sie es einst getan hatte als Thratta in die Dienste der Herrin gekommen war, und drückte sie. Dann gingen sie gemeinsam zur Lagerstatt und ließen sich neben ihr auf dem Boden nieder. Die Stille des Augenblicks war von einer Endgültigkeit gezeichnet, die vor allem Thratta nicht ertrug. „Sollen wir dir Früchte oder eine Schale Wein bringen, Herrin?“ Thratta hatte Mühe, ihre Stimme nicht zittern zu lassen. Die Herrin verneinte. Ihr Gesichtszüge waren von Zorn und Elend gezeichnet. „Warum soll ich mich quälen mit den Erinnerungen an guten Wein, Gesang und die Tage meiner Jugend. Wein würde mir den Abschied nur schwerer machen ... auch wenn er abgestanden und sauer ist, wie alles in diesem Haus. Er ist uns gemäß, dieser Wein! Wir alle, die wir hier leben, sind über die Jahre abgestanden und sauer geworden.“ Ihre Stimme bekam einen flehenden Klang. „Aphrodite, die du mir heißes Blut geschenkt hast! Wie grausam der Verfall für eine Frau wie mich ist, kannst nur du wissen.“
Wieder schickte sich Thratta an zu schluchzen, doch Kokkaline stieß sie in die Seite. Es war schwer genug für die Herrin; Thratta sollte es nicht noch schlimmer machen. Endlich wandte die Herrin den Kopf und sah Kokkaline und Thratta in die Augen. Für einen Augenblick gewannen sie ihren alten Glanz und ihre Klarheit zurück. Es waren jene Augen ihrer Herrin, die Kokkaline noch immer einen Schauer über den Rücken laufen ließen. Sie allein waren dem Verfall des Alters entgangen. Noch immer waren die Augen der Herrin groß und braun. Sie wirkten sanftmütig und beinahe schutzbedürftig. Es waren Augen, die Männer um den Verstand gebracht und dazu verführt hatten, die Erfüllung ihrer Sehnsüchte in ihnen zu erhoffen. Viele von ihnen waren der Täuschung dieser Augen erlegen. Einige von ihnen hatten nie erkannt, was hinter den großen braunen Augen verborgen war – ein wacher Verstand voller begehrlicher Wünsche, ein heißblütiger Wille, jedoch ebenso ein kühler und planender Kopf, dem es gegeben war Ziele anzustreben und sie zu erreichen.
Früher hatte Kokkaline diese Augen gefürchtet. Sie konnte sich nicht mehr erinnern, wie oft der Stock der Herrin auf ihrem Rücken getanzt hatte, wie oft sie danach die Striemen in ihrem Fleisch mit kühlenden Salben behandelt hatte; sie konnte sich nicht mehr entsinnen, wie oft Thratta nachts weinend neben ihr auf der Strohmatte gelegen hatte. Vor allem sie hatte unter der Unberechenbarkeit der Herrin gelitten – der Herrin, die sie so sehr geliebt hatte, aber von der eine Sklavin kaum Gegenliebe erwarten durfte. Trotzdem waren sie miteinander verwachsen – die beiden Sklavinnen und die Herrin. Sie waren wie knorriges Wurzelholz, ineinander verschlungen, verknotet und verhärtet. Sie teilten Geheimnisse und fast ein ganzes Menschenleben.
Die Herrin streckte ihre trockene Hand aus. „Thratta ... habe ich dich zu oft geschlagen und zu schlecht behandelt? Ich meine, dass es wohl so gewesen ist.“
Thratta, obwohl selber bereits über sechzig Jahre alt, zog die Nase hoch wie ein Kind und schüttelte den Kopf. „Nein, Herrin! Du warst gerecht, nie hast du mich mehr geschlagen, als es für eine Sklavin gemäß ist.“
„Lügnerin“, antwortete die Herrin sanft, und aus Thrattas Augen begannen die Tränen zu laufen. „Mancher Hund hat in seinem Leben weniger Schläge abbekommen als du. Ich bedauere das sehr. Du hast mir stets treu gedient. Aber mein Blut war heiß und leidenschaftlich, sodass jeder, der mir nahestand, sich an mir verbrannte.“
„Ich habe dich immer verehrt und geliebt Herrin. Ich habe dir gerne gedient.“ Thrattas Stimme wurde brüchig. Sie konnte ihren Kummer nicht mehr verbergen.
„Das weiß ich ja, Thratta. Arme kleine Thratta! Es sind immer die mit den reinsten Herzen, denen wir Leid zufügen.“ Ihre Augen schienen abzuschweifen, weit in die Vergangenheit zu reisen. Dann wandte sie sich an Kokkaline, die ruhig und gefasst neben Thratta saß. Ihre braunen Augen fixierten die Sklavin mit jenem forschenden Blick, der früher oft eine Strafe angekündigt hatte. „Kokkaline, du warst anders als Thratta, doch ebenso treu. Thratta schlug ich, weil ich ihre Gutherzigkeit kaum ertragen konnte. Dich jedoch, Kokkaline, strafte ich für deinen Stolz, für deine ruhige besonnene Art und die Anmut, welche eine Sklavin nicht haben darf. Du, meine stolze und starke Kokkaline, hast mich stets daran erinnert, wie unvollkommen und ungeschliffen mein Herz war. Mein ganzes Leben habe ich danach gestrebt, eine freie Frau zu sein und meine Schande zu tilgen. Doch tief in mir wusste ich, dass jenes Leben, das mein Schicksal war, mir gut zu Gesicht stand. Ich verabscheute seine Lasterhaftigkeit ebenso, wie ich seine Vorzüge genoss.“
Kokkaline nahm die Hand ihrer Herrin und führte sie an ihre Wange. Auch sie war alt geworden, eine alte nutzlose Sklavin. Doch ihr Rücken war noch immer so gerade wie der eines jungen Mädchens. „Obwohl deine Hand mich oft geschlagen hat, hadere ich nicht mit meinem Leben. Es war erfüllt.“
„Ja, Kokkaline“, flüsterte die Herrin mit einem Lächeln. „Auch dies ist ein Grund für die harte Behandlung - deine Zufriedenheit, dein festes Herz, deine Bescheidenheit, mit dem glücklich zu sein, was dir das Leben schenkte. Ich war immer unzufrieden. Was ich auch bekam – ich verlangte stets nach mehr. Ich neidete dir dein Talent zum Glücklichsein.“ Der aufkommende Husten der Herrin erinnerte Kokkaline an das Bellen eines alten Straßenhundes. Thratta beeilte sich, der Herrin eine Schale mit Wasser an die Lippen zu halten. Nachdem die Herrin einen Schluck getrunken hatte, ließ sie sich zurück auf ihr Lager sinken. „Vielen Menschen habe ich Leid zugefügt – einige hatten es verdient, andere nicht. Jene, die es nicht verdient hatten, kann ich nicht um Verzeihung bitten, da sie bereits den Styx überquert haben. Meine arme Tochter Phano, die ein Opfer meiner Selbstsucht wurde, und Stephanos, den Mann, den ich innig geliebt habe, obwohl er mich einmal aus Schwäche verraten hat. Dies sind die beiden Menschen, um derentwillen ich Reue empfinde. Die Anderen“, nun zeigte sich auf dem von Alter und Krankheit gezeichneten Gesicht der Herrin ein Lächeln, wie es früher oft gewesen war, wenn sie meinte, einen Sieg errungen zu haben. „Die Anderen habe ich nie in mein Herz sehen lassen! Wie habe ich sie an der Nase herumgeführt, diese unbescholtenen Bürger Athens, die so gut und gerecht taten und ihre gierigen Gelüste in jene Häuser trugen, in die zuerst Nikarete und später Phrynion mich brachte. Um sie tut es mir nicht leid, um keinen Einzigen von ihnen! Wenn ich es vermocht hätte, so wären sie allesamt in den Tartaros gestürzt worden und ihre Taten vor den Göttern offenbart. Doch was vermag eine Frau auszurichten in dieser Welt der Männer? Ich habe mein Bestes getan!“ Erneut schüttelte sie der Husten. Kokkaline hob den Kopf der Herrin an, während Thratta ihr die Trinkschale an die Lippen hielt. Nur langsam schien die Herrin sich zu beruhigen. „Auch ihr kennt sie, diese feinen Bürger Athens.“ Sie suchte mit fiebrigen Augen die Zustimmung ihrer Sklavinnen. Thratta und Kokkaline nickten stumm. „Ja“, flüsterte die Herrin heiser. „Ihr wart stets an meiner Seite, und doch wisst ihr nicht wie es dazu kam, dass ich die Frau wurde, die ich bin. Ihr wisst nicht, woher meine Herzenskälte rührt. Deshalb will ich euch meine Geschichte erzählen, bevor ich sterbe und euch die Freiheit schenke. Es wird nur einen Tag dauern, nur so lange bis die Sonne untergeht. Obwohl ihr mich verlassen könnt, da ich euch in diesem Augenblick die Freiheit schenke, hoffe ich, dass ihr mir diesen letzten Dienst erweisen werdet.“ Sie machte eine Pause und sah die Sklavinnen bittend an. Es war Kokkaline, die ihr antwortete. „Wir bleiben bei dir, bis du den Styx überquert hast. Wir würden auch bei dir bleiben, wenn der Fährmann dir weitere Jahre gewährt. Was bedeutet die Freiheit schon für uns, die wir alt sind?“ Kokkalines blaue Augen vergossen keine Tränen, doch sie trauerte im Angesicht des Abschieds, der unzweifelhaft bevorstand. Gewiss, die Herrin war streng gewesen und hatte sie oft geschlagen. Doch was machte das schon. Die Hände der Herrin waren nicht so hart gewesen wie die der Herren, welche sie mitunter auch geschlagen hatten.
Die Blicke der Herrin wanderten über die weiß gekälkte Decke des Raumes. Sie suchte nach einer Tür in ihrem Geist, die es aufzustoßen galt, um den Staub der Jahre und des Vergessens von ihren Erinnerungen zu nehmen. Als sie dies gefunden hatte, atmete sie tief durch. Ihre Stimme festigte sich mit den ersten Worten, so als wäre die Herrin zurückgekehrt in eine Zeit, in der Schmerz für sie nur ein bloßes Wort ohne Bedeutung gewesen sein musste.
„Ich muss ungefähr sechs Jahre alt gewesen sein, als ich an der Hand meiner Mutter nach Korinth kam ... sechs Jahre, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß noch nicht einmal, wie die Polis hieß, in der ich mit meiner Mutter lebte, noch weiß ich, wer mein Vater war ... ich wusste damals auch nicht, warum meine Mutter mit mir nach Korinth kam. Heute weiß ich es – damals staunte ich nur über diese große Stadt, in die mich meine Mutter mitgenommen hatte ... ich war ein staunendes Kind, das nichts Böses ahnte und kannte.“