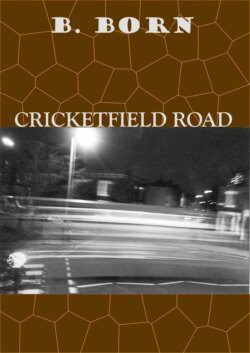Читать книгу Cricketfield Road - Boris Born - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеEine Kreuzung. Powell Road, Downs Road und Cricketfield Road prallen aufeinander. Es ist Sonntag und es ist laut. London ist insgesamt laut.
Ich renne los. Ein dröger Kreisel, dann in die Lower Clapton Road. Ein winziger Park mit dem kleinen Tümpel: Clapton Pond. Zwei Enten haben auf dem fauligen Wasser Platz. Ein Mönch hat sich einst darin ertränkt. Vielleicht war der Teich ja damals tiefer.
Hinter dem Park sammeln sich 38er Busse. Endhaltestelle - sie schlafen. Alte doppelgeschossige Busse mit der Plattform hinten. Zwischen der 3 und der 8 ist ein Herzchen. Die Conductor stehen zusammen und rauchen Marihuana. [Conductor = Fahrkartenkontrolleur in den alten Doppeldeckerbussen (bis 2006 im Einsatz)]
Ich haste vorbei am Telefonzellen-Sammelsurium. Erst eine Behinderten gerechte Zelle. Sie ist wie ein Dreieck gebaut. Violett. Dann die klassisch rote, aber in einem modernen Design. Zwei Meter weiter eine orange ‚Interphon‘ steht übergroß drauf. Danach noch zwei Apparate im Freien.
Eine Uhr, Seltenheitswert. Erst halb zwei. Slow down, Lena. Ich schwimme weiter, im Straßenmeer. Überall Wohnhäuser. Die Erdgeschosse sind bürgerlich: Blumen, Kakteen, Reste bunter Weihnachtsbeleuchtung, Teekannen in Hausform, Bücher bis zur Decke, Schallplatten bis zur Decke, große Fernseher.
In den ersten Stockwerken sind die Fenster Dreck verkrustet. Vorhänge, Tücher, Jalousien, Decken, Wahlplakate. Die zweiten Stockwerke sehen unbewohnt aus.
Dalston Junction. Schon anders. Die meisten Läden sind Vergangenheit, die oberen Stockwerke besetzt oder ausgebrannt.
Menschen wie Schwämme – wie trockene Schwämme mit Durst.
Verzauberte Menschen, überwucherte Menschen, gegerbte Menschen, abgeschabte Menschen, rohe Menschen, verstörte Menschen, an einen Starkstromzaun gefesselte Menschen und Menschen, die mit Riesenrädern fahren.
Ein 1 Pfund Laden mit Ladenhütern. Lebensmittelkonserven, Schraubenziehern, Kerzen und Waschpulver in demolierten Päckchen. Ich kaufe rote Glühbirnen.
In einem seltsamen Parfümladen, mit Seifen und Lockenwicklern, alles importiert aus Jamaika, kaufe ich nichts. Andere Frauen kaufen sich künstliche Haare.
Der aufgemotzte Frisiersalon ist voll. Der einfache Salon an der Ecke ist auch voll. Dabei gibt es unzählige Friseure. Die Kunden stehen rauchend vor der Ladentür. Das Geschäft hat nur drei oder vier Sitze. Ein reiner Männersalon - schade. Ich gehe wie immer in den nebenan. Er heißt: It will grow back. Afrikanische Holzskulpturen stehen zwischen den Waschbecken und den Frisierutensilien. An die Wände sind Beispielfotos von Frisuren geheftet. Auf Bügeln hängen kunterbunte, afrikanische Kleider. Die Auslage im Fenster dekorieren Zöpfe und Haarbüschel. Dicke, schwarze Frauen lassen sich in unendlicher Arbeit ihre Locken glatt legen. Das sieht dann so aus, als wären die Haare mit Zuckerwasser angeklebt worden.
Der Stuhl mit mir wird hochgepumpt.
„Hallo Lena, wie geht’s?“
„Gut, bestens.“
„Willst du deine Haare wieder ganz kurz?“
„Ja, wie bei den beiden Kindern dort.“
Ich deute auf zwei Kinder, die mit einer elektrischen Maschine geschoren werden. Sie sitzen ganz still.
Ich trotte nach Hause. Es zieht am Kopf.
Im Vorgarten liegt, seit ich vor sechs Monaten eingezogen bin, Müll: Plastiktüten mit Bauschutt und durchgerostete Pflanzenölkanister. An der Fassade wedelt das tote Ende eines Antennenkabels. Ein viktorianisches Reihenhaus.
„Don’t slam the door“, steht von innen mit blauer Lackfarbe über die ganze Tür gesprüht. Sie quietscht.
Ich stehe in meinem Zimmer.
Die Fenster klappern. Durch die Ritzen weht es richtig. Auspuffgase, Dreck, Regen, Hitze und Kälte, die Kreuzung, alles ist im Zimmer. Ein halbes Jahr. Irre! Mal objektiv gesehen: Das ‘Sugarrosé’ der Wände ist nicht zu ertragen. Der Schrank ist eine Hülle aus dünnem Pressspan. Die Kommode hat eine speckige Kruste. Keine Schublade lässt sich bewegen. Ein wackeliger alter Stuhl, ein stinkendes, rotes Sofa: „Möbliert“!
Ich sehe auf die Straße.
Der Verkehr donnert. Silber. Blau. Metallicrot. Wieder Blau. Weiß. Weiß mit grünem Dach. Dicke Reifen, schmale Reifen.
Cricketfield Road - was für ein himmlischer Name.
Ein Kricketspielfeld - eine riesige, saftig-grüne Wiese. Auf ihm hüpfen diese sportlichen, drahtigen, fast dünnen Männer in ihren makellos weißen Anzügen herum. Sie werfen, sie schlagen den Ball, sie versuchen, ihn zu fangen oder eine von den drei Stangen zu treffen. Manchmal muss jemand ausscheiden.
So spielen sie tagelang. Zwischendurch machen sie Pausen. Sie nehmen ihre weißen Hütchen ab, sitzen in Korbsesseln, halten ein Tässchen Tee in der Hand und diskutieren das Spiel. Ein gemütlicher Sport!
Kricket, würde mich interessieren, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert.
In der Cricketfield Road gibt es keinen Baum.
Die Autos aber pochen, pulsieren, vibrieren, wärmen, schlagen und fauchen.
Die Menschen bewegen sich steif wie Puppen.
Eine Leiter auf einem Autodach. Ein Fahrrad auf einem Dachgepäckträger. Wieder eine Leiter, diesmal auf einem roten Wagen. Ein rotes Schiebedach auf einem schwarzen Wagen.
Ich sehe von oben in eine Fahrerkabine. Der Fahrer raucht, legt den Rückwärtsgang ein, die roten Löckchen zurückgeworfen, hin und her gesehen.
Ich gehe hinunter in die Gemeinschaftsküche.
Ein strenger Geruch, eine Mischung aus gärendem Obst und verdorbenem Fleisch. Alles ist sehr braun. Rote, alte Soße klebt am Tischbein. Auf dem Herd schwimmt braunes Öl. Schimmel, Brotreste, Zahnbürsten. Eine braune Nacktschnecke ist in der Kühlschranktür eingeklemmt. Kellerasseln und eine Wespe zerlegen sie.
Ich durchsuche die Schränke nach benutzbarem Geschirr. Dabei fällt ein Becher auf den Teppich. Er bleibt ganz. Weil er pekig ist, stelle ich ihn zurück.
„Wenn du was kaputt machst, musst du es beim Auszug bezahlen“, keift Jennifer, schrill und mit kanadischem Akzent. Ihre Haare leuchten karottenrot. Sie sitzt da und spricht gleichzeitig mit mir und dem beigen Telefon. Sie schafft es kaum, ihre dicken Schenkel übereinander zu schlagen. Die Zigarette, an der sie saugt, ist streichholzdünn.
„Andrew?“ rufe ich, „was ist mit der Waschmaschine los?“
Da kommt er schon. Barfuß, mit mehligen Waden. Ein Zehnagel ist entzündet. Er hat nichts außer einem neckischen ockerfarbenen Body an.
„Was ist mit ihr?“ fragt er.
„Es läuft hier ein Kochwasch-Programm, aber es ist nichts drin.“
„Ja, sie hat gestunken. Ich habe Bleiche reingekippt“, sagt er und rennt zurück in sein Zimmer.
In einem alten, roten Sessel sitzt Steven und blättert in Andrews Schwulenmagazinen. Zwischendurch stöhnt er gelangweilt.
Ich sehe ihn nicht an und sage auch nichts. Aber sein Schweigen ist stärker als meins.
„Oktavio ist nett. Ist es was Ernstes?“ frage ich also.
„Weiß noch nicht. Er sieht gut aus“, erwidert er.
„Wo kommt er her?“
„Aus Mexiko“, sagt Steven.
Ich ziehe den Stöpsel aus der Spüle. Das ganze dreckige Geschirr war unter Schaum versteckt. Vielleicht kann ich einen der hellblauen Teller einigermaßen sauber kriegen.
Am Fenster wird mir kalt. England ist halt nicht Mexiko.
Steven steht auf und stellt sich dicht hinter mich. Er ist klein und hinkt. Er trägt Militärstiefel. Die offenen Schnürsenkel tanzen mit jedem Schritt durch den Dreck. Was will er jetzt von mir?
Er beäugt meinen Hals. Dieser fiese Giftzwerg.
„Du musst noch Miete bezahlen“, zischelt er.
„Gebe ich dir nächste Woche“, erwidere ich.
„Spätestens“, sagt er.
„Kann ich eine Dusche nehmen“, wechselt er das Thema, „oder brauchst du hier unten noch länger heißes Wasser?“ Er geht in den Flur und stellt sich auf die erste Stufe der Treppe.
„Lena, was ist nun? Kannst du jetzt aufhören? Ich will duschen!“
„Ich wasche erst das Geschirr, das ich zum Kochen brauche. Bin gleich fertig - okay?“ sage ich gereizt.
Er schmeißt sich wieder in den Sessel.
Andrew kommt auch wieder. Er hat jetzt einen langen, grauen Strickrock an. Hastig nimmt er einen Becher mit kaltem Kakao und kippt ihn in die schwarze Mülltüte. Dann reißt er eine neue Packung Instantkakao auf und schmeißt den Karton in die Mülltüte.
„Wo ist eigentlich der Mülleimer?“ frage ich ihn. Andrew deutet aus dem Fenster. Die Mülleimer liegt auf dem Kopf hinten im Garten.
„Da waren Maden drin“, sagt Andrew und zieht sich weiter an.
Da haben wir’s. Aus kleinen Löchern sickert der Kakao. Ich verknote die Tüte und trage sie schnell raus.
Steven donnert nun die Badezimmertür zu. Lautstark zermalmen seine Stiefel Rasierklingen und leere Shampooflaschen.
Das Küchenfenster! Ein weiß gestrichenes Stahlgitter. Dann die drei Quadratmeter modriger Garten. Ein Edgar-Alan-Poe-Garten. Die Sonne scheint nie in diesen Teil. Ein totes Stück Land, ein Friedhof und dahinter: das Gegenüber! Ein grünes Küchenfenster. Eine helle Küche. Freundlich. Eine schwarze Frau kocht - einfach. Und dort, das schwarze Mädchen hat ein interessantes Haarteil aufgesteckt - steil nach oben. Sie bewegt sich nicht. Vielleicht unterhalten sie sich angeregt.
Auf einmal ist alles ruhig. Alles aus Watte. Hat es geschneit? Kann nicht sein. Es regnet doch. Aber es ist kein Wind, kein Geräusch. Nur das Fenster. Schon verschwimmt alles im Kondenswasser.
Eine Sirene ertönt. Es klingelt an der Haustür. Das Telefon klingelt.
„Hey Pete, es ist für dich“, schreit Jennifer hoch in den zweiten Stock.
Die Waschmaschine fängt an zu schleudern. Sie macht einen Satz. Sie bleibt mit einem fiesen Kreischen stehen. Eine feine Rauchfahne verbreitet den Geruch von versengten Kabeln. Kaputt gegangen.
Andrew hat es gehört und kommt angerannt. Er klatscht wütend in die Hände. Er rennt zum Telefon und versucht den Reparaturdienst anzurufen. Heute ist aber Sonntag und es ist bestimmt schon zu spät. Außerdem ist die Maschine gemietet - die haben ihren eigenen Service - das kann dauern.
Endlich. Grün. Spinat. Fein. Bloß schnell wieder hoch ins Zimmer!
Die Kreuzung schnauft. So ist es gut. Kauen - sehen. Achtung, die Sahne fließt an der Gabel runter. Popeye und seine Kraft. Aber Popeye ist langweilig.
Schon ganz dunkel. Satt und müde.
Hinlegen? Nein! Die Federkernmatraze. Knarren und Schnarren und Quietschen. Ich habe blaue Flecken.
Im Kopf ist nicht viel Platz. Wieviel Fläche ergibt es, wenn man alle Köpfe aufspaltet und nebeneinander legt? Wieviel Träume ergibt das? Schlafe ich?
London. Die Themse. Soho und der Flohmarkt in Camden. Alles ist im Traum. Ich stehe in der U-Bahn. Ich steige aus.
Ich habe viel Gepäck: einen moosgrünen Koffer, eine schwere Tragetasche, einen schwarzen Rucksack. Ich gehe gekrümmt. Vielleicht ist das Schlüsselbein schon gebrochen. Ich fange ein neues Leben an.
Ich schwanke mit dem Menschenstrom. An einer Rolltreppe drückt man sich an mir vorbei. Manche berühren mich absichtlich, manche niesen mich an. Große Fahrkarten. Sie stecken harte DIN A4 Karten in eine große Maschine. Chrom. Spiegelungen. Blitze. Flop. Die Fahrkarten kommen wieder heraus. Sperren gehen auf. Sperren gehen zu. Ich gehe zu einem Mann in oranger Leuchtuniform. Er schließt mir eine Extratür auf. Die Station heißt Highbury Islington. Ich schere aus dem Strom aus und werfe alles hin. Dann hebe ich einige Meter vom Boden ab, weil ich nun so leicht bin. Ich sehe bei den Leuten im ersten Stock in die Fenster. Eine Familie näht karierte Röcke. Ich sehe auf den Asphalt, der irgendwie bröckelt. Die Autos drohen zu versinken. Auspuffe fallen ab und bleiben liegen. Ich presse mich zurück zur Erde und versuche mich ganz schwer zu machen, damit ich nicht wieder abhebe. Ich möchte mich beeilen. Ich winke einem Taxi. Es hält nicht. Der Fahrer lacht. Ein mattes, blaues Licht blendet mich. Ich verstecke das Gepäck in einem grünen Kasten mit Streusand. Drei Männer sitzen am Fenster eines Pubs und feixen. Sie zeigen mir ihre Brustwarzen.
Aus der U-Bahn strömen immer mehr Menschen. Wie Viren schwärmen sie aus: zum Bus, in die Geschäfte, zum Geldautomaten an der Bank gegenüber. Sie infizieren alles.
Endlich hält ein schwarzes Taxi direkt neben mir. Der Fahrer raucht. Während ich das Gepäck einlade, stelle ich mir vor, dass das Taxi ohne mich, aber mit dem Gepäck abfährt.
Ich setze mich auf das weiche, kühle Leder. An den Scheiben des Taxis hängen große Rauchverbotszeichen. Ich kann kaum hinaussehen. Der Motor knattert im Stau. Der Auspuff fehlt. Ein doppelstöckiger, roter Bus taucht auf. Durch ihn werden Abgase durch die Klimaanlage ins Autoinnere gepumpt. Ich versuche den Atem anzuhalten. Aber es dauert zu lange, ich muss die hellblauen Gase einatmen. Ich bin stoned und versuche durch die Rauchverbotszeichen in die Sonne zu sehen. Aber die Sonne ist über dem Dach. Das Taxameter surrt laut und weckt mich wieder. Der Fahrer biegt nun in eine kleine Seitenstraße. Rechts und links, rechts und links.
Beim Bezahlen habe ich große Angst, dass der Fahrer mit meinen Taschen davonfährt. Ich bezahle viel zu viel und stoße mir beim Ausladen den Kopf.
An einem Schiebefenster im ersten Stock steht eine Frau, mit einer schlanken Gießkanne vor roten Blumen. Das Wasser tropft unten aus den Töpfen heraus auf das Fensterbrett der Kellerwohnung. Sie winkt. Ich erkenne sie nun, aber ich weiß ihren Namen nicht mehr. Ihr Mann sieht über ihre Schulter. Er winkt auch. Ich kenne ihn nicht.
Er hilft mir, den dicken Rucksack durch einen engen Flur ein paar Treppen nach oben zu zwängen. Ich habe hochhackige Schuhe an, die sanft in dem weichen Teppich versinken. Das ist sehr angenehm. Dann sind wir in der Wohnung. Hier breche ich mit jedem Schritt Löcher in den morschen Parkettfußboden. Die Sonne durchflutet die Wohnung. Ich blinzele. Der Mann ist viel zu groß für die kleinen Räume. Ich breche wieder zwei Löcher in das Parkett und bleibe nun lieber stehen. Der Mann stellt meine Sachen hin und setzt sich in einen mintgrün gestrichenen Korbflechtsessel. Seine Zähne bürsten ein Unterlippenbärtchen.
An den Füßen des Mannes sind braune, spitze Schuhe, die er nach vorne streckt.
Die Frau kommt zu mir, umarmt und küsst mich auf die Wangen.
„Willkommen in London, Lena“, sagt sie und strahlt. Aus einer Kompaktstereoanlage kommt argentinische Tangomusik. Das gelbgrüne Hemd des Mannes beißt sich mit dem mintgrünen Sessel. Mit seiner kleinkarierten Hose auch. Die Fenster sind alle hochgeschoben. Autolärm. Kreischende Kinder. In der Mitte des Zimmers steht ein Glastisch. An einer Ecke ist ein Stück Glas abgeplatzt. Auf dem Glastisch steht eine gelbgrüne Vase. Auf der Wasseroberfläche schwimmen pinkrote Glockenblüten, aber nur die Blüten, ohne Stiele. Das Wasser riecht verfault. Ich stehe immer noch bewegungslos da. Ich lächele verlegen. Die kleine metallene Gießkanne macht einen Wasserrand auf das Parkett. Die Frau holt Gläser voll mit Eiswürfeln. Ihre Augen funkeln schwarz und tief. Sie hat schwarze, lange Haare. Ihr pastellblaues Kleid beißt sich mit der Farbe des Korbsessels und mit der des Hemdes. Sie beugt sich zu ihm runter und küsst ihn etwas. Dann krault sie sein Bärtchen. Ihre goldbraunen Füße tragen Birkenstocksandalen. Sie holt eine Flasche mit goldgelbem Orangenwein. Die Eiswürfel knacken entsetzt in der klebrigen Flüssigkeit. Der Geruch von Orangenaroma durchströmt den Raum. Ich ziehe die Schuhe aus, lasse sie in den Löchern stecken.
„Schön das du jetzt hier bist“, sagt die Frau auf Deutsch mit einem lustigen Akzent.
„Prost“, erwidere ich und wir nippen an den schweren Gläsern. Der Wein ist quietschig süß.
In der Küche fängt ein Kessel an zu heulen und der Mann steht auf, um Expressokaffee zu kochen. Es riecht nach ausströmendem Gas.
Barfuß laufe ich herum. Das Zimmer zum Garten raus ist in grellem Orange gestrichen, auch an der Decke. Durch die Sonne glüht der Raum wie ein Kamin. Auf einer Fensterbank wachsen Sonnenblumen. Die meisten Blüten hat der Wind abgeknickt. Viele kleine Bücher stehen unordentlich auf einem verzinkten Regal.
Die Frau kommt zu mir und zeigt mir Hochzeitsfotos. Ich bin überrascht, dass sie verheiratet sind.
Auf dem Foto sind nur die beiden zu sehen. Ein verschnörkeltes, weißes Eisendach - das Standesamt. Er trägt ein zu kleines Jackett und der Bauch hängt etwas über die Hose. Sie hat ein schwarzweißes Kleid an.
„Die Town Hall ist auf der Rosebery Avenue in Islington“, sagt sie, „es ist nun fast vier Jahre her. Es ist unser großes Geheimnis, wir haben es bisher noch nie jemandem erzählt.“ Sie zeigt mir eine Heiratsurkunde. Ich lese ihre Namen: Monserrat und Kurt.
Wieder wach. Es ist schon dunkel. 6 Uhr. Druck. Dumpf. Schweiß. Die Lichter der Autos tanzen an der rosa Wand. Gebündelte Geschwindigkeiten. Lichtfluten. Lärmfluten.
Gehupe. Komisches Fiepen – der Schwarzweißfernseher! Na, komm – gib nicht auf! „Police Kamera Action“ fängt an: Beinahezusammenstöße, eine Frau mit einem Rollstuhl auf der Autobahn und reale Verfolgungsjagden. Dann: „Builders from Hell“. Pfusch auf dem Bau und was für Unfälle passieren können. Alles Unsinn. Das Licht anknipsen? Nein. Alles Unsinn.
„Pete, laß uns ein Bier trinken gehen“, rufe ich die Treppe hinauf.
„Ist gut, ich komme gleich runter.“
Wir trotten die Cricketfield Road entlang. Die Reifenhandlung hat sonntags zu. Das Werkzeug- und Tapetengeschäft, die Post mit nur zwei Schaltern, die Bäckerei mit den schlechtesten Brötchen der Welt haben auch zu.
Der Friseur, der Makler mit einem Fotokopierservice für vier Pence die Kopie, der karibische Imbiss, der kurdische Schlachter, der Gemüse- und Lebensmittelladen sind offen. Wir grüßen ein paar Leute. Vier Häuser weiter ist eine Autowerkstatt. Drei Häuser daneben der Pub ‘Cricketer’. Die Tür geht schwer. Lärmende Reggaemusik. Drei Jamaikaner spielen Billard.
Im Fernseher läuft ohne Ton: „Animals in Uniform“ - Polizisten dressieren Hunde für den Einsatz.
Der jamaikanische Wirt zapft uns ein Lagerbier. Ein alter Mann sitzt am Tresen und liest Zeitung.
Die deutsche Ehefrau des Wirts stellt das Bier auf ein Handtuch. Ohne Schaum und lauwarm.
„Wie geht’s“, fragt sie mich auf deutsch.
„Ach gut“, antworte ich, „viel Arbeit, wie immer.“
„Was machst du noch mal?“ Sie hat es vergessen!
„Ich gebe Deutschstunden.“
„Das ist doch super. Ich muss jetzt weitermachen.“ Sie hat Tränen in den Augen. Ihr Mann trinkt zu viel.
Wir gehen mit dem Bier an einen Tisch. Wir haben ganz vergessen, dass sonntags Striptease ist.
Eine blonde Frau tritt aus einem Hinterzimmer und tanzt in einem pinkfarbenen Schürzchen zu einem Lied von Madonna. Am Schluss räkelt sie sich auf dem Billardtisch. Sie spielt mit den Kugeln an sich herum. Die schwarzen Männer, deren Spielkonstellation zerstört ist, sind genervt. Sie telefonieren mit ihrem Handy, bis es vorbei ist.
Im Fernseher läuft tonlos „Hollyoaks“, eine Teenieseifenoper.
Mehr Discomusik. Pete springt auf. Er zieht die Trainingsjacke aus. Er tanzt und wirft die Arme in die Luft. Seine Trainingshose und seine Turnschuhe erinnern an den Geruch in Umkleidekabinen.
Die nächste Stripperin trägt einen Krankenschwesterkittel und weiße Stiefel, die bis hinauf zu den Oberschenkeln gehen. Die Deutsche schlurft mit einem Glas zu jedem Gast und kassiert ein Pfund fürs Ausziehen.