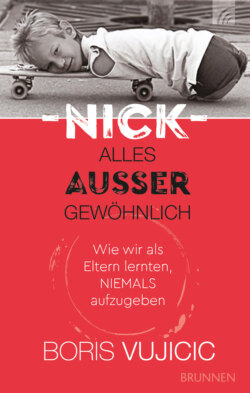Читать книгу Nick - Alles außer gewöhnlich - Boris Vujicic - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2
Die Geburt – ein Schock
Geben Sie der Traurigkeit Raum und sich selbst Zeit, sich neu zu sortieren
Kein Paar rechnet damit, dass das stärkste Gefühl bei der Geburt ihres ersten Kindes Trauer sein wird. Es fällt mir schwer, das überhaupt zu schreiben, vor allem weil unser Sohn uns letzten Endes so viel Freude gebracht hat.
Trotzdem möchte ich anderen Eltern von behinderten Kindern sagen, dass Trauer eine verbreitete und vor allem verständliche Reaktion ist. Für mich war gar nicht so schlimm, dass Nick behindert war. Viel mehr trauerte ich um den Verlust des „perfekten“ Kindes, das wir nicht bekommen hatten.
Mir haben viele Eltern bestätigt, dass sie durch eine ähnliche Phase gegangen sind. Sie haben sich wegen ihrer Reaktion schuldig gefühlt und waren durcheinander. Auch ich musste erst lernen, mir diese Gedanken und Gefühle zuzugestehen, und ich kann das nur jedem raten. Wir sind alle Menschen.
Dushka, die damals fünfundzwanzig war, hatte ihre letzte Ultraschalluntersuchung acht Wochen vor der Geburt gehabt. Während der Untersuchung sagte die medizinische Assistentin, dass wir definitiv einen Jungen bekommen würden. Sie zeigte auf den Bildschirm und meinte: „Das sieht man hier ganz eindeutig, weil seine Beine nicht im Weg sind.“
Dieser Kommentar fiel uns nicht weiter auf und wir übergingen ihn einfach, aber im Nachhinein haben die Worte der Assistentin fast etwas Unheimliches. Dushka hatte ihre Ärztin sogar noch gefragt, dass sie das Gefühl habe, das Baby sei zu klein und läge irgendwie falsch herum, aber diese beruhigte uns, alles sähe ganz normal aus.
Wir hatten keinen Grund, die Aussagen der Mediziner anzuzweifeln. Dushka war ja selbst aus der Branche. Sie hatte schließlich auch auf alles Wichtige während der Schwangerschaft geachtet. Geraucht hatte sie noch nie, und während der Schwangerschaft waren für sie Alkohol und jegliche Medikamente tabu.
Als die Wehen einsetzten, lehnte Dushka schmerzstillende Mittel ab. Anfangs lief alles wie erwartet. Ich war mit im Kreißsaal. Es gab einen Moment der Aufregung, als die Hebamme merkte, dass das Kind in Stirnlage war, die ungünstigste Lage für ein Ungeborenes: Kopf und Nacken des Babys sind leicht gestreckt und der größte Kopfumfang muss während der Geburt durch das Becken. Normalerweise beugt das Kind bei Geburtsbeginn den Kopf, was der besten Geburtshaltung entspricht, aber wenn das Kind in Stirnlage bleibt, machen die Ärzte meist einen Kaiserschnitt.
Erleichtert stellten wir etwas später fest, dass unser Kind seinen Kopf in eine bessere Position gebracht hatte. Zu diesem Zeitpunkt war ich auch heilfroh, Dushka die Hausgeburt ausgeredet zu haben, bei der ich ihr assistieren sollte. Ich wollte nicht ohne ein Ärzteteam und die Möglichkeiten eines Krankenhauses mit Geburtskomplikationen konfrontiert sein.
Meine Erleichterung sollte nur von kurzer Dauer sein. Der Arzt benutzte eine Geburtszange, um dem Kind durch den Geburtskanal zu helfen. Nicks Kopf und Hals kamen heraus, und da fiel mir sofort auf, dass etwas mit seiner rechten Schulter nicht stimmte. Zuerst hatte sie für mich nur eine eigenartige Form, und dann wurde mir klar, dass offensichtlich ein Arm fehlte.
Aus meinem Blickwinkel war es schwer auszumachen. Die Schwestern rückten näher heran und verstellten mir die Sicht, und ich hatte nur diesen ersten Blick auf unser Kind erhascht, bevor sie ihn zur weiteren Untersuchung in eine andere Ecke des Kreißsaals brachten. Niemand sagte etwas.
Was ich gesehen hatte, wollte nicht in meinen Kopf. Ich vergaß zu atmen. Dushka hatte unser Kind bis dahin überhaupt noch nicht gesehen. Auch ihr Blick war von den Schwestern und Ärzten verstellt. Eigentlich rechnete sie damit, dass die Hebamme jeden Augenblick mit dem Baby zurückkam und es ihr in den Arm legte. Das war der normale Ablauf. Als nichts dergleichen geschah, wurde Dushka nervös.
„Ist alles in Ordnung?“, fragte sie.
Manchmal höre ich in meinen Träumen noch ihre ängstliche Stimme. Die Frage verhallte ohne Antwort. Die Ärzte und Schwestern blieben um unser Kind geschart. Dushka fragte noch einmal, diesmal mit mehr Nachdruck. Wieder kam keine Antwort.
Mein Verstand versuchte derweil immer noch verzweifelt einzuordnen, was ich gerade gesehen hatte. Es war alles so schnell gegangen. Ich fragte mich, ob da wirklich eine Schulter ohne Arm gewesen war. Als niemand auf meine Frau reagierte, wurde mir übel und ich umklammerte meinen Bauch. Wortlos geleitete mich eine Schwester nach draußen.
Auf dem Weg zur Tür schnappte ich ein Wort auf: Phokomelie. Ich hatte keine Ahnung, was es bedeutete, aber es machte mir Angst. Ich setzte mich in den Gang und vergrub das Gesicht in den Händen. Noch immer wusste ich nicht, was los war, aber irgendetwas stimmte ganz und gar nicht.
Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, bis der Kinderarzt herauskam. Er meinte, dass er Dushka etwas gegeben habe, damit sie schlafen und sich ausruhen könne.
„Ich muss mit Ihnen über Ihr Kind reden“, fuhr er fort.
„Ihm fehlt ein Arm“, platzte ich dazwischen.
„Ihr Kind hat weder Arme noch Beine.“
„Was? Gar keine Arme? Und keine Beine?“
Der Arzt nickte grimmig.
Später erklärte er mir, dass Phokomelie der Fachterminus für fehlende oder missgebildete Gliedmaßen sei. Ich habe noch nie einen richtigen Boxschlag gegen den Kopf bekommen, aber so stelle ich mir das Gefühl vor. Mein erster Gedanke war, Dushka zu holen, bevor es ihr irgendjemand erzählte. Ich stand auf, und der Kinderarzt legte mir auf dem Weg zurück in den Kreißsaal eine beruhigende Hand auf die Schulter. Mein Kopf raste, aber mein ganzer Körper fühlte sich taub an. Meine Knochen waren wie hohl, die Adern blutleer.
Ich überlegte verzweifelt, wie ich meiner Frau das beibringen sollte, aber als ich in den Kreißsaal kam, verriet mir ihr Weinen, dass mir schon jemand zuvorgekommen war. Das passte mir überhaupt nicht. Ich wollte bei ihr sein, als sie es erfuhr! Ich wollte sie trösten. Aber es war zu spät. Ich beugte mich zu ihr herunter, nahm sie in den Arm und versuchte, ihren Schmerz in mich aufzunehmen und ihr die Qualen zu erleichtern. Ihr Körper wurde von Schluchzern erschüttert, und mir ging es bald darauf nicht anders.
Dushka war von der langen Geburt und den Medikamenten noch ganz erschöpft; nach wenigen Minuten wurde sie still und schlief ein. Ich ließ sie sich ausruhen und hoffte, dass sie genug Kraft tanken würde, um all die schweren Entscheidungen zu fällen, die uns noch bevorstanden.
Während Dushka schlief, ging ich in den Säuglingssaal und betrachtete meinen Sohn zum ersten Mal aus der Nähe. Er lag mit anderen Neugeborenen, die alle in ihre Decken eingewickelt waren. Er schlief und sah eigentlich sehr süß aus, ein typisch hinreißendes Neugeborenes, so unschuldig und völlig unwissend, dass irgendetwas an ihm nicht stimmte.
Eine Schwester nahm Nick hoch und gab ihn mir. Zum ersten Mal hielt ich ihn im Arm. Ich war überrascht, dass er so schwer war, so kernig und stark. Er wog etwa sechs Pfund, und seine Robustheit war irgendwie tröstlich für mich. Er schien wie ein normales, liebenswertes Kind.
Ihn im Arm zu halten löste endgültig ein Gefühlschaos bei mir aus. Ich wollte ihn so gern lieb haben. Schon merkte ich, wie zwischen uns eine Bindung entstand, aber es stürmten auch ebenso viele Zweifel auf mich ein: Bin ich stark genug, so ein Kind großzuziehen? Was für ein Leben können wir ihm denn bieten? Werden seine Bedürfnisse unsere Kraftreserven übersteigen?
Die Schwester bot mir an, Nick aus seiner Decke zu befreien. Ich wusste nicht, ob ich schon bereit war, seinen Körper zu sehen, aber ich willigte ein. Sie können sich vorstellen, was es in mir auslöste, erst sein hübsches Gesicht und dann den winzigen Torso ohne Arme und Beine zu sehen. Eigenartigerweise kam mir sein Körper ziemlich stromlinienförmig und sogar hübsch vor, weil die Höhlen für Arme und Beine mit glatter, weicher Haut bedeckt waren.
Bei näherem Hinsehen fielen mir seine kleinen „Füßchen“ auf. Rechts war eher so ein Anhängsel. Der Fuß auf der linken Seite war deutlich ausgeprägter und hatte zwei sichtbare Zehen, die scheinbar zusammengewachsen waren. Die rechte Seite schien mehr ein Fortsatz als ein Körperglied zu sein. Der größere Fuß machte schon einen aktiveren Eindruck.
Davon abgesehen hatte Nick den strammen Körper eines normalen Jungen. Sein engelsgleiches Gesicht konnte jedes Elternherz höherschlagen lassen. Ich war irgendwie erleichtert über sein mangelndes Bewusstsein, seine ungetrübte Unschuld. So lange wie möglich wollte ich das Leid von diesem Kind fernhalten. Ich legte ihn wieder in das Bettchen und ging hinaus in eine ungewisse Zukunft. Mein Gefühl sagte mir, dass sich gerade meine gesamte Welt verändert hatte.
Auf der Fahrt nach Hause überrollte mich eine Traurigkeitswelle nach der anderen. Ich trauerte nicht um unser Kind, aber um den Sohn, den wir erwartet hatten. Unser Kind, so fürchtete ich, würde zeitlebens furchtbar leiden müssen. Meine Fassungslosigkeit und Verzweiflung mündeten schließlich in Wut. Wieso tust du uns das an, Gott? Wieso?
Ich kann nicht von mir behaupten, wie Superman oder ein mustergültiger Vater reagiert zu haben. Ich legte nicht sofort alles in Gottes Hände wie Hiob, der an einem Tag alle seine Kinder verlor und anschließend lässig sagt: „Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen.“
Meine Reaktion war die eines unvollkommenen, ganz normalen Mannes, eines Ehemanns und Vaters mit gebrochenem Herzen, der sich fragte, ob er für diese Tragödie verantwortlich war, für dieses unfertige Kind. War das eine Strafe für etwas? Viele Eltern von behinderten Kindern haben mir bestätigt, dass sie anfangs mit ähnlichen Zweifeln, Ängsten und Wut zu kämpfen hatten.
Ich mache mir ehrlich gesagt auch mehr Sorgen um die, die sich nicht gestatten, traurig zu sein. Psychologen sagen, dass man seine Gefühle nicht verdrängen sollte. Man sollte ihnen Raum geben, sie herauslassen, damit sie hoffentlich danach vorübergehen. Dieser Prozess ist unvorhersehbar, und jeder Mensch funktioniert anders. Trauer gehört zum Leben, zu jedem Leben dazu, und so leid es mir tut, auch zu einer Geburt, bei der die Erwartungen auf ein gesundes, vollkommenes Kind enttäuscht werden.
Im biblischen Buch Hiob geht es hauptsächlich um Hiobs innere Stärke, aber ich bin mir sicher, dass auch er seine zweifelnden, schwachen Momente hatte. Alle Eltern wünschen sich rundum gesunde Kinder, die eine strahlende Zukunft vor sich haben. Es ist ziemlich naheliegend zu befürchten, dass es ein behindertes Kind schwerer im Leben haben wird als andere.
Es sollte einem nicht peinlich sein, seine Traurigkeit zu zeigen und auch Tränen zuzulassen. Das sage ich vor allem den Vätern. Wir Männer glauben ja immer, dass wir harte Kerle sind und ohne Murren oder Jammern alle Lasten schultern müssen. Ein Junge weint nicht; so werden wir erzogen. Gefühle zeigen ist ein Zeichen von Schwäche. Aber wer liebt, kann auch Schmerz empfinden. Frauen und Mütter haben nicht das Gefühlsmonopol.
Auch Männer haben eine Bindung zu ihren Kindern. Sie haben Träume und Vorstellungen für die Zukunft ihrer Kinder. Wir Männer können zugleich stark sein und trotzdem Ängste und Gefühle zeigen. Jesus hat das nicht anders getan. Das ist nichts, wofür man sich schämen müsste. Jeder braucht Zeit, um sich an eine neue Situation zu gewöhnen und sich darauf einzustellen.
Durchkreuzte Erwartungen
Zu Hause erwarteten mich eine gespenstische Stille und ein leeres Haus, das für die Ankunft unseres ersten Kindes bunt geschmückt worden war. Im Kinderzimmer stand das Kinderbett mit weichen Decken. Mir fiel ein, dass ich mir beim Zusammenbau des Bettchens noch Sorgen gemacht hatte, das Seitengeländer könne nicht hoch genug sein, sobald das Kind aufstehen konnte. Alles, was ich jetzt vor meinem inneren Auge sah, war mein Sohn, der zeit seines Lebens ans Bett gefesselt war und niemals stehen, laufen oder auch nur krabbeln würde. Ich brach neben dem Kinderbett zusammen und weinte bitterlich, bis die Erschöpfung mir einen unruhigen Schlaf bescherte.
Der Morgen brachte kein Wunder. Alles tat mir weh. Ich trauerte um den perfekten Sohn, den wir nicht bekommen hatten. Ich trauerte um den verstümmelten Sohn, den wir in die Welt gesetzt hatten. Dass ich mich um so ein Kind kümmern konnte, schien mir außerhalb meiner Kräfte. Ich fühlte mich von Gott verlassen, der sonst immer an meiner Seite gewesen war. Am liebsten wollte ich gar nicht wieder ins Krankenhaus fahren. Es graute mir davor, meiner Frau gegenüberzutreten. Wie sollte ich sie denn trösten, wenn mir selbst jeder Halt fehlte? Wie sollte ich zu unserem unschuldigen Kind gehen, meinem Sohn, der mehr Unterstützung brauchte als ich zu geben imstande war?
Dushka war wach und völlig verheult. Ich fragte sie, ob sie das Kind schon gesehen hatte. Sie konnte nur den Kopf schütteln.
„Soll ich ihn holen?“
Wieder ein Nein.
Ich gab mein Bestes, um sie zu trösten, und blieb an ihrer Seite, bis sie wieder eingeschlafen war. Danach ging ich ins Säuglingszimmer. Unser Sohn lag mitten bei den anderen Neugeborenen. Er sah süß und zufrieden aus. Ich betrachtete sein hübsches Gesicht und dachte nur: Was für ein Leben soll ein Kind ohne Gliedmaßen führen? Er kann nicht laufen, sich nicht anziehen, nicht mal essen. Was soll aus ihm werden?
Wut stieg in mir auf. Warum, Gott? Warum hast du das zugelassen? Es wäre besser für ihn, nicht zu leben. Besser, als so ein Dasein zu fristen. Warum nimmst du ihn nicht wieder zu dir und ersparst ihm das ganze Leid und die Qualen?
Ich ging zurück zu meiner Frau. Sie war wach.
Sie wollte wissen, ob ich Nick gesehen hatte.
„Ja“, erwiderte ich. „Er ist ein hübsches Baby.“
Sie verzog das Gesicht vor Schmerz und wandte sich ab.
„Soll ich ihn dir bringen?“
Wieder schüttelte sie den Kopf und schluchzte in ihr Kissen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Unser Leben, wie wir es kannten, war vorbei.
In den ersten Tagen nach Nicks Geburt waren wir alles andere als Mustereltern. Das haben wir ihm später gesagt, und ich glaube, er versteht es. Das hoffe ich jedenfalls.
Menschlich, ganz menschlich
Auch nachdem wir den ersten Schock verdaut hatten, mussten wir uns intensiv mit unserem Zweifel auseinandersetzen, ob wir überhaupt das Zeug dazu hatten, Nick großzuziehen. Ein Faktor, der für uns sprach, war, dass Dushka und ich bereits fast fünf Jahre verheiratet waren. Wir hatten mit der Familiengründung gewartet, bis sie ihre Ausbildung zur Krankenschwester abgeschlossen hatte, und für die Weiterbildung zur Hebamme das Thema noch einmal verschoben. Ich war damals Angestellter und später Produktionsplaner. Wir hatten die Zeit zum Reisen genutzt und Geld für ein Eigenheim beiseitegelegt. Unsere Beziehung stand auf festem Grund. Wir waren Ehepartner und Freunde, und wir konnten über alles reden und fast immer einen Kompromiss finden.
Nicks Geburt sehe ich im Rückblick als erste große Belastungsprobe für unsere Beziehung, die erste von vielen. Ich glaube, Dushka machte eine Wochenbettdepression durch, die ihren ersten Schock noch verstärkte. Dass eine Frau nach der Geburt ihres Kindes erschöpft ist, ist ganz normal, und die meisten haben hinterher mit Stimmungsschwankungen und dem sogenannten „Baby-Blues“ zu tun, der durch die hormonellen Veränderungen nach der Geburt ausgelöst wird. Bei Dushka kamen zusätzlich noch Trauer und Angst hinzu und machten es ihr noch schwerer, sich mit Nicks Aussehen zu arrangieren.
Meine liebevolle, fürsorgliche Frau wurde nicht damit fertig und weigerte sich, Nick zu nehmen oder zu stillen. Angst und Sorgen hatten sie völlig im Griff. Sie weinte stundenlang und sagte Dinge wie, „Das kann nicht sein; das muss ein Albtraum sein. Ich schaffe das nicht.“
Dushka brauchte Zeit und Ruhe, um ihre Gefühle zu verarbeiten. Jeder hat ja seinen eigenen Weg, um mit Stress fertig zu werden. Für Trauer gibt es zwar aufeinanderfolgende Phasen, laienhaft gesagt: Nicht-wahr-haben-Wollen. Wut und Durcheinander der Gefühle. Auseinandersetzung mit der Trauer. Krise und Anpassung an die Situation, Neuanfang. Aber sie variieren ganz unterschiedlich in Dauer und Intensität.
Später las ich, dass Eltern, deren Kinder krank oder behindert zur Welt kommen, eine ganz eigene Form der Trauer durchleben. Manche bleiben für längere Zeit im Zyklus der Trauerphasen gefangen. Dann hilft professionelle Hilfe in Form einer Therapie, daraus herauszukommen.
Emotionales Trauma
Zu wissen, dass jeder anders mit Traumata umgeht, kann helfen und beruhigen. Schließlich sollen Ehepartner füreinander da sein. Über den anderen zu urteilen, ist da nicht hilfreich. Vielleicht sind Sie der Meinung, besser mit der Situation oder Ihren Gefühlen umzugehen, aber Sie können nicht wirklich wissen, welche Qualen Ihr Partner oder Ihre Partnerin ausstehen muss.
In den ersten Tagen nach Nicks Geburt war Dushka einfach überfordert, und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Das lag daran, dass ich die Tiefe und Intensität ihres Leids nicht wirklich begriff. Einmal kam ich in ihr Zimmer und fand sie weinend vor. „Habe ich etwa keine Blumen verdient wie andere Mütter?“, fragte sie mit tränenerstickter Stimme.
Ich war wie vor den Kopf gestoßen. „Doch, natürlich! Es tut mir so leid.“
Bei all dem emotionalen Chaos hatte ich völlig vergessen, ihr den traditionellen Blumenstrauß zu schenken. Ich ging schnell zum Blumengeschäft im Erdgeschoss und holte das nach. Dushka war auch verletzt, weil sich viele unserer Freunde und entfernten Verwandten nicht gemeldet hatten. Ich wusste, dass auch sie erst mit der unerwarteten Situation klarkommen mussten. Die meisten wussten einfach nicht, was sie sagen sollten, auch deswegen, weil wir mit vielen von ihnen noch nicht genauer hatten sprechen können. Allmählich trudelten noch mehr Blumen, Geschenke und Karten ein. Die meisten Karten waren sehr vorsichtig und einfühlsam geschrieben, und wir waren fast immer zu Tränen gerührt.
Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, haben Dushka und ich etwas ganz Typisches getan: Wir isolierten uns in diesen ersten Tagen und Wochen und zogen uns zurück.
Es gab verschiedene Gründe dafür. Wir trauerten und brauchten Zeit für uns, um einen Weg durch das Gefühlschaos zu finden. Zuerst wollten wir auch nicht darüber reden, weil wir Angst hatten, dass das alles nur noch schlimmer machen würde. Jedes Wort fiel uns schwer, und unsere Freunde wussten auch nicht, wie sie sich verhalten sollten.
Wir waren so in unserer eigenen zerbrochenen Welt, dass wir überhaupt nicht mitbekamen, wie alle um uns herum mitlitten. Auch sie nahm das Ganze natürlich mit. Ich musste mich ermahnen, dass meine Eltern, Schwiegereltern und andere Familienmitglieder genauso ihren Gefühlen Raum geben wollten. Wenn man leidet, verliert man leicht das Mitgefühl für andere. Man vergisst auch schnell, denen dankbar zu sein, die für einen da sind und helfen wollen.
Wir mussten uns erst über einiges klar werden, bevor wir andere an uns heranlassen konnten. Ich möchte Eltern in ähnlichen Situationen Mut machen, sich Hilfe zu holen, sobald sie sich dafür bereit fühlen; bei uns hat es den Heilungsprozess letzten Endes erleichtert, darüber zu reden.
Neuanfang
Dushka ist eine liebevolle Frau mit einem starken Mutterinstinkt, aber in den ersten Wochen fiel es ihr unendlich schwer, sich mit Nicks Behinderung abzufinden. Ich war bestürzt, dass sie auch nach zwei Tagen unseren Sohn nicht sehen wollte, aber mir wurde bald klar, dass sie einfach nicht sie selbst war.
Als die Mitarbeiterin der Sozialstation im Krankenhaus sah, wie sehr meine Frau unter der Situation litt, legte sie uns behutsam unsere Möglichkeiten dar. Sie sagte, wir könnten Nick zur Adoption freigeben, wenn wir es uns nicht zutrauen würden, ihn großzuziehen.
Anfangs war Dushka offener für dieses Thema als ich. Wir wussten beide, dass dies eine Entscheidung war, mit der wir für den Rest unseres Lebens leben mussten.
Ich wollte unseren Sohn nicht weggeben, aber ich machte mir Sorgen um meine Frau. Wenn sie sich sogar mit ihrer Krankenschwesterausbildung nicht in der Lage fühlte, sich um Nick zu kümmern, wie konnte ich dann darauf bestehen? Ich wusste nicht, ob sie wegen der Sorgen und Traurigkeit so erschöpft war, ob die Wochenbettdepression sie im Griff hatte oder beides.
Normalerweise wird eine Mutter wenige Tage nach der Geburt aus dem Krankenhaus entlassen und nimmt das Kind mit nach Hause. Bei uns war das nicht so. Die Frau von der Sozialstation sorgte dafür, dass Dushka noch dort bleiben konnte. Ich bekam ein Bett in ihr Zimmer gestellt, damit wir einander trösten und miteinander reden konnten.
Die Krankenhausbelegschaft spürte, dass wir Zeit brauchten. Sie redeten zwar mit uns, machten uns aber keinen Druck. Wir verbrachten mehrere Tage im Krankenhaus, ruhten uns aus und sprachen miteinander über unsere Gefühle. Allmählich redeten wir über die nächsten möglichen Schritte.
Wir hatten keinen Plan B für ein unvollkommenes Baby parat. Als Dushka einige Tage Kraft gesammelt hatte, sagte sie, sie sei jetzt bereit, Nick zu sehen und ihn zu nehmen. Ich war mir da nicht so sicher.
Sie schien noch immer emotional höchst instabil zu sein. Also sprach ich das an, und im Gespräch wurde mir bewusst, dass sie mit schweren Schuldgefühlen zu kämpfen hatte. Sie machte sich selbst für Nicks Behinderung verantwortlich, obwohl sie sich während der Schwangerschaft vorbildlich an alle Regeln gehalten hatte.
Zuerst fiel es mir schwer, ihr die Schuldgefühle zu nehmen, weil wir beide nicht wussten, wie es zu Nicks Fehlbildungen gekommen war. Wir hatten beide so viele Fragen! Es dauerte eine ganze Zeit, bis die Ärzte vermuteten, dass bei Nick eine Mutation der Gene stattgefunden hatte, die die Kindesentwicklung im Bauch der Mutter entscheidend beeinflussten.
Spießrutenlauf
Eltern von behinderten Kindern sagen oft, dass sie sich ein dickes Fell zulegen mussten. Ich hatte meine erste Berührung mit dieser bitteren Realität nicht lange nach Nicks Geburt. Ich traf mich mit jemandem, den ich immer als guten Freund gesehen hatte. Wir hatten oft miteinander gebetet und auch Privates miteinander geteilt. Ich dachte, er würde mir gegenüber sein Mitgefühl äußern. Stattdessen stellte er allen Ernstes Vermutungen an, die Behinderung unseres Sohnes müsse Gottes Strafe für meine Sünden sein.
Wenn ich ehrlich bin, hatte ich diesen Gedanken auch schon gehabt, wenngleich mir partout nicht einfiel, was ich Fürchterliches getan haben sollte, um so eine grausame „Strafe“ für meinen unschuldigen Sohn zu verdienen. Die Worte meines Freundes trafen mich tief und warfen mich tagelang aus der Bahn. Ich fühlte mich von seinem unsensiblen Urteil schwer gekränkt.
Ich ging wirklich in mich, um herauszufinden, ob er vielleicht doch recht hatte. Wir hatten einige offene Gespräche, und letzten Endes entschuldigte er sich bei mir. Ich glaube ja, dass er es trotz allem gut gemeint hatte. Trotzdem gehörte er zu dem wachsenden Kreis von Menschen, die uns mit ihren unsensiblen Kommentaren – manche mit den besten Absichten, andere einfach ahnungslos – tief verletzten. Dies war eine weitere schmerzhafte Lektion, die wir in der ersten Zeit machten und die viele Eltern mit behinderten Kindern machen müssen: Selbst wenn man als Eltern sein Kind angenommen hat und über seine Unvollkommenheit hinwegsehen kann, heißt das noch lange nicht, dass andere das auch können.
Einige Tage nach Nicks Geburt ging ich wieder zum Säuglingszimmer, um nach unserem Sohn zu sehen. Ich stand hinter der Scheibe und betrachtete den eingepackten Nick, der aussah wie alle anderen Neugeborenen. Als ich dort so stand, brachten zwei Krankenschwestern einen frisch gebadeten Säugling zu seinem Bettchen und widmeten sich anschließend unserem Sohn. Sie sprachen leise mit ihm und lächelten ihn an, und er erwiderte die freundliche Behandlung sofort. Ich weiß, manche sagen, Neugeborene können nicht lächeln, aber diese Leute haben nie unseren kleinen Nick gesehen.
Zum ersten Mal seit Tagen wurde mir ganz warm ums Herz, und ich spürte einen Anflug von väterlichem Stolz. Die Schwestern legten ihn auf einen Wickeltisch an der Wand. Aber als sie ihn aus seinen Windeln befreiten, änderte sich ihr Gesichtsausdruck. Sie rissen die Augen auf und schlugen sich erschrocken die Hände vor den Mund.
Traurigkeit übermannte mich und ich musste weg, raus aus dem Krankenhaus. Tränen liefen mir übers Gesicht. An diesem Tag kehrte ich nicht mehr zum Säuglingsraum zurück.
Eine gereifte Entscheidung
Natürlich konnte ich verstehen, warum sie so auf Nick reagierten. Dushka und mir war es ja nicht anders ergangen. Vor Nick hatte keiner von uns beiden je ein Neugeborenes ohne Arme und Beine gesehen, und auch keines mit kleinen, vom Rumpf herausragenden unterentwickelten Füßchen. Der Anblick eines völlig ungewohnten Körpers löst bei uns Menschen erst einmal Beklommenheit aus.
Dennoch fühlte ich mich von der Reaktion der Schwestern verletzt, wenngleich sich auch meine Vaterinstinkte meldeten. Das war mein Sohn, und ich wollte ihn vor allem Negativen beschützen – ob nun absichtlich oder unwissentlich. Allmählich stellte sich bei mir auch eine neue Überzeugung ein: Ich wusste zwar nichts darüber, wie man so ein Kind großzog, aber niemand würde ihn so annehmen und als Vater durchs Leben begleiten können wie ich.
Dushka und ich hatten uns wegen der Adoptionsfreigabe noch nicht entschieden. Mein Bauch schickte aber eindeutige Signale. Wir hatten angefangen, uns mit unserer neuen Situation abzufinden. Nick bekam leider eine Harnwegsinfektion, und die Ärzte wollten ihn sicherheitshalber noch ein paar Tage im Krankenhaus behalten. Das verschaffte uns aber immerhin noch mehr Bedenkzeit. Meine Frau und ich kehrten nach Hause zurück und ließen unser Kind in der Obhut der Ärzte, um gründlich über die Zukunft unserer Familie nachzudenken.
Wir sprachen offen über alle Möglichkeiten und unsere Sorgen. Es half uns beiden, dass wir aus einer ähnlichen Kultur kamen, einen ähnlichen Familienhintergrund hatten und auch den Glauben an Gott miteinander teilten. Das soll aber nicht heißen, dass wir keine Meinungsverschiedenheiten oder hitzige Diskussionen hatten. Wir waren unter enormem Stress und hatten beide schlaflose Nächte. Aber trotzdem versuchten wir einander zuzuhören.
Die Entscheidung konnten wir nur zusammen treffen. Wir mussten an einem Strang ziehen, weil keiner von uns es allein schaffen konnte. Einige Leute im Krankenhaus hatten uns gegenüber anfangs angedeutet, dass Nick wohl mit keiner normalen Lebensdauer rechnen könne, aber Dushka versicherte mir, dass das nicht der Fall sei, vor allem dann nicht, wenn er angemessen gepflegt und unterstützt werde.
Während wir unsere Möglichkeiten abwogen, merkte ich, dass Dushka langsam aus ihrem depressiven Tal herauskam. Als sie anfing, weniger über all die Schwierigkeiten zu reden, die uns erwarteten, und mehr über mögliche Lösungen und Antworten, wusste ich, dass meine Frau zurück war. Sie brachte den Vorschlag, dass wir uns mit anderen Eltern treffen sollten, die bereits ihr Leben mit einem behinderten Kind meisterten. Sie wollte wissen, wie die das schafften, welche Hilfen sie in Anspruch genommen hatten, welche Umstellung sie durchmachen mussten und wie der Alltag des Kindes aussah.
Eltern mit einem behinderten Kind bekommen ziemlich oft die Empfehlung, sich andere Betroffene oder auch eine Selbsthilfegruppe zu suchen. Diesen Luxus hatten wir nicht. Wir kannten einfach kein Kind wie unseres. Dabei hatten wir die Hoffnung gehabt, wenigstens in Sachen Prothesen, Rollstuhl oder anderen technischen Hilfsmitteln Tipps zu bekommen.
Es wäre so hilfreich gewesen – nein, ein Wunder geradezu –, ein älteres Kind mit denselben körperlichen Herausforderungen wie Nick zu finden. Wir hätten von seinen Eltern erfahren können, wie man ihm das Leben erleichtert, was funktioniert und was nicht und welche Ressourcen sie aufgetan hatten, um ihrem Kind ein so normales Leben wie möglich zu ermöglichen. Leider stellte sich dieses Wunder für uns nicht ein.
Auf dem Weg zu Akzeptanz
Auch das Krankenhaus hatte keinen Erfolg bei der Suche. Am nächsten kamen noch die Contergangeschädigten. Contergan war einst als Mittel gegen Schwangerschaftsübelkeit verschrieben worden. Erst als die schwerwiegenden Folgen bekannt wurden, wurde es verboten.
Man gab uns die Adresse einer Frau in Beaconsfield, einem Stadtteil von Melbourne. Ihre Tochter hatte verkrüppelte Arme und Beine. Sie war damals etwa fünf Jahre alt. Wir besuchten die Familie und erhofften uns einige Erkenntnisse und vielleicht sogar neuen Mut. Bei dem Mädchen waren die Gliedmaßen so weit entwickelt, dass sie Prothesen tragen konnte, die für Nick niemals infrage gekommen wären. Das einzige besondere Hilfsmittel war ein pilzförmiger Plastikstuhl. Indem sie hin- und herschaukelte, konnte sie ihn in Bewegung setzen und mit ihm durchs Zimmer rutschen.
Dushka und ich fühlten uns unwohl in unserer Haut, und wir hatten das Gefühl, nicht viel von diesem Kind und seiner Mutter lernen zu können.
Viel aufschlussreicher als das Gespräch war für uns, den Umgang der beiden miteinander zu beobachten. Es war offensichtlich, dass die Mutter auch nur begrenzte Kraftreserven hatte und ihre Tochter schwerbehindert war, aber ihre liebevolle Beziehung zueinander und die fast schockierende Normalität ihres Lebens ließ uns nicht mehr los.
Keiner von beiden schien mit der Situation überfordert zu sein. Sie machten das Beste daraus und jammerten nicht.
Ich habe oft über diesen Besuch nachgedacht und welchen Einfluss er auf unsere Entscheidung, Nick zu behalten, hatte. Bis dahin konnte ich mir kaum vorstellen, ein behindertes Kind großzuziehen. Ich sah nur Mühsal und Elend für Nicks Zukunft voraus. Die Tochter dieser Frau hatte Fehlbildungen an Armen und Beinen, und trotzdem schien sie ein fröhliches Kind zu sein, das sich von seinem Körper nicht unterkriegen ließ.
Der Besuch hinterließ bei mir Spuren. Ich begriff, dass es besser war, Nicks Situation zu akzeptieren und Tag für Tag das Beste daraus zu machen, als sich den Zukunftsängsten hinzugeben. In der Bergpredigt vertritt Jesus genau dieses Prinzip: „Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt, und lebt nach Gottes Willen! Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen – der nächste Tag wird für sich selber sorgen! Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat.“
Mark Twain wird folgender Ausspruch nachgesagt: „Sich sorgen ist wie die Schulden eines Fremden abzuzahlen.“ Es ist ein Fehler, sich mit den Sorgen über das Morgen derartig zu belasten, dass man die Freuden von heute nicht mehr genießen kann. Planen ist wichtig, aber es steckt genauso viel Weisheit darin, jeden Tag zu nehmen, wie er kommt und das Gute darin zu suchen.
Sowohl das Mädchen als auch ihre Mutter lebten im Hier und Jetzt und gingen die Herausforderungen eine nach der anderen an. Das berührte Dushka und mich gleichermaßen, wie wir hinterher herausfanden.
Nach weiteren Gesprächen mit unseren Eltern, Freunden und Verwandten beschlossen wir, Nick nach Hause zu holen. In Wahrheit glaube ich, dass wir das von Anfang an wollten. Er war doch unser Kind. Wir fuhren am nächsten Tag ins Krankenhaus und verkündeten der Mitarbeiterin vom Sozialdienst unsere Entscheidung. Hinterher fiel ein Großteil des Stresses von uns ab. Wir hatten uns mit der Entscheidung und den potenziellen Auswirkungen wirklich gequält. Es war eine Erleichterung, sich für eine Sache entschieden zu haben und unser Herz für Nick zu öffnen.
Während dieser Zeit begleitete mich ein bestimmter Bibelvers. Als der unverheirateten Jungfrau Maria ein Engel verkündete, dass sie einen Sohn bekommen würde, fragte sie: „Wie soll das zugehen?“ Der Engel antwortete: „Bei Gott ist kein Ding unmöglich.“
Dushka und ich waren zuerst genauso vor den Kopf gestoßen wie Maria. Aber nun hatten wir beschlossen, dass unser Glaube uns tragen sollte: Mit Gottes Hilfe wollten wir dieses Kind großziehen und ihm helfen, die vielen Schwierigkeiten durchzustehen, die auf es warteten.
Von diesem Tag an war es unser erklärtes Ziel, Nick ein Leben als selbstbewusstem und möglichst selbstständigem Mann zu ermöglichen. Wir sahen nicht mehr zurück und bereuten unsere Entscheidung nie. Unsere Liebe zu ihm wuchs von Tag zu Tag.
Gedanken zum Mitnehmen
Machen Sie sich Ihre Traurigkeit bewusst und geben Sie ihr Raum.
Geben Sie sich Zeit, um emotional wieder Boden unter die Füße zu bekommen.
Sie brauchen mehr Ruhe als sonst, um mit dem Stress umzugehen.
Machen Sie sich keine Vorwürfe wegen der Behinderung Ihres Kindes, auch nicht Ihrem Partner.
Treffen Sie keine überstürzten Entscheidungen.
Holen Sie sich so viel Hilfe wie möglich: von Experten, anderen Eltern usw.
Nehmen Sie sich Zeit, um sich an die neue Situation zu gewöhnen.
Machen Sie sich bewusst, dass Ihr Umfeld auch betroffen ist.
Ihr Leben ist anders geworden, aber Sie können es schaffen, einen Tag nach dem anderen.