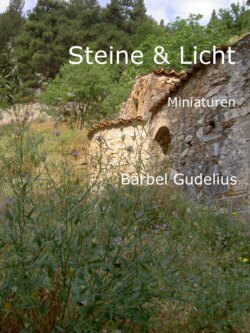Читать книгу Steine und Licht - Bärbel Gudelius - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die weltabgewandte Seite des Gesichts
ОглавлениеAls Hernán Cortez im Jahre 1519 seinen Fuß auf mesoamerikanischen Boden setzte, als er sich dem Land zu- und vom Meer abwandte, als er befahl, die Schiffe, die dort draußen ankerten, zu verbrennen - wußte er, wo er war? Und die sechshundert Seeleute, die Velázques ihm auf diese Expedition mitgegeben hatte, die sahen, wie ihre einzige Verbindung zur Heimat gekappt wurde, der einzige sichere Boden unter ihren Füßen, den sie kannten, die Schiffe, auf denen sie, beladen mit Gold, zurückkehren wollten - was empfanden sie angesichts der lodernden und ins Meer sinkenden Karavellen?
Es gibt keine historischen Tatsachen; es gibt nur Deutungen. Geschichte ist eine Geschichte von Deutungen; jedoch verbirgt sich unterhalb der berichteten Ereignisse eine andere Dimension, eine verborgene Realität, ein dunkler subhistorischer Strom, der Anderes mit sich trägt und transportierrt als Jahreszahlen, Königskrönungen, Königsmorde, Revolten und Revolutionen: Wünsche, Sehnsüchte, Erinnerungen. Sie alle gehen in die Deutungen ein.
Cortez hatte ein Land vor sich, von dem er nur wenig wußte. Er kam von Kuba: es gab einige Berichte von Spaniern, die bereits auf dem Festland gewesen waren; sie waren eher dürftig. Cortez gründete den Stützpunkt Veracruz, drehte sich um und marschierte los. Das heißt, er ritt natürlich.
Sie trafen bei den Azteken auf ein Volk, das seinerseits aus Eroberungen hervorgegangen war und spätere Berichte, zum Beispiel der Codex Florentino, rühmten die sittliche Grundhaltung der Mexica, die Erziehung zu Arbeitsamkeit, Ehrlichkeit, Sparsamkeit, Takt, Klugheit, Mut - kurz, den Christen durchaus bekannte Eigenschaften sowie die Verachtung von Faulheit, Nachlässigkeit, Unzuverlässigkeit und Unaufrichtigkeit, Betrug und Diebstahl. Die Erkenntnis dieser Sittlichkeit führte bei den Eroberern zu Irritationen, vielleicht sogar zu Zweifeln an der Rechtmäßigkeit der Conquista.
Aber es gab da etwas, etwas Entsetzliches, das diese Zweifel wieder aufhob und die Unterdrückung, die Ausbeutung und Ausrottung der indigenen Völker zu rechtfertigen schien: die Menschenopfer, die dunkle Seite der aztekischen Kultur. Die Azteken jedoch hielten diesen Opferkult nicht nur für absolut zulässig, sondern für unverzichtbar und hätten Kritik daran überhaupt nicht verstanden. Denn es ging um die Ordnung der Welt, es ging darum, die Welt zusammen zu halten, das Chaos nicht herein zu lassen in die Gesellschaft, die Götter konnten bedrohlich sein, sie konnten den Untergang der Welt herbeiführen und so war es notwendig, sie zu beschwichtigen, ihren Blutdurst zu stillen, lebenden Menschen das Herz aus dem Leibe zu schneiden. Verwendet wurden dafür Sklaven und Kriegsgefangene und die Azteken führten ihre Kriege, die wohl eher Raubzüge waren, genau zu dem Zweck. Auch Kinder wurden geopfert durch Einmauern und Ertränken.
Diese Bräuche dienten letztlich zur Rechtfertigung der Eroberung und Versklavung der indigenen Völker durch die christlichen Eroberer, wobei sie, wie vermutlich alle ihre Zeitgenossen und wie fast alle Menschen zu allen Zeiten, keine Parallele zu ziehen fähig waren zwischen den Menschenopfern auf den Altären und den Opfern, wir benutzen das Wort immer noch und gerade hier, die ein Krieg fordert, und so ausgedrückt, scheint der Krieg ein Gott zu sein, der Opfer genauso fordert wie Huitzilopochtli.
In Tlatilco schufen Töpfer Totenmasken, die zur Hälfte das Gesicht eines Lebenden und zur anderen Hälfte das eines Toten zeigte. Sind nicht Leben und Tod zwei Seiten einer einzigen Wirklichkeit? und haben diese Menschen das verstanden? Der Opfertod wurde „Blumentod“ genannt - ein genauso ehrenvoller Tod wie der auf dem Schlachtfeld; ein natürlicher Tod durch Krankheit oder Alter wurde als nicht ehrenvoll betrachtet. Auch das ist etwas, was uns nicht ganz fremd ist; wir glauben heute, es überwunden zu haben, aber ist das so?
Vor mir liegt die Fotografie einer Skulptur: ein oltekischer Steinkopf. Der fast runde Kopf hat zwei Hälften: die rechte Seite zeigt das Gesicht eines Menschen, ein schmales, sichelförmiges Auge, eine halbe Nase einen halben Mund, eine Wange. Die linke Hälfte des Gesichts ist nicht herausgearbeitet; aber der Stein ist auch nicht grob belassen, sondern geglättet, sodaß sich diese Seite wie eine Maske vor das halbe Gesicht zieht. Diese Glättung und die Anpassung des Steins an die Rundung des Kopfes zeigt, dass es keine halbfertige Arbeit ist, sondern etwas, was den Totenmasken in Tlatilco entsprechen könnte: das halbe Gesicht des Menschen. Denn die andere Hälfte ist weltabgewandt, nicht sichtbar, einem Reich zugewandt, von dem wir nichts wissen, auch meist lieber nichts wissen wollen.
Aber jene Menschen haben etwas davon verstanden, dass der Tod die andere Seite des Lebens ist. Er war so sehr ein Teil ihres Lebens, dass sie es ausdrücken konnten in einem halben Gesicht.
Und hat der Schrei „Viva la muerte“ der spanischen Faschisten vielleicht etwas damit zu tun, dass aus diesem indigenen Bewußtsein etwas übergegriffen hat auf den Eroberer?