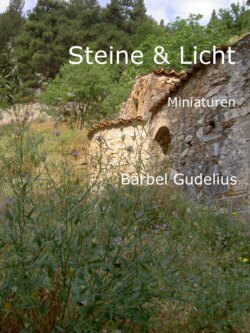Читать книгу Steine und Licht - Bärbel Gudelius - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Wahrheit des Lebens ausdrücken
ОглавлениеDie Fahrt ging nach Norden, vom Finnischen Bahnhof aus. Wir ließen die Stadt hinter uns, die Megastadt mit ihren Plätzen und Palästen, mit ihren Straßen wie Kanäle und ihren Kanälen wie Straßen, mit ihren Hinterhöfen und Kaufhäusern, ihrer klassizistischen Strenge und den Golddächern der Basiliken, mit ihren U-Bahn-Schächten und Rolltreppen. Wir fuhren nach Norden, eine Fahrt von einer knappen Stunde; die elektritschka war voll, fliegende Händler mit Plastiktaschen, die ihre kleinen, transportablen Waren anpriesen, Musikanten, die traurige russische Weisen auf ihrem Akkordeon spielten und in ihrer Mütze Geld einsammelten, um dann in den nächsten Wagen weiterzuziehen - marginale Existenzen, wie leben solche Leute?
Dann lagen auch die Vororte hinter uns, das Land begann. Nicht sofort, die elektritschka fuhr nicht schnell, allmählich erschienen die Birken, vereinzelt zunächst, dann in kleinen lichten Wäldchen, sie spiegelten sich in moorigen Tümpeln, hier konnte man sehen, worauf St. Petersburg gebaut worden war, auf schwarzem schwankendem Grund, auf Moor und Sumpf.
Und auf den Knochen von Tausenden von Leibeigenen, von adligen Herren dem Zaren zur Verfügung gestellt, die seit 1703 in wenigen Jahren die Wälder der Umgebung in die Sümpfe trieben, auf dass Peter I. sein Tor nach Westen öffnen konnte. Peters Denkmal, der Reiter auf dem steigenden bronzenen Hengst, so berühmt wie er selbst, der mit ausgestrecktem Arm nach Westen deutet, steht an der Newa. An die Leibeigenen erinnert nichts.
Kleine Bahnhöfe, Stationsschilder in einer fremden Schrift. Dennoch stiegen wir richtig aus: Repino. Zwei blutjunge Polizisten, die sich offensichtlich langweilten und entzückt waren, uns weiterzuhelfen, wiesen uns, mit der Sprache der Hände und unsererseits dem Verstehen einiger russischer sowie internationaler Wörter wie ‚Bus‘ den Weg zur Bushaltestelle. Drei Stationen, und da waren wir: im Haus des Malers Ilja Repin. Heute Museum.
Es ist ein sehr eigentümliches Haus, Repin hat es selbst entworfen, oder vielmehr: er hat es wie ein Schneckenhaus um sich herum gebaut. Ich habe keinen Grundriss; einzig daraus könnte man die Struktur dieses Hauses erkennen: man tritt vom Flur aus, nachdem man Filzpantoffeln übergezogen hat, in einen Wohnraum, an den ein kleines Zimmer grenzt, eine Garderobe oder ein Dienerzimmer; die Wohnräume der Familie liegen hinter diesem ersten Raum hintereinander, in einer Art von Rundbau, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, eine vorgebaute verglaste Veranda, das Esszimmer.
Man darf nicht vergessen, dass Repin noch in einer Zeit lebte, in der Dienerschaft selbstverständlich war, ja, unumgänglich, da die gesamte Hausarbeit von der Hausfrau allein nicht zu schaffen war. Bei Repin jedoch herrschte ein eigentümlich demokratisches Prinzip: bei Tisch wurde nicht bedient. Im Esszimmer steht er noch, der wuchtige runde Tisch mit dem drehbaren Aufbau in der Mitte, auf dem die Speisen und Getränke standen: jeder Gast, und es gab immer viele Gäste, drehte die Scheibe, um sich von den Speisen selbst zu nehmen. Wer so unvorsichtig war, um das Brot oder die Butter, den Wein oder die Sauce zu bitten, wurde dazu verurteilt, auf einer hölzernen Kanzel fast unter der Decke, zu der eine Treppe hinauf führte, eine Rede zu halten. Im Laufe der Zeit saßen an diesem Tisch wohl alle Petersburger, deren Namen etwas galt, unter anderen Maxim Gorki mit seiner Frau, Fjodor Schaljapin, Wladimir Majakowski, Lew Tolstoi, um nur einige zu nennen. Es war eine originelle und sehr individuelle Form eines alternativen Lebens, wie es das nach der Jahrhundertwende in ganz Europa gab: Versuche, der bürgerlichen und spießbürgerlichen Vorherrschaft zu entkommen, häufig verbunden mit dem Umzug und Rückzug aufs Land; Landkommunen entstanden mit Versuchen, die wir heute biologischen Anbau nennen, das große Vorbild in Russland war natürlich Tolstoi, Graf und Bauer.
Ilja Repin, 1844 geboren im Gebiet Charkow, verließ die Großstadt, verließ 1900 Russland und ließ sich jenseit der damaligen Grenze am Finnischen Meerbusen nieder. Denn damals war das hier Finnland. Wenn man sich die Karte anschaut, verlief die damalige finnisch-russische Grenze knapp hinter Petersburg und teilte den Ladoga-See in zwei Teile. Im Jahre 1918, nach dem Sieg der Revolution, wurde die Grenze geschlossen. Repin wurde finnischer Staatsbürger.
Das Haus, das er mitten in ein Waldstück baute, etwa 100 Meter vom Meer entfernt und geschützt vor den Winterstürmen durch ein paar Kiefernwäldchen auf niedrigen Dünen, nannte er Penaten, nach den alten römischen Haus- und Schutzgöttern. Es wurde sein ständiger Wohnsitz bis zu seinem Tod.
Das Haus ist ein Rundbau mit Ecken - anders kann man es nicht beschreiben. Niedrige Räume mit weißgestrichenen Holzdecken und Fensterrahmen, vor den Fenstern weiß Voile-Vorhänge - das Weiß bewirkt, dass die Räume, obwohl sie klein und niedrig sind, weiträumig und groß wirken.
Alles, so hieß es, sei wie zu Lebzeiten Repins wieder hergerichtet worden, nachdem das Haus im Krieg abgebrannt ist. Auch das Atelier im 1. Stock mit Sofa, Staffeleien, Pinseln in Töpfen, Paletten, Farben, Fotografien von einigen seiner Gemälde im ganzen Haus, Originale wären hier zu gefährdet und ohnehin sind sie verstreut weltweit in Museen.
Und ringsum lichter russischer Wald, Birken, Kiefern. Wege, die wir gehen und die Repin gegangen ist, mit seinen Freunden, mit seinen Kindern, mit seiner Lebensgefährtin, der Schriftstellerin Natalia Nordmann. Rasen unter den Bäumen. Eine kleine Brücke über einem Graben, weiß gestrichenes Geländer.
Sein Grab - der Platz von ihm selbst bestimmt noch zu Lebzeiten; ein einfaches weißes Holzkreuz mit drei Querbalken, einem oberen kurzen, einem mittleren längeren mit einer kleinen schwarzen Tafel, kyrillische Buchstaben, und unten dem schräggestellten Querbalken, Kennzeichen des orthodoxen Kreuzes. Auf dem Grab frische Blumen, nicht gepflanzt, hingelegt. Das sind die einzigen Blumen, die wir gesehen haben; es gibt keinen Garten, nicht vor und nicht hinter dem Haus. Es gibt nur den Wald, der bis ans Haus reicht, hell, die Stämme stehen nicht sehr nah beieinander, aber sie sind höher als das Haus.
Es ist still; langsam gehen wir die Wege entlang, nur von der Straße her das Rauschen der Räder auf Asphalt. Die Straße, über die wir mit dem Bus hergekommen sind; damals wird sie ein Feld- oder Waldweg gewesen sein, eine alte Landstraße, ungepflastert, staubig und mit ausgefahrenen Spurrillen von den Rädern der Kutschen und Kaleschen, der Landauer und Coupès, mit denen die Gäste vom Bahnhof Kuokalla abgeholt wurden oder von Petersburg kamen. Die Stille scheint von den Bäumen auszgehen oder von den Dächern des Hauses, die man durch die Bäume schimmern sehen kann, sie scheinen aus Glas zu sein, oder aus Silber, oder aus Silberglas, falls es so etwas gibt, sie sind von einem transparenten Weiß oder Grau, sie glänzen und erinnern mich an den von Christo verhüllten Reichstag, der denselben Silberschimmer ausstrahlte und von dem eine große Ruhe auszugehen schien. Ähnliche Ruhe strömt auch dieses Haus mit seinen wie durchsichtigen Glas- oder Silberdächern aus.
Ja, man muss von Dächern reden, denn jeder Teil des Hauses hat sein eigenes, seiner Grundform angepasstes Dach: rund und nach oben spitz zulaufend über dem Wohnzimmer, dessen Außenwand ein Halbrund beschreibt; schräge Flächen, gegeneinander verkantet; rund um eine Art Bullauge herum; vorspringend, zurückfliehend über den weißen und braunen Außenmauern, über den braun umrandeten Fenstern, diese Aussenwände im Erdgeschoss mit ihren großen Feldern oder Fächern, ausgefüllt mit Gittern aus braunem Holz und weiß verputzt; unter einem Fenster reißt eine Chimäre ihr Maul auf, ein löwenähnlicher geflügelter Sphinx, ein Ungeheuer, dunkel auf weißem Grund.
Das Obergeschoss besteht aus braungestrichenen Holzbalken, was durchaus an die alten Häuser in Finnland, vielleicht auch die in Russland, erinnert und das war vom Bauherrn wohl auch so gewollt. Im 1. Stock eine Veranda mit weißen alten Korbmöbeln, wie alle Möbel im Haus sind es die echten, die Repin gehörten, sie wurden Anfang des Krieges, vor dem Brand, ausgelagert. Und hier konnte man den Eindruck haben, zwischen Baumwipfeln zu sitzen.
Und seine Bilder? Im Wohnzimmer hängt eine Reproduktion seines wohl berühmtesten Bildes: Die Wolgatreidler. Man hat ihn den „Dostojewski der Malerei“ genannt; wenn man dieses Bild betrachtet, weiss man, warum. Hier ist das ganze Elend Russlands beisammen, Menschen wie Zugtiere; treideln, das war nicht nur in Russland die einzige Möglichkeit, Schiffe stromaufwärts zu bringen, an jedem Fluss in Europa gab es auf beiden Ufern Treidelpfade, andernorts wurden Pferde eingesetzt. Aber auch Menschen, immer wieder. Zehn oder zwölf Männer ziehen, die Gurte um den Brustkorb gespannt, die Gesichter vor Anstrengung verzerrt, ein Schiff flussaufwärts. Es ist ein Bild, das eine Geschichte erzählt, wie so viele von Repins Bildern, die Geschichte der niedrigsten Löhne bei härtester Arbeit, des Elends und der Not, der löchrigen Kleider und Schuhe, oft nur von einem Strick zusammengehalten, des Hungers, der Erschöpfung; die Geschichte der Erniedrigten und Beleidigten.
Dass Elend auch eine andere Dimension haben kann als das aus nackter Not geborene, zeigt Repin mit seinem Bild „Iwan der Schreckliche und sein Sohn Iwan am 18. November 1581“. Das ist ein Stoff, aus dem die Tragödien gemacht sind: Zar Iwan IV. (1530-1584) erschlug im Zorn seinen einzigen Sohn und Erben. Es gibt zwei Fassungen dieser blutigen Tat von Repin, die nur in Einzelheiten voneinander abweichen, das erste entstand 1884 und hängt heute in Moskau in der Tretjakow-Galerie; das zweite wurde 1889 fertiggestellt und befindet sich in Kiel in der Kunsthalle. Beide Fassungen zeigen den Vater, der den blutenden, sterbenden Sohn in seinen Armen hält, in seinem Gesicht steht das Entsetzen über seine Tat.
Eine ganz andere Geschichte steht hinter dem Porträt „Protodiakon“ aus dem Jahre 1877. Repin war berühmt für seine Porträts; er begann als Ikonenmaler und vielleicht rührt daher sein Einfühlungsvermögen in das Wesen eines Menschen, eines Gesichts. Was er nach seiner Zeit als Ikonenmaler hinzugewonnen hat, ist die Fähigkeit, den individuellen Ausdruck herauszuarbeiten und Seelenregungen jenseits des Offensichtlichen. Dieser Protodiakon aus Repins Heimat war, schreibt er, „ein Löwe unserer Geistlichkeit, dem nicht das geringste an Geistigkeit anhaftet - nur Fleisch und Blut, glotzäugig, Maul und Gebrüll. Das Gebrüll ist zwar sinnlos, aber feierlich und kraftvoll, wie der Ritus selbst in den meisten Fällen.“ Von diesem Protodiakon, der dem Priester während der Messe behilflich war, wurde berichtet, dass er sich mit Vorliebe in den Kneipen mit Trunkenbolden herumtrieb, um auf dem Nachhauseweg unbekümmert kirchliche Hymnen mit einer enormen Bassstimme zu singen. Auf Repins Porträt hat er die rote Gesichtsfarbe und Nase des Säufers, einen gewaltigen weißen Bart und hochgeschwungene dunkle Augenbrauen unter der runden Kappe. Er trägt einen weiten dunklen Mantel, unter dem man unschwer den mächtigen Körperbau und Brustkorb erahnen kann, eine in sich ruhende, ihrer selbst sichere Persönlichkeit.
Aber es gibt auch Bilder von großer Poesie, vor allem seine frühen, die noch unter dem Einfluss der französischen Impressionisten entstanden, Bilder wie „Herbststrauss“, für das seine älteste Tochter Wera Modell stand, eine bäuerliche Schönheit in einer blühenden Wiese, mit Blumen am Kleid und einem Strauß in den Händen; ihr Blick geht ins Unbestimmte, vermittelt Nachdenklichkeit und ein ganz kleines bisschen Wehmut, spätsommerliche Stimmung. Wera ist seine Lieblingstochter, sie bleibt unverheiratet; nach dem Tod von Repins Lebensgefährtin Natalia Nordmann zieht sie zu ihm nach Kuokkala, um ihm bis zu seinem Tod den Haushalt zu führen.
Nach Repins eigenen Worten war ihm stets darum zu tun, mit seiner Malerei „die Wahrheit des Lebens“ auszudrücken.
Das Meer, die Baltische See, die hier Finnischer Meerbusen heißt, steingraues Wasser, rollte in hohen und breitgezogenen Wogen von Helsinki her an diese Küste, die einmal zu Finnland gehörte, Karelien, über die Sibelius seine traurige und schöne Orchestersuite Karelia schrieb, ein paar Jahre, bevor Repin hierherzog. Ein einsames Meer. Wir gehen zurück, an diesem Strand entlang, in der Ferne die Häuser des Ortes Repino, auch mit einem großen Hotelkomplex, aber so weit gehen wir nicht, nach einem letzten Blick auf das melancholische Meer wenden wir uns der Straße zu, um den Bus zu nehmen, um zurück zu fahren zur Bahnstation der elektritschka, zurück nach St. Petersburg.