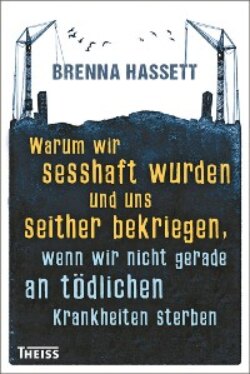Читать книгу Warum wir sesshaft wurden und uns seither bekriegen - Brenna Hassett - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1
Papa Was a Rolling Stone
ОглавлениеDie Täler Jordaniens sind eine höchst faszinierende Landschaft. Vor einem lieblichen blauen Himmel ragen große rostrote Aufschlüsse von roher Geologie auf, durchzogen von Spalten, durch die ganz knapp ein Geländewagen passt. Die Felskante des Jordangrabens bildet eine unüberwindliche Mauer über den gesamten östlichen Horizont, wenn man über die Landstraße 90 von Amman in Richtung Süden fährt, allmählich in die flachen, salzigen Ödlande vordringt, die mit nicht explodierten Minen aus den arabisch-israelischen Kriegen übersät sind, und weiter in Richtung Aravasenke fährt. Je näher die Straße an die Flanke des Gebirgsmassivs führt, desto deutlicher werden die kleinen Spalten in der Berglandschaft. Es sind von Wasser, Zeit und Tektonik erodierte Kanäle und Kanälchen und die einzigen Zugänge für Beduinen, Kamele oder Geländewagen in die verborgene Welt der Täler dahinter. Denn obwohl die ausgeblichenen gelbgrauen, spärlich bewachsenen, felsigen Hänge und die unwirtlichen Salzbeläge an den Ufern des Toten Meeres den Eindruck einer unbarmherzigen, unwirtlichen Umgebung wecken, war dieses Wüstenland der Schauplatz für eins der frühesten Experimente einer späteren großen menschlichen Revolution: das Sesshaftwerden.
Ich hatte reichlich Zeit für diese Beobachtungen, als ich im Januar 2012 eingekeilt auf dem Notsitz eines halbwegs modernen Pick-ups saß, einem von drei Geländewagen, den wir beim Council for British Research in the Levant geliehen hatten. Am Steuer saß Bill Finlayson, der Regionalleiter des Council, der eine Sightseeingtour für einen zusammengewürfelten Haufen Archäologen organisiert hatte, die im Rahmen des siebten jährlichen World Archaeological Congress an einer Tagungssitzung zum Neolithikum im Nahen Osten teilnahmen. Ich hatte meinen eigenen Mietwagen auf dem Hotelparkplatz stehen gelassen und wurde mit einigen der sachkundigsten Experten in der Region in den Geländewagen verladen – Akademiker, die sich ausschließlich mit dem Entwirren der Geheimnisse um den Übergang der Menschen vom Jäger-und-Sammler-Leben zum Sesshaftwerden und dem ganzjährigen Verbleiben am selben Ort beschäftigten. In einer fantastischen Sitzung hatten wir Details und Entdeckungen erörtert, auch wenn alle Vorträge in diesem Jahr einen düsteren Unterton hatten, weil die Lage in Syrien gerade aus den Fugen geriet. Aus einem 15-minütigen Bericht über eine Ausgrabungsstätte in Syrien wurde eine herzzerreißende 30-minütige Diskussion über die Sicherheit der Arbeiter vor Ort und über Vermisstenmeldungen. Überall in Jordanien waren in diesem Jahr weiße UN-Flüchtlingszelte wie Pilze aus dem Boden geschossen; die gut 200.000 Saisonarbeiter aus Syrien, die normalerweise in den Süden zogen, um auf jordanischen Feldern zu arbeiten, hatten sich geweigert heimzufahren und ihre Zelte hatten ein halbstationäres, anbauartiges Aussehen angenommen – eine seltsam nostalgische Entwicklung in einem Land, das jahrelang versucht hatte, die Beduinen aus ihren traditionellen Zelten in feste Dörfer zu bekommen.
Dieses allmähliche Wechseln der ehemaligen Saisonarbeiter von Übergangszelten in robustere, halbstationäre Hütten ist ein sehr modernes Phänomen, aber es spiegelt auf merkwürdige Weise genau den Prozess wider, den wir auf unserer Fahrt durch Jordanien besser verstehen wollten: das Ansiedeln. Während wir auf der Landstraße 90 in unserem zusammengewürfelten Konvoi gen Süden fuhren, erklärte Bill, der über die längste Zeit seines Berufslebens immer wieder in Jordanien gearbeitet hatte, die unerwarteten geopolitischen Auswirkungen von Jordaniens florierendem Agrarsektor und Syriens aufkeimendem Bürgerkrieg. Für mich war das ein seltsames Nebeneinander. Hier machten wir uns auf den Weg zu den allerersten bekannten permanenten Ansiedelungen und fuhren dabei durch eine Landschaft voller Hinweise auf die Nomaden des 21. Jahrhunderts, sowohl Beduinen als auch Wanderarbeiter. Wenn man sich die unwirtliche Landschaft so ansah, fragte man sich unweigerlich, warum sich überhaupt jemand ausgerechnet hier niederlassen wollte.
Die Frage wurde sogar noch drängender, als die Kolonne sich auf etwa halbem Weg zum Roten Meer hinunter nach Osten in einen der vielen kleinen flachen Einbuchtungen im Vorgebirge wandte und vorsichtig über den Kies und den Sand rumpelte, die unaufhörlich über die dahinschlängelnde Straße geweht wurden. Endlich vom Meer abgewandt, die Berge vorübergehend durch das dazwischenliegende Becken zurückgedrängt, bot sich uns hier eine Aussicht auf gelblichen Kies und Sand mit einzelnen Gruppen von Dattelpalmen, eingefasst von rasch ansteigenden violett-grauen Gebirgsausläufern. Ein außergewöhnlich fotogenes Kamel und sein Junges, ein schlaksiges Kerlchen etwa von der Höhe unseres Toyotas und zu rund 80 Prozent aus Knien bestehend, beobachteten ausdruckslos, wie wir akribisch den Haarnadelkurven der Straße folgten, die sich über den flachen, strukturlosen Talboden schlängelte. Ich fragte mich damals (laut), wie ich da so eingeklemmt mit den Knien an der Rückbank und neben die Grabungsleiterin Mihriban Özbaşaran und den stellvertretenden Leiter Güneş Duru der Ausgrabungen im türkischen Aşikli Höyük* gequetscht saß, warum man wohl so viele Kurven fahren musste, um eine so flache Ebene zu durchqueren. Das war, wie sich herausstellte, eine äußerst törichte Frage. Kaum hatten wir etwas passiert, das ich nur als beduinischen Kofferraum-Flohmarkt beschreiben kann, wobei die Kofferräume allerdings Ladeflächen kleiner Pick-ups waren, die mit Schafen beladen waren oder als Anbindepfosten für gelangweilt aussehende Kamele dienten, da brachte Bill den gesamten Konvoi kiesspritzend zum Stehen.
Wir purzelten heraus wie nach einer dieser verrückten Wetten, wie viele Menschen in einen VW Käfer passen, um das Hindernis in Augenschein zu nehmen. Gut getarnt in der eintönigen beigefarbenen Landschaft, tat sich plötzlich und unstrittig ein tiefes Loch in der Straße auf. Eigentlich war es eher ein Graben, wenn man ein rund einen halben Meter tiefes und fünf Meter breites Loch als Graben akzeptieren würde. Bill starrte darauf. Wir starrten darauf. Die Geländewagen hinter uns hielten an, spuckten ihre Insassen aus und der Rest der Gruppe versammelte sich um uns und starrte ebenfalls darauf. Allmählich dämmerte es mir, dass ich nicht nur ein lästiges Erdloch betrachtete, das zufällig auf unserer Straße entstanden war: Das war die ureigene Struktur des Talbodens. Das Tal, das wir durchfahren hatten, war dicht übersät mit den Nachwirkungen der reißenden, landschaftsverändernden Wasserfluten, die aus den Bergen strömen und diese trockenen, felsigen Täler mit Leben erfüllen. Hoch oben in der jordanischen Hochebene sickert der Schnee in Rinnsalen nach unten, die zu Bächen und schließlich zu Sturzbächen werden, wenn das Wasser durch mehrere Canyons rauscht. Diese Sturzfluten reißen zwar jedes Jahr Löcher in die Straßen, aber sie sind auch der Schlüssel zum Leben in dieser harten, felsigen Landschaft.
Diese Täler werden auf Arabisch wadi genannt und bilden die Eckpfeiler eines Ökosystems, das vor Jahrtausenden für die Menschen von einzigartiger Anziehungskraft war. In den Wadis lassen sich verschiedene Umgebungen nutzen und die urzeitlichen Jordanier waren schlau genug, das zu erkennen. Sie profitierten nicht nur vom einfachen Zugang zum Wasser, sondern auch vom einfachen Zugang zu den vielen Tieren, die wegen des Wassers herkamen. Das Wasser floss von der jordanischen Hochebene in die trockenen Täler und brachte ein kurzes Aufblühen von Vegetation und Leben mit sich, von denen an diesem Januarmorgen keine Spur zu finden war. Die Ränder verschiedener Ökozonen aufzusuchen, wo verschiedene Ressourcen zu finden sind, ist eine traditionelle Jäger-und-Sammler-Strategie, bei der man sich in eine möglichst bequeme Ausgangslage mit guten Gelegenheiten begibt, wo verschiedene Arten von Ressourcen aufeinandertreffen – zum Beispiel am Ufer eines Flusses zwischen Hochland und Tiefland. Das Zusammenfließen von Wasser war tatsächlich bei vielen frühen Experimenten mit der Sesshaftwerdung ein Faktor – man könnte hier auf die Erbauer der Cahokia Mounds am Mississippi verweisen oder auf die Ausgrabungsstätte Shangshan am Jangtse. Alle Städte brauchen einen Fluss. Aber Bill wollte uns etwas anderes zeigen, etwas Neues – nun ja, etwas Jahrtausendealtes, aber zu seiner Zeit eine Revolution.
Zuerst aber brauchten wir Spitzhacken. Die Hälfte der gestandenen Akademiker hackte auf das spontane Hindernis ein, die andere gab aus der Ferne Ratschläge, wie am besten zu hacken sei. So beseitigten wir die erste Hürde in weniger als 30 Minuten; die nachfolgenden Auswaschungen ließen sich mit den leidgeprüften Geländewagen überwinden. Es gelang uns, etwa die Hälfte des Talbodens zu überqueren, bevor wir an einem neu errichteten Beduinendorf angelangten, in dem staubige rosafarbene und gelbe Häuser fein säuberlich in Reihen standen. Hier lauerten uns Kollegen und Freunde von Bill auf und ich lernte, dass das, was ich als Kaffee kenne, nichts mit richtigem Kaffee zu tun hat – jedenfalls so, wie die Beduinen ihn zubereiten. Beduinenkaffee ist eine dünne grünliche Flüssigkeit, kochend heiß serviert und mit einem einzigen raschen, die Kehle verbrühenden Schluck aus einer winzigen Tasse von der Größe eines Fingerhuts getrunken, die man anschließend an den Nächsten weitergibt. Das Aroma ist jedoch gewaltig – der Kaffee selbst wird aus frischen statt aus getrockneten Bohnen hergestellt und wie alles andere in der jordanischen Küche enthält er Kardamom als berauschendes, scharfes Extra. Es liegt eine Kunst darin, etwas so Heißes zu trinken, und ich bin mir nicht sicher, ob ich es mit ausreichend Anmut hinbekam, aber wenigstens kamen wir durch das Tal und hinauf ins Vorgebirge selbst, ohne jemanden tödlich zu beleidigen.
Nachdem wir den relativ menschenfreundlichen Talboden mit seinen niedlichen Kamelbabys und den versprengten Flecken Vegetation, die zwischen den grauen Felsen auftauchten, verlassen hatten, fuhren wir den Wadi Faynan hinauf, die Heimat der beduinischen Kaffeedealer.* Schließlich gelang es uns, mehrere wasserfreie Flussbetten zu durchqueren und zur wichtigen frühen Ausgrabungsstätte Wadi Faynan 16 zu gelangen, die leicht erhöht über dem Hauptcanyon liegt. Dies war eins der frühen experimentellen Dörfer, elf Jahrtausende alt, und es lässt sich kaum beschreiben, wie öde und trostlos diese einsame Hügelkuppe über dem Wadi Mitte Januar erschien. Der Boden ist von einer Art einheitlichem Grau und die einzige Farbe stammt von den Mineralien in den Wadiwänden, die zu den versprengten Pflanzeninseln am Pfad der Frühlingsfluten auf dem Talboden abfallen. Aber hier haben wir gute Belege für ein ganzjähriges Bewohnen der kleinen runden Häuser, die zur Hälfte in die Erde gegraben und mit Schlammziegeln verstärkt sind. Das Archäologieprojekt Wadi Faynan 16 hat eins dieser uralten Häuser rekonstruiert und wir konnten alle einen in die Erde gehauenen schmalen Hohlweg hinunterkriechen, der 1,5 Meter abwärts in einen runden Innenraum mit kalten Schlammziegelwänden und einer niedrigen Strohdecke führte. Es passten nicht viele Menschen auf einmal hinein (jemand mit einer großen Armspanne hätte wahrscheinlich die gegenüberliegenden Wände gleichzeitig berühren können) und mit einem Herdfeuer wäre es aus gesundheitlicher und sicherheitstechnischer Sicht ein Albtraum gewesen. Das ist einer der Vorteile der experimentellen Archäologie: Man kann auf offensichtliche Schwachpunkte in unserer Vorstellung hinweisen, indem man sie wortwörtlich ausräuchert.* Derzeit wird die Stätte offenbar so interpretiert, dass Feuer, Kochen, Getreidemahlen usw. draußen stattfanden; die großen Mahlsteine zum Zerquetschen von Feigen, Pistazien und Weizen zu etwas Essbarem sind außerhalb dieser kleinen Unterschlupfe zu finden. Offenbar sah dieses frühe Experiment mit der Sesshaftwerdung nicht viel anders aus als die saisonalen Niederlassungen, die bereits in dieser Gegend entdeckt worden waren und in denen viele gemeinsame Aktivitäten in einer gemeinsamen offenen Umgebung stattfanden. Der aufregende Unterschied am Wadi Faynan 16 besteht darin, dass dieser gemeinsame soziale Raum in kleinere „Haus“-Einheiten aufgebrochen wurde, die nicht nur eine Nacht oder eine Saison ihrem Zweck dienten, sondern offenbar ganzjährig bewohnt waren.
Während die Geländewagen herunterschalteten und wir unseren langsamen, stetigen Aufstieg an der Wadiwand begannen, hatte ich viel Zeit, über die Menschen nachzudenken, die vor Jahrtausenden in diesem herrlichen, aber rauen Land gelebt hatten. Über lange Zeiträume der menschlichen Vergangenheit war diese Gegend spärlich von recht mobilen Jäger-und-Sammler-Gruppen bewohnt gewesen. Vor etwa 12.000 Jahren begannen in der Levante, die das fruchtbare Binnenland des östlichen Mittelmeers umfasst, die ersten archäologischen Belege für längerfristige menschliche Ansiedlungsmuster aufzutauchen. Die Natufien-Kultur der Region schien sich etwas dauerhafter in der Landschaft niederzulassen und baute Unterkünfte mit Trockensteinmauern in und um Höhlensysteme, begrub ihre Toten auf erkennbaren Friedhöfen und stellte die urzeitliche Entsprechung großer, unbeweglicher weißer Ware auf: Mahlsteine und Lagergruben. Rund 3000 Jahre vor Entstehung der Landwirtschaft nahmen ihre Saisonlager allmählich ein dauerhafteres Aussehen an und selbst mit den winzigen Knochen von Hausmäusen wurde versucht, eine längerfristige Siedlungsstrategie zu belegen.
Nach ein bis zwei Jahrtausenden jedoch begann die Welt, in der diese Gruppen lebten, sich um sie herum zu verändern, als das Klima langsam den tausendjährigen Bann eines weltweiten Kälterückfalls löste, der als Jüngere Dryaszeit bekannt ist. Die Vegetation veränderte sich, die Tiere veränderten sich und die Ressourcen, von denen das menschliche Leben abhing, veränderten sich über die Landschaft hinweg. Die kulturellen Marker des Natufien tauchen wieder im Zusammenhang mit weniger dauerhaft aussehenden Siedlungen auf und die frühe Periode der Sesshaftwerdung scheint sich als gescheitertes Experiment in Luft aufzulösen. Es herrscht keine Einigkeit darüber, wie sehr diese Klimaverschiebung das menschliche Verhalten tatsächlich beeinflusste oder wie sesshaft die frühen Natufier wirklich waren, doch es gibt recht eindeutige archäologische Hinweise darauf, dass es echte Veränderungen in der Lebensführung der Menschen gab, als das Klima wechselte.
Nach vielen Jahrtausenden intensiver Jäger-und-Sammler-Aktivitäten scheint die Zunahme des Regens mit der Leerung des Gebiets um Wadi Faynan im Präkeramischen Neolithikum A zusammenzufallen. Erst im Präkeramischen Neolithikum B vor rund 10 500 bis 9 500 Jahren, einer trockeneren Periode, werden die dünnen Narben vorübergehender Saisonsiedlungen, die das Wadi übersäen, durch die tieferen Fußspuren fester Gebäude ersetzt. Sie sind das ganze Jahr über bewohnt, wie wir an den Materialien und der Mühe erkennen können, die man sich mit ihrem Bau gab, und ebenso an den kleinen Funden. Es gibt eine Menge Feuerstellen mit einer Menge anhand der Radiokarbonmethode datierbarer Kohle sowie eine Fülle von Tierknochen, Steinwerkzeugen und sogar winzigen Mikroartefakten wie den Pollensporen längst eingegangener Pflanzen. All dies erzählt die Geschichte eines ganzjährig sesshaften Volkes. Wenn wir uns die Knochen der Tiere ansehen, die sie töteten, und die Überreste der Nahrung, die sie aßen, wird deutlich, dass die frisch sesshaften Gruppen sich zum Überleben immer noch auf Jäger-und-Sammler-Strategien verließen. Mithilfe spezieller Analysen lässt sich bestimmen, ob die Form eines winzigen Stückchens Pflanzenrest von einer wilden oder einer domestizierten Varietät stammt, und dasselbe gilt für Tiere – mehr dazu in späteren Kapiteln. Die letzte Veränderung von der mittelsteinzeitlichen Welt mobiler Gruppen mit großem Aktionsradius zur stationären Jungsteinzeit lässt sich an den Menschen selbst festmachen – oder vielmehr an ihren Zahlen: Die Siedlungen umfassen nicht mehr die einige Dutzend Menschen, die wir von den heutigen Jägern und Sammlern kennen, sondern Hunderte, möglicherweise Tausende. Aber was ritt all diese Leute, an einem Ort hocken zu bleiben und nicht mehr durch die Landschaft zu streifen? Und wo kamen sie alle her?
Ein erstes Verständnis dieses frühen Experiments des „Daheimbleibens“ ergibt sich aus der Betrachtung, was es in körperlicher Hinsicht bedeutete, ein Jäger und Sammler zu sein. Nehmen Sie alles, was Sie in der Boulevardpresse jemals über „Paläo“-Ernährung, -Workouts und -Lifestyles gehört oder gelesen haben, und vergessen Sie es. Gründlich. Was wir über das Leben in der Altsteinzeit wissen, muss mühsam aus seltenen, empfindlichen archäologischen Funden rekonstruiert werden – den winzigen Fragmenten von Vogelknochen zum Beispiel, die erst kürzlich ans Licht kamen und zeigen, dass Tauben ein (eher unerwarteter) Bestandteil der Neandertaler-Ernährung auf Gibraltar waren. Oder den chemischen Belegen für verschiedene Arten von Isotopen, die sich je nachdem, was man isst, unterschiedlich schnell in Knochen und Zähnen ablagern. Wir können ein wunderbares Bild verschiedener Anteile von fleischlicher und pflanzlicher Nahrung auf dem Speiseplan entwerfen, das genau so lange Bestand hat, bis eine Studie von der benachbarten Ausgrabungsstätte darauf hinweist, dass das eigene Signal offenbar von einer Gras fressenden Kuh stammt, die gerade einen gierigen Fleisch fressenden Löwen verdaut hatte.* Aber wenn wir Veränderungen im menschlichen Verhalten wirklich verstehen wollen, müssen wir uns die Menschen selbst ansehen: die Belege für individuelle Leben und das Überleben in der Gruppe … oder das Scheitern. Wie also sah das Leben eines Jägers und Sammlers in den kargen Wadis und Hochebenen von Jordanien aus?
Nun, zum einen war es wahrscheinlich länger. Von Anfang an scheint das Sesshaftwerden in Weilern und Dörfern die Lebenserwartung verkürzt zu haben. Es kann unendlich schwierig sein herauszubekommen, wie lange Menschen in der Vergangenheit lebten, denn die einzigen Belege, die wir haben, sind … tote Menschen. Das ist das fundamentale Problem der akademischen Disziplin, die Paläodemografie genannt wird. Wir können keine ordentlichen Aufzeichnungen über Volkszählungen heranziehen, um festzustellen, wie viele Menschen geboren wurden oder starben oder wie alt sie in einem gegebenen Erhebungsjahr waren. Wir können nur die Daten aus den Gruppen von Skeletten extrapolieren, die in verschiedenen Teilen der Landschaft zufällig die Zeiten überdauert haben, und ich glaube, wir sind uns einig, dass eine Population von Skeletten wahrscheinlich nicht die Norm repräsentiert.* In einer normalen lebendigen Population sehen wir eine Art Glockenkurve (Abb. 1), wenn wir die gesamte Population nach dem Alter von Geburt bis Tod verteilen. An den Enden gehen die Zahlen jedoch gegen null, weil die Menschen entweder dem Säuglingsalter entwachsen oder aus der ältesten Altersklasse wegsterben. Man würde zu einem beliebigen Zeitpunkt nicht mehr Babys erwarten, als es Frauen im gebärfähigen Alter gibt, und was uns tötet, betrifft meist ältere Menschen (z.B. Krebs oder Herzerkrankungen). Manchmal verschiebt sich die Glockenkurve in Richtung Jung oder Alt, was darauf hindeutet, dass es einen Babyboom gegeben hat (dann verschiebt sich die Kurve nach links) oder ein Babyboom der Vergangenheit bewegt sich gen Ende seiner Lebensspanne (die Kurve verschiebt sich nach rechts).
Eine paläodemografische Kurve jedoch ist das genaue Gegenteil. Sie ist U-förmig mit Spitzen an den äußersten Enden der Altersextrema. Bedeutet das, die Vergangenheit war von Neugeborenen und Alten bevölkert? Nein, natürlich nicht. Es bedeutet, dass Neugeborene und Alte diejenigen sind, die sterben. Vor dem Aufkommen der modernen Medizin starb ein großer Prozentsatz der Kinder in den ersten vier Lebensjahren. Die Weltgesundheitsorganisation gibt die Sterblichkeitsrate für Säuglinge unter einem Jahr in manchen Teilen der Welt noch heute mit fast 1:100 an. Abgesehen von Geburtskomplikationen wie Sauerstoffmangel, Tod der Mutter oder Infektionen gibt es eine Fülle von Erkrankungen im Kindesalter, insbesondere Durchfallerkrankungen, die in Kombination mit Unterernährung oder Ressourcenmangel noch immer zu einer deprimierend hohen Zahl von Todesfällen im Kindesalter führen.
Abb. 1: Demografische Kurven, idealisiert für eine lebende (links) und eine tote Population (rechts).
Dies bringt uns zum Konzept des Sterblichkeitsrisikos. Bei der Geburt ist das Sterblichkeitsrisiko sehr hoch, weil Neugeborene an vielen Dingen sterben können. Nach den ersten zwei Wochen sinkt es etwas, noch mehr ungefähr nach dem ersten Lebensjahr, und erreicht etwa um den vierten Geburtstag ein Plateau – das zumindest können wir aus einem Mischmasch an Erhebungsdaten, Studien und natürlich archäologischen Daten schätzen. Das Sterblichkeitsrisiko steigt in bestimmten Lebensabschnitten erneut an, zum Beispiel besteht für Männer im wehrfähigen Alter in einer Gruppe mit vielen Kampfhandlungen oder für eine Frau im gebärfähigen Alter in einer Zeit vor den Antiseptika und Antibiotika ein deutlich höheres Risiko zu sterben als für einen Teenager, trotz allem, was die Eltern der meisten Teenager glauben mögen. Nach diesem letzten Höchstwert des Sterblichkeitsrisikos jedoch bleibt es wieder eine Weile konstant, bis die Kurve dann sanft ansteigt und schließlich ausläuft. Was Archäologen ausgraben, ist die U-förmige Verteilung toter Menschen, die nicht die Gesamtzahl der Menschen beschreibt, die zu einem gegebenen Zeitpunkt am Leben waren, sondern eher das Sterblichkeitsrisiko abbildet. Der Trick besteht also darin, von der Anzahl der Säuglinge und Alten zurückzurechnen bis zu einer vernünftigen Annäherung an die lebende Population. Das ist nicht annähernd so einfach, wie es sich anhört, und für die meisten hört es sich ohnehin schon viel zu statistisch an.
Wenn man überlegt, wie beispielsweise ein Kirchfriedhof belegt wird, erkennt man das Problem sofort. In vielen christlichen Traditionen wurden Kinder, die vor der Taufe starben, nicht auf dem Hauptfriedhof beigesetzt – Archäologen bekommen sie vielleicht niemals zu Gesicht. Können wir also annehmen, dass in der gesamten Kirchengeschichte keine Babys geboren wurden? Auch hier: Nein, natürlich nicht. Stattdessen könnten wir uns dem Alter der Menschen zuwenden, deren Überreste wir tatsächlich haben. Wenn das durchschnittliche Bestattungsalter niedrig war, könnten wir annehmen, dass auch die Lebenserwartung niedrig lag – und hoffen, dass niemand die Leichen all der alten Menschen versteckt hat (wenn sie alle Babys verstecken können, ist es dann wirklich so absurd zu fragen, ob sie auch die Alten versteckt haben?). Eine niedrige Lebenserwartung deutet auf ein hohes Sterblichkeitsrisiko hin, sonst hätten mehr Menschen ein hohes Alter erreicht. Archäologen, die die Skelette von Jägern und Sammlern und von sesshafteren Gruppen untersuchten, die ihnen folgten (oder sich vielmehr weigerten, ihnen zu folgen, und sich an einem schönen Ort niederließen), fahndeten nach einem Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Sterbealter bei den Jägern und Sammlern und sesshaften Gruppen. In einigen dieser Gruppen lag das mittlere Sterbealter offenbar niedriger als bei ihren nicht sesshaften Vorfahren in derselben Region – das führte Forscher zu der Annahme, dass sesshafte Menschen typischerweise ein höheres Sterberisiko haben als ihre freilaufenden Vorfahren. Das Gegenargument lautet, dass es in sesshaften Gruppen mehr Babybooms gab (im Durchschnitt waren also alle jünger), weshalb sie einen größeren Haufen jüngerer Skelette hinterließen. Der Trend zum Sesshaftwerden setzte sich aus archäologischer Sicht relativ schnell durch und folgte direkt auf mehrere Hunderttausend Jahre entschlossenen Umherwanderns unserer Hominini-Vorfahren. Lag das alles an der Geburt einer gewaltigen Kohorte begeisterter Verfechter eines festen Wohnsitzes?
Der Paläodemograf Jean-Pierre Bocquet-Appel und Kollegen haben die Altersprofile von Skeletten aus Ausgrabungsstätten in aller Welt untersucht, und zwar jeweils aus den Zeitabschnitten, in denen in der jeweiligen Region die Menschen dieselben Stätten ganzjährig zu bewohnen begannen. Sie kamen zu dem Schluss, dass der höhere Anteil an unreifen Skeletten sich daraus erklären muss, dass mehr Kinder geboren wurden (und damit auch für mehr Kinder ein Sterberisiko bestand). Die Funde von den Friedhöfen zeigen auch einen allgemeineren Bevölkerungszuwachs, der zusammen mit der Anzahl subadulter Skelette darauf hindeutet, dass der massive Anstieg der Weltbevölkerung, der während des Übergangs in die sesshaftere Jungsteinzeit zu beobachten ist, eigentlich das Ergebnis einer gestiegenen Fruchtbarkeit der Frauen ist. Diese wiederum wird als Folge eines besseren Gleichgewichts der mütterlichen Energetik – die Kosten des Austragens und Ernährens eines Säuglings im Verhältnis zum eigenen Kalorienbedarf der Mutter – bei sesshaften Frauen betrachtet.
Ein Baby zu bekommen, ist ein sehr teures Unterfangen; diese abgedroschene Einstellung hat sich vermutlich wenig verändert, seit unsere Vorfahren die Fähigkeit entwickelten, über ihre Existenz nachzudenken, und setzte schon weit vor Aufkommen von Währungen und dem Wettrüsten mit teuren Babyprodukten ein. Die biologischen Kosten sind natürlich für die Mutter am höchsten, da sie Nährstoffe und Energie für das Baby im Mutterleib und nach der Geburt bereitstellen muss. In Situationen, in denen die Mutter selbst keinen Zugang zu unbegrenzten kalorischen Ressourcen hat*, muss sie einen sehr heiklen Balanceakt zwischen Fortpflanzung und Überleben ausführen.
Wir Primaten sind viel länger trächtig bzw. schwanger als andere Säugetiere mit ähnlich großen Säuglingen: Bei uns dauert es zwei- bis viermal so lange wie es das für Säugetiere normale Verhältnis zwischen Gestationszeit und Körpergröße vorhersagt. Natürlich bekommen wir dafür Einlinge oder nur sehr vereinzelt wenige Mehrlinge, die mit offenen Augen und Ohren geboren werden, ganz anders als zum Beispiel Katzenmütter. Die Entwicklungsrate des Fötus ist langsamer, was bedeutet, dass wir ihm eigentlich weniger Energie zur Verfügung stellen müssen. Das könnte eine sehr nützliche Überlebensstrategie bei Arten mit fluktuierenden Nahrungsressourcen gewesen sein. Menschen lassen allerdings auf diese langsame Weise noch größere Babys heranwachsen als die meisten unserer nächsten Primatenverwandten: Ein Gorillababy wiegt etwa 2 Prozent des Körpergewichts seiner Mutter, ein Menschenbaby ganze 6 Prozent. Schimpansenbabys wiegen ebenfalls rund 6 Prozent so viel wie ihre Mütter, aber interessanterweise haben Menschenbabys etwa 15 Prozent Körperfett, andere Primaten dagegen um die 4 Prozent. Unsere dicken Babys sind auch recht teuer im Wachstum – es kostet geschätzte 77 500 Kalorien (etwa 240 Kalorien pro Tag in einer heutigen Stichprobe aus England), ein Baby ganz auszutragen. Manche Forscher haben argumentiert, dass dies direkt damit zusammenhängt, dass Menschenfrauen selbst relativ dick sind*, aber es ist sehr schwer zu ermitteln, wie viel unserer Fettspeicher wir Übergewicht fördernder Ernährung verdanken und wie viel unserer Entwicklungsgeschichte; Primaten in Gefangenschaft entwickeln ebenfalls beträchtliche Fettreserven. Die Babys nach der Geburt zu füttern, ist ein weiteres kostspieliges Unterfangen – die Energiekosten des Stillens betragen rund 500 Kilokalorien pro Tag, die Menschenmütter durch eine höhere Energieaufnahme, weniger körperliche Bewegung oder eine Kombination von beidem auffangen.
Bocquet-Appel stellte die Theorie auf, dass gerade die Sesshaftwerdung es dem Menschen erlaubte, das energetische Gleichgewicht zugunsten von mehr Babys zu verschieben. Bei Primaten mit weniger Fettspeichern dauert es bei den Unterernährten länger, bis sie wieder fruchtbar sind, und beim Menschen kann Mangelernährung zu Amenorrhö† und vorübergehender Unfruchtbarkeit führen. Das Sesshaftwerden muss nach seiner Rechnung mit einem energetischen Nettogewinn für die Mütter zusammenfallen. Diese Annahme wurde in der anthropologischen Literatur in gewissem Maße untermauert: In einigen ethnografischen Beispielen findet sich bei mobilen Gruppen eine deutliche Tendenz zu einem größeren Altersunterschied zwischen den Kindern. Die Aché in Paraguay etwa waren bis in die 1970er-Jahre hochmobile Wildbeuter. Im Laufe eines Jahrzehnts wurden sie allmählich sesshaft gemacht, unternahmen jedoch immer noch häufig Nahrungsstreifzüge. Frauen mit Säuglingen widmeten einen gewaltigen Teil ihrer Energie ihren Nachkommen; sie verbrachten etwa 90 Prozent der Nahrungssuche in direktem Hautkontakt mit ihren Kindern und duldeten nie mehr als einen Meter Entfernung von ihnen. Wenn die Aché dagegen in ihrem festen Zuhause waren (einer Mission), streiften die Kinder frei umher und wurden oft von anderen Mitgliedern der Gemeinschaft oder von Geschwistern überwacht. Die Zeit zwischen den Geburten aufeinanderfolgender Kinder bei den Aché schrumpfte nach der Sesshaftwerdung von 3,2 auf 2,5 Jahre.
Die Theorie der Neolithischen Revolution wurzelt in Beobachtungen der Anthropologen Lewis Binford und W. J. Chasko an Inuit-Gemeinschaften, die in den 1970er-Jahren von einem mobilen zu einem sesshaften Lebensstil übergingen. Sie fanden heraus, dass der nachfolgende Babyboom der Verfügbarkeit neuer Nahrungsmittel und veränderten Anforderungen an den mütterlichen Energiehaushalt zugeschrieben werden konnte. Auf der ganzen Welt ist in mobilen Gruppen der Altersabstand zwischen den Kindern mit durchschnittlich rund vier Jahren größer als in sesshaften Gruppen. In der Regel werden die Kinder bis zur nächsten Schwangerschaft der Mutter gestillt und damit erst nach mindestens 2,5 Jahren entwöhnt. Das variiert jedoch stark und der Unterschied zwischen heutigen Bauern und Jägern und Sammlern ist in der Tat nicht statistisch relevant.
Klar ist jedoch, dass die menschlichen Populationen im Vorfeld der Jungsteinzeit irgendwie zu wachsen begannen. Belege für steigende Bevölkerungszahlen in Form von mehr Toten und zunehmender Siedlungsgröße wurden in Südamerika, China und dem Nahen Osten für die Zeit gefunden, als sich in den jeweiligen Gebieten der sesshafte Lebensstil durchsetzte. Viele Autoren argumentieren, dass diese Bevölkerungsexplosion dazu beitrug, die revolutionären Konzepte der Jungsteinzeit – ein sesshaftes Leben und Landwirtschaft – an neue Orte zu bringen; der Babyboom, der sich aus der Tatsache ergab, dass die Mütter dank des sesshaften Lebens auch mal die Füße hochlegen konnten, führte dazu, dass sich die wachsende Population in angrenzende Gebiete ausbreitete. Dieses Durchsickern jungsteinzeitlicher Konzepte ist ein intensiv untersuchter (und stark umstrittener) Teilaspekt der Frage, wie das sesshafte Leben sich in den meisten Teilen der Erde durchsetzte. Auch ist die Rolle der Landwirtschaft in der ersten Welle der Sesshaftwerdung und der menschlichen Geschichte ausreichend komplex, dass sich das nächste Kapitel ausschließlich damit beschäftigt, was wir über die Vor- und Nachteile der Praxis wissen, seinen Lebensunterhalt aus dem Boden zu bestreiten. Auf jeden Fall sehen wir mit Beginn des sesshaften Lebens im Natufien, also vor rund 14.000 Jahren in der Levante, wesentlich mehr Menschen. Die Populationsgröße explodiert derart, dass die Landschaft übersät wird mit Siedlungen, mit Begräbnisorten und natürlich mit Toten. Diese Fruchtbarkeitsrevolution hatte das Potenzial, die modernen Menschen ungebremst in die demografische Stratosphäre zu katapultieren, nach Hunderttausenden von Jahren mit mehr oder weniger stabilen Zahlen. Und obwohl es definitiv eine Bevölkerungsexplosion gab, bremste tatsächlich etwas unser Wachstum und verhinderte die Bevölkerungszahlen, die sich aus der erhöhten weiblichen Fruchtbarkeit hätten vorhersagen lassen. Dieses Etwas war natürlich genau das, was seinen malthusianischen Daumen auf die menschliche Population hält, seit es uns gibt: Krankheit und Tod.
Das Aufkommen des sesshaften Lebens brachte eine Zunahme des Risikos für einen sesshaften Tod mit sich. Das Problem dabei ist natürlich, wie oben bereits erwähnt, dass es in der Regel sehr schwierig ist, aus den menschlichen Überresten in archäologischen Funden eine bestimmte Todesursache abzuleiten. Der größte Teil all dessen, was uns umbringt, hinterlässt keine Spuren am Skelett; nur chronische Erkrankungen wirken sich lange genug auf uns aus, um eine Reaktion in den Knochen hervorzurufen, die Archäologen erkennen können. Grippe, Masern, Pest, Typhus, Cholera oder eine der schrecklichen pandemischen Krankheiten, die sich stark auf menschliche Populationen auswirken, sind über die Knochen allein größtenteils nicht aufzuspüren (obwohl wir in späteren Kapiteln noch sehen werden, wie man ihnen doch auf die Schliche kommen kann). Herzinfarkte, Ertrinken, Vergiftungen und sogar gewaltsame Tode hinterlassen vielleicht gar keine Spuren. Wenn wir also verstehen wollen, was die Fruchtbarkeitsexplosion in der Jungsteinzeit begrenzte, müssen wir hochrechnen, wie groß das allgemeine Sterberisiko war.
Es gibt Möglichkeiten, auf solche Informationen über das Sterberisiko zuzugreifen, die in den Knochen und Zähnen der Menschen aus frühen sesshaften Gemeinschaften eingebettet sind. So bergen Form, Größe und Links-rechts-Gleichgewicht Ihres Skeletts eine Fülle von Indikatoren über Ihre Gesundheit, die sich durch eine bioarchäologische Untersuchung herauskitzeln lassen. Diese körperlichen Anzeichen können uns verraten, wann bestimmte Umstände die normale Gesundheit oder das normale Wachstum beeinträchtigten. In diesem Buch wird immer wieder von ihnen die Rede sein, weil dies unsere einzige Möglichkeit ist, das Schweigen der Urgeschichte und all der Menschen zu überwinden, um die sich die Geschichte nicht weiter kümmerte, und die Realität des Lebens als biologischen Organismus zu Zeiten unserer vielen adaptiven Eskapaden wirklich einzuschätzen. Wenn wir uns also die Ränder der letzten 10.000 Jahre ansehen, um zu verstehen, ob die Sesshaftwerdung das Frühsterblichkeitsrisiko der Menschen erhöhte, müssen wir zuerst die körperlichen Veränderungen von Kopf bis Fuß betrachten.
Was ist anders am Skelett eines Jägers und Sammlers? Hier können wir an den Zehen beginnen oder zumindest bei den unteren Gliedmaßen. Das ist die Schlussfolgerung von Forschern wie Noreen von Cramon-Taubadel, die eine große Anzahl von Messdaten aus den Skeletten von Jägern und Sammlern sowie von sesshaften Gruppen an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten überall im Nahen Osten und in Europa zusammentrug. Sie untersuchte, wie die variierende Größe und Form von menschlichen Schädeln und Gliedmaßen sich verändert haben könnte, als die neue Tendenz, sesshaft zu leben und Landwirtschaft zu betreiben, sich über Europa ausbreitete, die Lebensweise der Jäger und Sammler verdrängte und Platz für neue jungsteinzeitliche Siedlungen schuf. Man würde über so viel Zeit und Raum ein wenig Diversität erwarten (es dauerte Jahrtausende, bis das ganze Paket der jungsteinzeitlichen Innovationen einschließlich der Landwirtschaft in den abgelegenen Winkeln Europas ankam), die sie und ihre Kollegen auch pflichtschuldig dokumentieren. Worüber sie jedoch auch berichten, ist die Tatsache, dass die Jäger und Sammler insgesamt kräftigere Beine hatten als Nicht-Jäger-und-Sammler. Die Beine blieben auch dann noch kräftiger, als man alles herausgerechnet hatte, von dem wir wissen, dass es über die einfache genetische Vererbung das Skelett beeinflusst, wie Klima und Breitengrad. Viele physische Anthropologen haben die Größe der Gliedmaßen oder ihre allgemeine Robustheit mit Aktivitätsmustern in Verbindung gebracht, aber zu verstehen, wie Aktivität sich auf das menschliche Skelett auswirkt, ist etwas komplizierter. Also ist es zwar verlockend, unsere immer dünneren Beine einfach der Tatsache zuzuschreiben, dass wir nicht mehr die Hunderte von Kilometern laufen, die ein Jäger und Sammler vielleicht zurücklegt, doch andere Faktoren wie die bessere Fähigkeit einiger Menschen, Muskeln anzusetzen (ganz zu schweigen davon, dass wir nicht wissen, wie sich eine über ein gesamtes Leben nicht mehr praktizierte Lebensweise in einem Skelett abzeichnen würde), verhindern eine einfache Interpretation der Daten.
Dünne Beine sind jedoch nicht der einzige interessante Hinweis auf das Leben in der Jungsteinzeit, der sich durch die Vermessung von Skeletten ergibt. Im Nahen Osten, wo unsere Geschichte beginnt (aber auch überall anders auf der Welt, als Sesshaftigkeit und Landwirtschaft sich an weiteren Orten durchsetzen), haben Forscher beobachtet, dass Menschen offenbar überall zu schrumpfen begannen, sobald sie sesshaft wurden. Bioarchäologen schätzen die Körpergröße eines Erwachsenen mithilfe einer Reihe von Formeln, die auf der Länge der langen Knochen von Personen mit bekannter Körpergröße basieren. Um die Körpergröße (oder den „Wuchs“) genau zu bestimmen, verfügt man idealerweise über mehrere Messungen von Gliedmaßenknochen, jede mit einem gewissen Fehlerbereich, um sich dann mit einer realistischen Schätzung auf der Grundlage dieser Gliedmaßenknochenlängen dem allgemeinen Wuchs anzunähern. Obwohl die Nachweislage des archäologischen Befunds frustrierend unklar sein kann, scheint sich eindeutig zu zeigen, dass mit Beginn einer jungsteinzeitlichen Lebensweise die Menschen kleiner wurden. Da dies Tausende und Abertausende von Jahren vor dem Aufkommen des Computers und dem Einnehmen der entsprechenden zusammengesunkenen Körperhaltung vor dem Bildschirm geschah, in der viele von uns heute so gerne verharren, ist es schwierig zu bestimmen, wie genau es dazu kam, dass wir schrumpften. Unterschieden sich die Populationen, die sesshaft wurden, von den Jägern und Sammlern und waren daher vielleicht genetisch für eine andere Körpergröße prädisponiert? Einfach gesagt: Ließen sich Populationen von bereits geringerer Körpergröße nieder und vermehrten sich dann einfach schneller als die hochgewachseneren Populationen in der Gegend? Untersuchungen alter DNA („aDNA“) haben gezeigt, dass viele mittelsteinzeitliche Gruppen – Jäger und Sammler, die entweder vor oder sogar parallel zu den sesshaften jungsteinzeitlichen Gruppen lebten – genetisch recht große Unterschiede aufweisen.
Es gibt jedoch noch andere Faktoren, die die erwachsene Körpergröße bestimmen. Am beeinflussendsten sind hier Mangelernährung und andere Arten von Wachstumsunterbrechungen, die während der Kindheit oder bereits im Mutterleib auftreten, und das gesamte Leben eines Individuums beeinflussen. Diese Wachstumsunterbrechungen bilden sogar eine wichtige Belegquelle für das Leben in der Vergangenheit und wir kommen in späteren Kapiteln noch einmal auf sie zurück. Aus modernen Wachstumsstudien wissen wir, dass ein gehemmtes Wachstum durch das Fehlen von Ressourcen, vor allem von Nahrung, verursacht werden kann. Einen weiteren Hinweis gibt die relative Weiblichkeit oder Männlichkeit von Skeletten, die aus der Periode direkt nach den ersten Experimenten der frühen Natufier mit dem sesshaften Leben stammen. Das Natufien unterteilt sich in zwei Abschnitte, von denen der spätere dem Klimawandel der Jüngeren Dryaszeit unterworfen war. Im späten Natufien finden sich Anzeichen dafür, dass die Populationen unter beträchtlichem Stress standen; das Experiment „Sesshaftigkeit“ wurde in den meisten Gebieten abgebrochen und die Menschen kehrten zu einer mobileren Lebensweise zurück. Mit zunehmendem Druck auf die Natufier nahm auch der Geschlechtsdimorphismus ab (der Unterschied in Körperform und -größe bei Männern und Frauen); das geschieht, wenn ein Körper im Wachstum unter so viel Druck steht, dass Ressourcen, die sonst für eine Verstärkung des Dimorphismus aufgewandt würden, eher für das drängendere Problem des Überlebens verbraucht werden. Viele dieser Skelettveränderungen lassen sich von der Art her mit Stress während der Individualentwicklung in Verbindung bringen, auf den wir in der Geschichte unserer Urbanisation immer wieder zurückkommen werden; und wenn man die Belege für schrumpfende Dorfbewohner mit den übrigen Hinweisen in den Skeletten zusammenbringt, klingt die Geschichte der Neolithischen Revolution nach einer ziemlich schwierigen Zeit.
Schwierig war es auch, das alles zu verstehen, vor allem eingezwängt auf dem Notsitz eines Toyotas, der sich über den aufreibenden Weg von der Küste des Toten Meeres etwa 1200 Meter aufwärts* zur jordanischen Hochebene quält. Nach unserer Begegnung mit den semi-unterirdischen Rundhütten von Wadi Faynan 16 fuhren wir über den Rand der jordanischen Hochebene zu einigen etwas jüngeren Stätten, wo Bill uns ein paar aufregend quadratische Behausungen versprochen hatte – eine spätere Anpassung in den frühen Tagen der Sesshaftwerdung. Als wir etwa halb oben waren, gelang es einem der Geländewagen, eine Batterie aus ihrem (im Rückblick schlecht konzipierten) Plastikgehäuse zu rütteln, sodass der ganze Konvoi mitten in der kurvenreichen, felsigen Marslandschaft des Wadis in einer Haarnadelkurve erzitternd zum Stehen kam. Die Nummer mit der VW-Käfer-Wette wiederholte sich, als die Fahrzeuge ihre akademischen Insassen ausspien, die allesamt ein starkes Interesse an der Spannungsmechanik von Motorplastikteilen bekundeten, jedoch eine peinliche Ahnungslosigkeit an den Tag legten, was man mit einer Autobatterie macht, die sich vom Auto losgesagt hat. Aber die Wadis sind nie so verlassen, wie man meint – kaum hatten die Ersten sehnsüchtig vom Mittagessen zu reden begonnen, als ein kleiner weißer Pick-up die Talwand heraufdröhnte. Der Fahrer war ein unglaublich einfallsreicher Teenager, der Sohn eines von Bills Bekannten aus dem Beduinendorf. Er sprang aus dem Pick-up (sein jüngerer Bruder blieb im Auto sitzen) und begann eine angeregte Diskussion mit den Mitgliedern unserer Truppe, die Arabisch sprachen. Das führte zu dem recht surrealen Bild, wie ein vielleicht 13-jähriger Junge einem Haufen Professoren mittleren Alters erklärte, wie man eine Batterie mit Bindfaden zusammenbindet, den unser kleiner Retter praktischerweise mit sich führte. Ein kurzes Telefonat mit seinem Vater, damit wir auf dem Gipfel des Hügels eine neue Batterie abholen konnten, und schon waren wir wieder auf dem Weg die Talwand hoch, während er rückwärts einen der Furcht einflößendsten Bergrücken hinunterfuhr, die ich je entlanggefahren bin. Gerade noch konnten wir in der gewaltigen Staubwolke, die er aufwirbelte, seinen Vater erkennen, einen winzigen Fleck in einer schwarzen galabeya, der von seinen Ziegen umringt auf dem Talboden stand, zum Gruß mit seinem Handy winkte und allem Anschein nach ein unbändiges Lachen in unsere Richtung schickte.
Bald darauf krochen wir über den Rand der Hochebene und landeten in dem einsamen und erbärmlichen halb verlassenen Abschnitt mit Touristenfallen-Restaurants vor dem Eingang nach Petra.* Gläser mit kalter Limonade mit zerpflückter Minze (ein aussichtsreicher Bewerber um den Titel des weltbesten nicht alkoholischen Getränks) wurden herumgereicht und die Gruppe aß sich durch Falafel, Pizza und andere traditionelle Speisen, während wir darauf warteten, dass die Batterie ersetzt wurde. Der Ort war ungezwungen genug für eine Diskussion um die großen Fragen, über die ich während der Reise nachgedacht hatte. Also verbrachte ich die ansonsten angenehme Mahlzeit damit, von der versammelten Expertenrunde Antworten auf der Grundlage der Myriaden von Ausgrabungsstätten einzufordern, an denen sie gearbeitet hatten. Wenn wir gerade die frühen Experimente mit dem sesshaften Leben gesehen hatten – und so viele bioarchäologische Belege darauf hindeuteten, dass die Sesshaftwerdung in gesundheitlicher Hinsicht gar nicht so toll war – also … wie passte das dann alles zusammen?
Für mich lautet die Antwort, zurückzugehen und uns die Ressourcen anzusehen. Wie verwalteten sesshafte Gemeinschaften ihre Ressourcen und welche Auswirkung hatte die große neue Ressource der angebauten Nahrung auf ihre Art, das zu tun? Und was war mit Haustieren – Mahlzeit auf Hufen, sozusagen?* Für Bioarchäologen geht es letztendlich immer um die Biologie und Menschen als biologische Organismen, die entweder gut essen oder nicht, gut wachsen oder nicht, aber in jedem Fall verräterische Spuren in ihren Knochen und Zähnen hinterlassen, die ich Jahrtausende später finden kann. Selbst von dieser Expertengruppe, die insgesamt wahrscheinlich mehr Belege zur frühen Jungsteinzeit ausgegraben hat als jede andere Gruppierung lebender Menschen, bekam ich keine einfachen Antworten. Was trieb den Erfolg sesshafter Gruppen an? Wie erfolgreich waren sie wirklich, wenn sie kleiner wurden und kürzer lebten? Wir wissen nur, dass die Antwort komplexer ist, als einfach die Toten zu zählen und zu vermessen. Wir müssen tiefer in diese jungsteinzeitlichen Leben (und Tode) eindringen, um den ziemlich radikalen Trend zu verstehen, sich nicht mehr vom Fleck zu rühren.
* Güneş Duru ist außerdem noch Leadgitarrist der türkischen Rockband Redd, was darauf hindeutet, dass entweder die Archäologie oder die Rockmusik in der Türkei unterbezahlt ist.
* Mir wurde irgendwann klar, dass es nur sehr wenige Jordanier gibt, die es sich offenbar nicht zur Lebensaufgabe gemacht haben, Besuchern den Kaffeegenuss nahezubringen, bis hin zum gelangweilten Militär in der Mitternachtsschicht auf der Wüstenstraße. Danke, Jungs!
* Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass dieses Experiment tatsächlich stattgefunden hat. Archäologen kamen dabei nicht (dauerhaft) zu Schaden.
* Das soll ein scherzhafter Kommentar sein. Nicht zu verwechseln mit den Belegen aus echten Fäkalien, die tatsächlich unglaublich nützlich bei der Rekonstruktion von Ernährungsweisen sind.
* Das ist bei Weitem der bestmögliche Witz, der sich in der Paläodemografie reißen lässt, und ich habe ihn von Professor Tony Waldron vom University College London geklaut. Tut mir leid.
* Siehe zum Beispiel die Nährwertangaben von Ben & Jerry’s Chunky Monkey.
* Menschenfrauen haben offenbar einen höheren Körperfettanteil als jedes andere Säugetier, mit Ausnahme des Dsungarischen Zwerghamsters.
† Unterbrechung des Menstruationszyklus.
* Ja, das Tote Meer liegt unter dem Meeresspiegel, nämlich 420 m unter Normalhöhennull. Das ist nur eins der vielen Dinge, die mit diesem besonderen Gewässer nicht stimmen.
* Die Lage in Syrien hatte sich schon ziemlich zugespitzt und der Tourismus war im Prinzip zum Erliegen gekommen; außerdem war es Januar und es schneite an manchen Orten, aber das ist eine ganz andere Katastrophengeschichte über das Autofahren.
* Viele hatten köfte (Fleischbällchen) bestellt, da lag die Frage nahe.