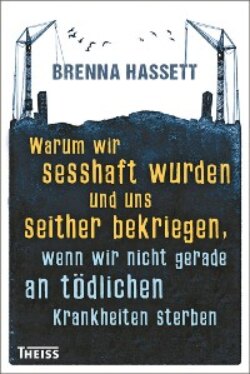Читать книгу Warum wir sesshaft wurden und uns seither bekriegen - Brenna Hassett - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2
Feed Me (Seymour)
ОглавлениеWir haben großes Glück, in einer Zeit zu leben, in der wir dank der Massenmedien die wissenschaftlichen Durchbrüche publik machen und den Menschen ein besseres Verständnis der zugrunde liegenden Funktionsweisen unseres Universums und unserer Spezies ermöglichen können. Einen leichten Nachteil jedoch verschafft uns unsere begrenzte Aufmerksamkeitsspanne, die sich offenbar nichts sehnlicher wünscht, als die Summe allen menschlichen Wissens zu einem Listicle über Dinge zu verarbeiten, die Krebs verursachen/heilen*, oder, noch wichtiger, die uns dick/dünn machen. Letztere Besessenheit vom Abnehmen bis zu einem „Idealgewicht“ ist eine außergewöhnliche Situation für unsere Spezies, wenn man bedenkt, dass wir uns die ersten 250.000 Jahre unserer Existenz (und unsere Vorfahren sich davor ad infinitum) überwiegend energisch darum bemüht haben, nicht zu verhungern. Erst in den letzten ein bis zwei Jahrhunderten wurde Fettleibigkeit zum Mainstream in der westlichen, sitzenden Lebensweise; vorher war sie weltweit den Eliten vorbehalten, die über die meisten Ressourcen (und das meiste Essen) verfügen konnten, und war deshalb in der Vergangenheit nie ein echtes Problem. Heute sieht das ganz anders aus, da billige Kalorien an immer mehr Orten zur Verfügung stehen und unsere Taillenumfänge weltweit zunehmen. Die Adipositas-Epidemie wird auf hundert verschiedene Ursachen zurückgeführt, in Abhängigkeit von einer Geheimformel, die nur Nachrichtenredakteuren bekannt ist, und jede neue wissenschaftliche Entdeckung wird in den Medien als definitiver Beweis dafür angekündigt, dass etwas Bestimmtes (ein Nahrungsmittel, das Internet, alles, was Spaß macht) ganz allein verantwortlich für die Form der Delle in Ihrem Bürostuhl ist.
Angesichts der hektischen Aufregung, die jedes Mal hochkocht, wenn ein vermeintliches Heilmittel oder eine angebliche Ursache für eine der teuersten Epidemien in der modernen Menschheitsgeschichte auftaucht, überrascht es nicht, dass Lösungen für unsere Fettleibigkeitskrise mit einem gewissen Flair von „zurück zu den Anfängen“ im Aufschwung sind. Menschen sind Meister der Analogien und verknüpfen sehr gern marginale, leicht verständliche Narrative mit komplexeren, abstrakteren Phänomenen ohne Rücksicht auf die Einzelheiten. Eine der überstrapaziertesten unter diesen logischen Abkürzungen ist die Verknüpfung von „xy war früher besser“ mit „wir müssen alles so machen, wie wir es früher gemacht haben“.* Fettleibigkeit ist ein sehr reales Problem und der Wunsch, etwas dagegen zu unternehmen, vor allem auf persönlicher Ebene, ist leicht verständlich. Es überrascht also kaum, dass in den letzten Jahren zunehmend Stimmen laut werden, die sich für eine „Rückkehr“ zu der Ernährung einer Zeit aussprechen, in der wir noch nicht alle nur einen Muffin mit Schinkengeschmack vom Typ-2-Diabetes entfernt waren. Bühne frei für die Paleo Diet™ und ihre vielen Zweige, Nachahmungen und Abwandlungen. In der Regel plädieren sie alle für eine Rückkehr zu dem angeblich „reinen“ Gesundheitszustand der Jäger und Sammler durch die Einführung einer vermeintlich authentischen Jäger-und-Sammler-Ernährung.†
Während ich das hier schreibe, nutze ich die Massenmedien, um mir online die Verpackung von etwas anzusehen, das sich PaleoDiet Bar nennt, also „Paläo-Riegel“. Er verspricht mir die optimale Ernährung für die Jäger-und-Sammler-Lebensweise. Er ist glutenfrei, getreidefrei, sojafrei, milchfrei, ohne Konservierungsstoffe und enthält viele Ballaststoffe und Proteine. Freude ist als Zutat nicht aufgelistet, aber ich glaube, man kann ihre Abwesenheit aus dieser Litanei durchaus ableiten. Ich komme nicht an ein echtes Exemplar eines solchen Riegels heran, weil ich dieses Kapitel inmitten eines neu aufgeflammten Guerillakriegs im Südosten der Türkei schreibe, und neben den Straßensperren, den Schießereien und der Hitze scheint es außerdem so nahe an der Grenze auch keine Läden für Nahrungsergänzungsmittel oder Reformkost zu geben. Es bleibt jedoch die Frage: Warum existiert dieses Produkt? Warum gibt es einen abgepackten, in Plastik gewickelten, massenproduzierten Snack, der von „dem weltweit führenden Experten und Begründer der Paläo-Bewegung“* empfohlen wird?
Abgesehen von der unendlichen Unwahrscheinlichkeit, dass ein heute lebender Mensch die Steinzeit „begründet“ haben könnte – als ich das letzte Mal nachsah, war das noch 3 Millionen Jahre her –, ist es ein bisschen unfair, auf diesem einen Beispiel dafür herumzureiten, was ich im Folgenden als die Verleugnung der Jungsteinzeit bezeichnen möchte. Die „Paläo“-Bewegung hat in der Tat viele Anhänger und ihr Ausgangspunkt ist der, dass die Entstehung der Landwirtschaft ein langfristiger, verheerender Fehler für unsere Spezies war. Das Schlüsselargument besagt, dass wir für den Verzehr von kultivierten Nahrungsmitteln (allen, die in gewissem Ausmaß menschlicher Interaktion bedürfen, um in der gewünschten Anzahl oder den gewünschten Mengen zu wachsen) aus Evolutionssicht nicht geschaffen sind. Unsere Körper können die Kulturarten, die wir gezüchtet haben – Weizen, Reis, Hülsenfrüchte –, nicht verdauen und viele unserer heutigen Gesundheitsprobleme sind auf die Giftigkeit unserer glutenbasierten Ernährung zurückzuführen. Das Bewusstsein für Glutensensitivität oder Glutenunverträglichkeit hat in der westlichen wohlhabenden Welt in den letzten Jahren explosionsartig zugenommen, was zu einem nachvollziehbaren Interesse an solchen Thesen führte. Die einzige Möglichkeit, unsere unerklärlichen ständigen Gesundheitskrisen† in den Griff zu bekommen, besteht in der Rückkehr zu einer Ernährung, für die unsere Evolutionsgeschichte uns vorbereitet hat. Den Experten für Paläo-Ernährung zufolge besteht sie aus Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst und sonst nicht viel. Aber stimmt das? Und wenn ja, was haben Jäger und Sammler wirklich gegessen? Hat die Erfindung der Landwirtschaft uns tatsächlich alle krank gemacht?
Das Studium der menschlichen Gesundheit und menschlicher Ernährungsweisen gehört zu den Lieblingsbeschäftigungen der Bioarchäologen, mich eingeschlossen. Was wir essen und wie viel, hat einen großen Einfluss auf unsere Körper – von Wachstum und Entwicklung bis hin zu Tod und Krankheit. Auf dem langen Zeitstrahl der menschlichen Geschichte gibt es nur einige Punkte, an denen wir tatsächlich eine große Veränderung in unserer Ernährungsweise erkennen können. Die Veränderung mit der größten Auswirkung darauf, wie und wo wir unser Leben in den letzten zehn Jahrtausenden verbracht haben, war die Entstehung der Landwirtschaft, also die Domestizierung von Pflanzen und die Entwicklung all der äußerst arbeitsintensiven Praktiken, die nötig sind, um seinen Lebensunterhalt mit dem Bodenertrag zu verdienen. Über Hunderttausende von Jahren hatten die Menschen von mehr oder weniger „gefundener“ Nahrung gelebt. Natürlich brauchten sie für einige dieser Funde recht spezialisierte Fähigkeiten und Expertise und der archäologische Befund zeigt, dass sich die Menschen in der Vergangenheit je nach Ort, Umweltbedingungen und Faktoren wie Beuteverfügbarkeit recht unterschiedlich ernährt haben. Es ist einfach nicht möglich zu verkünden, es gebe die eine wahre vorlandwirtschaftliche Ernährung. Einer der größten Trümpfe unserer Spezies im Überlebenskampf ist unsere Anpassungsfähigkeit; wir sind Allesfresser und intelligent noch dazu.
Nehmen wir zum Beispiel die verschiedenen Gruppen, die ihren Lebensunterhalt mit Jagen und Sammeln in der und um die Kalahari-Wüste in Südafrika verdienen.* Sie sind bekannt für ihre traditionelle Methode der Hetzjagd, bei der sie Wiederkäuer über Tage hinweg mit hohem Tempo verfolgen, bis die Tiere aus Erschöpfung schließlich aufgeben und stehen bleiben. Diese Langstreckenjagdtechnik wurde als das evolutionäre Ergebnis unserer einzigartigen Kombination aus Schwitzen und Zweibeinigkeit erklärt. Das ist das Modell der körperlichen Leistung des Menschen, das viele Leute (und alle Bildagenturen) im Kopf haben, wenn sie sich die Lebensweise der Jäger und Sammler vorstellen. Aber Gazellen sind nicht ihre einzige Nahrung; wenn sich diesen Jägern die entsprechende Gelegenheit bietet, tut es auch fast jedes andere Tier, bis hin zu dem langsameren, aber viel kratzbürstigeren übergroßen Nager dieser Region, dem Stachelschwein. Moderne ethnografische Forschungsarbeiten zu den Hadza in West-Zentralafrika haben gezeigt, dass bestimmte Gruppen von Jägern und Sammlern eigentlich rund 70 Prozent ihrer Gesamtkalorien aus nicht fleischlichen Quellen beziehen. Die Anthropologen Frank Marlowe, Collette Berbesque und Kollegen haben eine detaillierte Studie zur Nahrung im Hadza-Lager durchgeführt, bei der sie notierten, abwogen und beobachteten, was es zum Abendessen gab. Sie fanden heraus, dass Fleisch nur etwa 32 Prozent der Gesamtkalorienaufnahme ausmacht und der Rest aus einer Kombination aus Baobabfrüchten (14 Prozent), Knollen (19 Prozent) und Beeren (20 Prozent) besteht. Überraschenderweise stammen die restlichen 15 Prozent der von den Hadza aufgenommenen Kalorien aus Honig, der nur mit beträchtlicher Mühe und unter Gefahren und Unannehmlichkeiten gesammelt werden kann; dennoch ist er ein wesentlicher (und sehr beliebter) Teil ihrer Ernährung.
Archäologische Funde deuten darauf hin, dass unsere Vorfahren eine Vielzahl von Nahrungsmitteln aßen.* Knochen mit Schnittmarken, gekochte Knochen, verbrannte Knochen, verkohlte Samen und sogar winzige Pflanzenreste in der Plaque uralter Zähne helfen uns dabei, unsere urzeitliche Ernährung zu rekonstruieren. Es ist noch gar nicht lange her, dass man begann, sich bei der archäologischen Bergung auf die mikroskopischen Hinweise auf die Ernährungsweisen der Vergangenheit zu konzentrieren. Das erklärt vielleicht zu einem großen Teil, warum der Schwerpunkt in den frühen Tagen der Archäologie einzig auf dem Verzehr von Tieren zu liegen schien, da die Belege für Fleischkonsum größtenteils mit dem bloßen Auge erkennbar sind und die Knochen selbst groß genug, um mit einiger Wahrscheinlichkeit von Archäologen eingesammelt zu werden. Das Klischee des Fleisch essenden Höhlenmenschen, auf das die Befürworter der „Paläo-Ernährung“ so gern zurückgreifen, ist jedoch ziemlich veraltet. In den 1960er-Jahren erhielt die Archäobotanik (das Studium der Pflanzen, die Menschen in der Vergangenheit aßen und nutzten) endlich ihre verdiente Anerkennung. Auch wenn es unwahrscheinlich klingt, übersteht ein Teil des organischen Materials tatsächlich die Jahrtausende. Pflanzenreste können verkohlt sein, Samenkapseln getrocknet und in archäologischen Böden verteilt und einzelne Stärkekörner und Pollen aus sehr sorgfältig geborgenen Erdklumpen und sogar aus Plaque gewonnen werden. Diese mikroskopischen Funde werden auf archäologischen Grabungen durch die Flotationstechnik zutage gebracht, bei der mithilfe von Wasser schwereres (nicht organisches) Material von leichteren (organischen) Teilen getrennt wird, oder mittels neuerer Techniken, wie der Analyse von Zahnstein (verhärteter Plaque). Diese Ergebnisse hatten dramatische Auswirkungen auf unser Wissen über die menschliche Vergangenheit, wie die Archäologen selbst bereitwillig zugaben:
Dem Leser wird auffallen, dass unser vorläufiger Bericht über die Saison 1961 selbstbewusst feststellt, dass „Pflanzenüberreste in Ali Kosh selten waren“. Nichts könnte der Wahrheit ferner sein. Der Hügel steckt von oben bis unten voller Samen; „selten“ war 1961 nur unsere Fähigkeit, sie zu finden, und als wir 1963 die Flotationstechnik in unsere Methoden aufnahmen, stellten wir eine Schichtenfolge von Proben mit insgesamt 40.000 Samen sicher. *
Vor der Entwicklung dieser fortgeschrittenen Techniken zur Identifizierung der Mikrospuren der Pflanzennutzung in der Vergangenheit rekonstruierten Archäologen unsere Beziehung zu Pflanzen durch archäologische Funde wie Vorratskrüge und -behälter sowie Funde von Ernte- oder Dreschwerkzeugen.
Im ersten Teil des 20. Jahrhunderts begann V. Gordon Childe, die verstreuten Belege für eine neue Art von Pflanzennutzung aus archäologischen Ausgrabungen überall im Nahen Osten und in Europa zusammenzutragen. Auf der Grundlage vorhergehender Arbeiten und seines eigenen enzyklopädischen Studiums von Artefakten aus dem Altertum im Nahen Osten und Europa stellte er die Theorie auf, dass es vor rund 10.000 Jahren eine große Revolution in den menschlichen Gesellschaften gab. Jagen und Sammeln waren einer neuen steinzeitlichen Erfindung gewichen: dem Ackerbau. Childe, Zeit seines Lebens Marxist, war von Australien nach England ausgewandert und leitete dort das renommierte Institute of Archaeology am University College London. Er war die vielleicht einflussreichste Persönlichkeit in der Archäologie, was die Entwicklung von großen Theorien über das Wie und Warum der menschlichen Vergangenheit anging. Seine politischen Ansichten beeinflussten dabei seine Auffassung von dieser großen Veränderung in den menschlichen Aktivitäten im Hinblick auf ihren Revolutionscharakter. Dieses Buch steht in der Tat tief in seiner Schuld, da zwei seiner Konzepte hier wiedergegeben werden:* das Konzept der Neolithischen Revolution und das der Urbanen Revolution. Mit der Urbanen Revolution werden wir uns in späteren Kapiteln noch beschäftigen, aber in der Neolithischen Revolution finden wir die allerersten Beispiele für eine Lebensweise – sesshaft, abhängig von Landwirtschaft –, ohne die wir nach der Meinung einiger Menschen der Datenlage zufolge besser dran gewesen wären.
Die Neolithische Revolution, wie Childe sie beschreibt, ist keine Revolution im dramatischen, Hymnen schmetternden Modus eines Frankreichs im 18. oder eines Russlands im 20. Jahrhundert. Seine Revolution ist das progressive Ergebnis der Reibung zwischen verschiedenen Aspekten des menschlichen Lebens, die sich so lange fortsetzt, bis sie sich gegenseitig zu ganz neuen Formen geschliffen haben.† Für Childe gibt es ein klares Kennzeichen der Revolution: die Demografie. Er sieht einen „Knick“ in dem Graphen des Bevölkerungsdiagramms als sicheres Zeichen dafür, dass die Gesellschaft sich verändert, in einen neuen Gang geschaltet hat. Er ist nicht der Einzige. Nachfolgende Forscher haben damit begonnen, Knochenfunde zusammenzutragen, die das Auf und Ab der Populationen belegen; nicht nur in Childes Interessengebiet (dem Alten Orient, vor allem Mesopotamien), sondern an vielen unterschiedlichen Orten, wo sich sesshaftes Leben und Ackerbau entwickelt haben. Dazu gehört die bedeutende Arbeit von Jean-Pierre Bocquet-Appel, der einen „neolithischen demografischen Übergang“ (Neolithic Demographic Transition) neben der Entwicklung der Landwirtschaft feststellte: starkes Bevölkerungswachstum, gepaart mit entsprechenden Anstiegen bei Krankheiten und Sterblichkeit. Um diese beiden Grundkonzepte, das einer Revolution und das der Belege in den Knochen, geht es in diesem Kapitel. Beantworten müssen wir die Frage, ob die großen Veränderungen der Jungsteinzeit ähnlich viele Todesopfer forderten wie die guillotinewütigeren Aufruhre – ob die Entwicklung des sesshaften Lebens und die Kontrolle über Feldfrüchte und Tiere der kritische erste Schritt auf einem Schlitterpfad in Richtung Childes zweiter Revolution waren, dem Stadtleben, und damit zu einer ansteigenden Flut von Krankheit und Tod. Aber zuerst müssen wir uns ansehen, was die Neolithische Revolution tatsächlich bedeutete.
Für Childe war die Neolithische Revolution der Punkt, an dem die Menschen Herr über ihr eigenes Nahrungsangebot wurden. Doch das ist eine ungenügende Beschreibung der Veränderungen im Leben der Menschen, die erstmals vor rund 12.000 Jahren im Alten Orient auftraten. Schließlich hatten die Menschen ihr Nahrungsangebot vermutlich immer in gewissem Maß unter Kontrolle, oder wir wären heute gar nicht hier. Viele Gesellschaften, die keine extensive Landwirtschaft betreiben, unterhalten trotzdem kleine Gärten oder pflegen einzelne Flecken mit wilden Pflanzen, unter anderem Yamswurzeln, Knollen, Reis und Mais. Nahrungsmittel auf Pflanzenbasis sind ein wesentlicher Teil der menschlichen Ernährung und wie für die heutigen Anhänger von Ernährungsweisen, die ausschließlich auf tierischen Proteinen basieren, hätte für die Menschen in der Vergangenheit die Gefahr einer Proteinvergiftung bestanden bzw. der Erscheinung, die auch als „Kaninchenhunger“ bezeichnet wird: Ohne eine ausreichende Mischung von Nährstoffen kann eine ausschließlich aus Fleisch (vor allem mageren Fleisch) bestehende Ernährungsweise in nur drei Tagen zu schwächenden Symptomen und innerhalb weniger Wochen zum Tode führen. Pflanzenbasierte Nahrungsmittel variieren je nach den vielen ökologischen Nischen, die die Menschen besetzt haben, aber mehrere Beweisketten, die wir auch den Fortschritten in den Mikroskopiertechniken verdanken, zeigen, dass Homo in seiner Stammesgeschichte schon früh Pflanzen verzehrte. Viele Pflanzen erzeugen winzige Silikatstrukturen, die Phytolithen; sie haben unterschiedliche Formen und Größen, aber wegen ihrer mineralischen Beständigkeit können sie in archäologischen Überresten aufgespürt werden. Phytolithen aus der Besiedlung der Amud-Höhle am Rand des Jordangrabens durch Neandertaler zeigen, dass die essbaren Fruchtstände grasartiger Pflanzen schon vor 50.000 bis 70.000 Jahren zur Geschichte der Menschheit gehörten. Fragmente von Pflanzenstärken, die als Verkalkungen im Zahnstein von Neandertalern gefunden wurden, haben gezeigt, dass Neandertaler nicht nur grasartige Pflanzen aßen, sondern auch gegarte stärkehaltige Pflanzen. Diese Techniken haben uns auch eine Fülle an archäobotanischen Belegen für die Nutzung pflanzlicher Nahrungsmittel durch moderne Menschen geliefert. Doch irgendwann wandelte sich unsere lockere Beziehung zu wilden Gräsern und Knollen zu einer viel komplizierteren Geschichte gegenseitiger Abhängigkeit.
Wildtypen der großen Grundnahrungsmittel in der Landwirtschaft wurden in mehreren Regionen der Welt identifiziert, wobei in den verschiedenen Ökozonen unterschiedliche Arten essbarer Pflanzen dominieren. In Nord- und Südamerika wurde als wilder Vorfahre des Mais ein besonders abweisend aussehendes dürres Gras namens Teosinte erkannt, das im Flusstal des Río Balsas beheimatet ist. Teosinte-Fruchtstände bestehen nur aus einer Handvoll gepanzerter Samen, die bei Weitem nicht so verlockend aussehen wie die fetten Körner an einem modernen Maiskolben,* aber Archäologen haben Spuren davon auf Mahlsteinen gefunden, die fast 9000 Jahre alt sind. Reis, das Grundnahrungsmittel für etwa die Hälfte der Weltbevölkerung, hat ähnliche Veränderungen durchgemacht. DNA-Analysen von Bin Han und Kollegen an verschiedenen domestizierten Reissorten (Lang- und Rundkorn) deuten darauf hin, dass der wilde Vorfahre beider Sorten aus dem Perlfluss-Tal in China stammt, und an Stätten entlang dem Jangtse fanden sich archäologische Belege für Reis, die rund 9000 Jahre alt sind. Wie beim Mais ist jedoch der Reis aus frühen archäologischen Zusammenhängen nicht ganz dasselbe wie der Reis, den wir heute kennen: Die Körner sind von variabler Größe und der frühe Reis hatte Samen, die leicht abfielen – gut für eine selbst aussäende Pflanze, aber weniger hilfreich für menschliche Konsumenten. Dorian Fuller, der die Ausgrabungen an einer dieser frühen Stätten im Jangtse-Tal leitete, legte nahe, dass die Domestizierung des Reises ein langsamer Prozess über Tausende von Jahren war, in denen die Population der Gegend größtenteils von anderen Nahrungsquellen abhängig war.* Getreide wie Weizen und Gerste haben sich in den gemischten Ökozonen des Alten Orients mit Eichen und Pistazienbäumen durch ähnliche Mutationen von ihren wilden Vorfahren entfernt: Nicht streuende Samen erleichtern die Ernte, Veränderungen in Saisonabhängigkeit, Verteilung und Fortpflanzungsweise erleichtern die Kultivierung, außerdem veränderte sich die Samengröße.
Tatsächlich ist fast alles, was wir heute essen, durch menschliches Eingreifen genetisch verändert worden. Kartoffeln, Yamswurzeln und andere Knollen wurden unabhängig voneinander in mehreren Gebieten domestiziert, aber es bestehen deutliche Unterschiede zwischen dem kleinen violetten andischen Wildtyp der Kartoffel und dem mehligen Giganten, den man in den meisten englischen Cafés unter gebackenen Bohnen und Käse findet. Möhren, wie viele Menschen wissen, waren ursprünglich violett; Wassermelonen waren rosa und hatten die Größe einer Grapefruit; Grapefruits, Limetten, Zitronen und Orangen können so ziemlich jede Farbe zwischen Gelb und Grün annehmen, sind aber tatsächlich menschengemachte Hybriden aus einer Handvoll grüner wilder Zitrussorten, und so gut wie jedes grüne Gemüse, das wir essen – von Brokkoli bis Grünkohl –, ist eine Art Senfpflanze. Es gibt unglaublich wenig häufig verzehrte pflanzliche Nahrungsmittel, die nicht durch Zucht dem menschlichen Geschmack unterworfen wurden. Die genetische Veränderung von Nahrungsmitteln hat bei uns eine lange Tradition – ein Argument, das in der Regel geflissentlich aus der Debatte um die Ethik der Anwendung von Gentechnik (Herumbasteln an der DNA) zur Veränderung von Feldfrüchten ausgeschlossen wird. Wollte man es aus der Sicht der Pflanzen betrachten, könnte man auch sagen, dass die Menschen mit großem Erfolg als Teil der Verbreitungs- und Fortpflanzungsmethoden mehrerer verschiedener Pflanzentaxa domestiziert wurden. Wie lange genau wir jedoch schon mit unserem Essen experimentieren, ist ein Thema, zu dem es immer noch ständig neue Belege gibt, die uns überdenken lassen, was wir über die Verbindung zwischen den großen Veränderungen in der Lebensweise der Menschen während der Neolithischen Revolution und der Entwicklung der Landwirtschaft wissen.
Die am besten untersuchten Beispiele für die Entwicklung der Landwirtschaft stammen aus Südwestasien (dem Alten Orient), Ostasien und Nord- und Südamerika. Als Ursprung der Neolithischen Revolution identifizierte Childe den Fruchtbaren Halbmond und die Domestizierung von Weizen und Gerste scheint in dieser Region mehrere Jahrtausende früher stattgefunden zu haben als die von Reis in Asien oder von Mais in Nord- und Südamerika. Das ist auch die Gegend, die ich am besten kenne, nachdem ich einige Zeit an den Rändern des südwestasiatischen landwirtschaftlichen Phänomens gearbeitet habe, an jungsteinzeitlichen Ausgrabungsstätten auf der zentralanatolischen Hochebene. Das heutige Zentralanatolien wird von Landwirtschaft beherrscht; Kornfelder erstrecken sich endlos über die Hochebene bis zum Horizont in einem Meer goldgelber Stängel, nur hier und da durch einen Bewässerungskanal unterbrochen. Die wilden Vorfahren einer Reihe moderner Getreidearten in Europa und Westasien finden sich von Anatolien bis zur südlichen Levante: Einkorn, Emmer und Gerste, neben anderen pflanzlichen Grundnahrungsmitteln wie Erbsen, Kichererbsen und Linsen. Das heißt, sie lassen sich überwiegend in diesen Regionen identifizieren; die Kombination aus Belegen aus moderner Sequenzierung der Getreide-DNA und den Funden aus archäologischen Stätten malt ein sehr unklares Bild des Domestikationsprozesses. Archäobotaniker suchen noch immer nach den wilden Vorfahren mehrerer moderner Nahrungspflanzen wie der Ackerbohne und die Ergebnisse der DNASequenzierung ließen sich durch eine Fülle von Szenarien erklären, in denen wilde und domestizierte Versionen derselben Pflanze aus verschiedenen Regionen über einen Zeitraum von Tausenden von Jahren wiederholt vermischt wurden.
2015 veröffentlichte ein Forscherteam, das an der 23.000 Jahre alten Fundstelle Ohalo II in einer levantinischen Höhle am Ufer des Sees Genezareth arbeitete, neue Ergebnisse zu den Pflanzenresten, die an ihrer Stätte geborgen worden waren. Diese Forscher suchten nicht nur vor Ort nach den wilden Vorfahren unserer domestizierten Sorten, sie identifizierten auch die Unkräuter, die bei allen unseren schmackhafteren Pflanzen wachsen. Als sie die Gruppierung dieser Kräuter und winzig kleine Schrammen an ihren Fruchtständen betrachteten, kamen die Forscher zu dem Schluss, dass die Bewohner eine Art „Ackerbauversuch“ unternommen hatten, mehr als elf Jahrtausende bevor Childe (und so einige andere) Belege für Landwirtschaft sah. Die Mischung aus Unkräutern und essbaren Gräsern, das Vorhandensein von Sicheln und die leicht domestizierte Form einiger Samen deuten darauf hin, dass das Lager bei Ohalo ein frühes Experiment der Nutzpflanzenkultivierung war – aber eins, das letztendlich scheiterte. Wie das Natufien-Experiment des Niederlassens an einem Ort scheinen viele unserer ersten Revolutionsversuche nach einigen Jahrtausenden irgendwie im Sande verlaufen zu sein. Die „Neolithische Revolution“ scheint eher ein „End-Pleistozän-Experiment“ gewesen zu sein, mit einer sehr allmählich errichteten Grundlage neuer Technologie und neuer Lebensweisen, die gelegentlich einfach vollkommen geschleift wurden, während alle für ein paar Jahrtausende wieder zum Jagen und Sammeln zurückkehrten.
In den 1970er-Jahren stolperten physische Anthropologen bei der Erforschung der Moundbuilders* über ein Problem. Der Ackerbau, dachten die meisten Archäologen, war ein wichtiger Schritt auf dem Pfad hin zur Zivilisation. Allein die Zahl der Fundorte auf der ganzen Welt mit Belegen für die Landwirtschaft zeigt eindeutig, dass die Population der Menschen mit dem Aufkommen des Ackerbaus explodiert war. Für die meisten gab es einen klaren Entwicklungsverlauf von der „Revolution“ in der Jungsteinzeit bis zur Entstehung von Städten und all den technologischen Fortschritten, mit denen wir in immer größerer Zahl unter so beengten Bedingungen aufwarten konnten. Da innerhalb der Archäologie meist ein eher unkritisches Konzept von Fortschritt als etwas „Gutem“ vorherrscht, rechneten die physischen Anthropologen damit, dass sie in den Grabstätten der Dickson Mounds in Illinois, die Überreste von vor und nach der Entstehung der Landwirtschaft in der Region enthielten, Belege für den Nutzen dieses Fortschritts finden würden. Tatsächlich fanden sie aber etwas ganz anderes heraus: Die Population wuchs, aber um einen gewissen Preis. Die Lebenserwartung unter den Bauern von Dickson Mounds war geringer und das Leben insgesamt gefahrenreicher. Gesundheit in der Kindheit und Überleben im Erwachsenenalter schienen ins Bodenlose abzustürzen; wie sollte man das zum Fortschritt erklären? Wenn die Neolithische Revolution zu einem Absinken des Lebensstandards führte, warum erfolgte sie dann immer und immer wieder auf der ganzen Welt? Wie gut war unsere neue landwirtschaftsbasierte Lebensführung, wenn wir erst vor 12.000 Jahren dabei bleiben konnten? Und wie stark unterschied sie sich tatsächlich von dem, was die Menschen vorher getan hatten? Hier kommen wir zu den eigentlichen Belegen für die Auswirkungen der Neolithischen Revolution, entnommen aus Knochen und Zähnen.*
Forscher verfolgen seit einiger Zeit den menschlichen Fortschritt im Übergang zur Landwirtschaft mithilfe bioarchäologischer Marker. Eine sehr frühe Einsicht in die körperlichen Auswirkungen der Landwirtschaft stammte aus den „eloquenten“ Knochen von Abu Hureyra, einer archäologischen Grabungsstätte in Syrien, die Anzeichen menschlicher Besiedlung aus der Jäger-und-Sammler-Periode Natufien bis zu frühen Experimenten mit der Landwirtschaft preisgab. Theya Molleson, eine Pionierin der physischen Anthropologie aus dem Natural History Museum in London, untersuchte die Überbleibsel dieser frühen Landwirte. Molleson beschrieb eine Folge von Veränderungen an den Körpern der Bewohner von Abu Hureyra in Form eines Knochenaufbaus an Stellen, wo die Muskeln durch wiederholte schwere Lasten beansprucht worden sein könnten. Zum Beispiel erkannte sie Veränderungen an den Halswirbeln, wo das Gewicht einer schweren, auf dem Kopf getragenen Last sich auswirken würde, zusammengebrochene Wirbel direkt am Wirbelsäulenbogen und merkwürdigerweise auch eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Arthritisfällen am großen Zeh. Neben diesen seltsamen Pathologien fand sie zahlreiche Belege für den Muskelgebrauch an Armen und Beinen; die Teile des Knochens, wo die großen Muskeln ansetzen, waren stark aufgebaut. Starker Muskelgebrauch regt die Knochenstücke, an denen die Muskeln sich mit dem Skelett verankern, dazu an, ihre Oberfläche zu vergrößern, damit sich mehr Gewebe anheften kann. An einem Skelett lässt sich dies als zusätzliche Knochenmasse genau an den Stellen erkennen, wo die Muskeln ansetzen. Eine frühe Anfangstheorie jungsteinzeitlicher Ballerinas wies Molleson zu Recht zurück und identifizierte stattdessen ein sehr spezifisches Verschleißmuster, das auf das Mahlen von Getreide auf einem Mahlstein zurückzuführen war. Das Halten dieser originellen „Planke“-Position im Knien beim Getreidemahlen hatte vor allem auf die Körper der Frauen von Abu Hureyra verheerende Auswirkungen. Spätere Studien stellten zwar infrage, inwieweit eine immer wiederkehrende Tätigkeit wirklich die Skelettstruktur verändern kann, doch es ist klar, dass Molleson eine charakteristische Folge von Handlungen erkannt hatte, die echte (und dauerhafte) Auswirkungen auf die Menschen in der Jungsteinzeit hatten.
Es gibt gute Belege für eine Schattenseite der jungsteinzeitlichen Lebensweise. Frühen Anthropologen fiel auf, dass viele Bevölkerungsgruppen in der Vergangenheit bemerkenswert gerade, gesunde Zähne hatten. Es gab weitaus weniger schiefe Schneidezähne, versetzt stehende Eckzähne oder zur Seite durchbrechende Weisheitszähne.* Auf der Suche nach einer Erklärung identifizierten viele Forscher Veränderungen im Gebrauch unserer Zähne als Ursache unseres jüngeren Dentalkummers. Unter anderem bemerkten die Forscher, dass sich auf dem sehr harten Zahnschmelz ein winziges Archiv mikroskopischer Kratzer und Dellen von den vielen Dingen findet, die wir kauen. Peter Ungar ersann als Erster neue Methoden, den Mikroabrieb von Zähnen mithilfe von hochauflösenden Zahnbildern in einer Größe zu untersuchen, in der diese Kratzer sich zählen und beschreiben lassen. Er postulierte, dass durch die Unterscheidung zwischen langen, dünnen Linien, tiefen Kratzern und Gruben unterschiedliche Formen der Ernährung* nachgewiesen werden können. Eine Umstellung von einer Ernährung aus harten Nüssen und Samen (die viele mikroskopische Gruben hinterließen) zu einer Ernährung, die stärker aus weicheren, faserhaltigen Pflanzen wie Knollen bestand (die eher Kratzer hinterließen), müsste die Muster verändern, die unter dem Mikroskop im Zahnschmelz zu sehen sind. Tatsächlich geschah genau das: Es gibt zum Beispiel Berichte über eine Zunahme der Grubenbildung, die der Zunahme der Menge harter Nüsse und Samen zugeschrieben wird, die in der langen jungsteinzeitlichen Übergangsphase der späten Archaischen und Woodland-Periode in Nordamerika verzehrt wurden. Patrick Mahoney erkennt im Alten Orient dasselbe Phänomen, mahnt jedoch zur Vorsicht: Unterschiedliche Nahrungsmittel erfordern wahrscheinlich unterschiedlich viel Kauaktivität, daher überprüfte er die Hypothese, dass weiche, grasartige Fruchtstände mit dem Übergang zu einer jungsteinzeitlichen Ernährung nicht allzu viele Veränderungen bei den Natufien-Menschen mit sich bringen würden, sich aber die Grubenbildung auf ihren Zähnen verändern würde. Die Veränderung in der Grubenbildung konnte dem archaischen (und kürzlich wiederbelebten) Trend zu auf Steinen gemahlenen Körnern zugeordnet werden. Dieselben Mahlstein-Techniken, die für den Muskelzuwachs an den Frauen von Abu Hureyra verantwortlich waren, hinterließen woanders mikroskopische Spuren: Die nahezu unsichtbaren Steinmehlkörner, die beim Aneinanderschlagen von Steinen entstehen, landeten im Essen und damit direkt auf den Zähnen.†
Viele gesammelte Nahrungsmittel – zum Beispiel die weiter oben erwähnte Frucht des Affenbrotbaums – sind recht zähe, faserreiche Alternativen und müssen kräftig gekaut werden, um Nährstoffe herauszulösen. Die weichen, matschig gekochten Kohlenhydrate, die mit Aufkommen der Landwirtschaft unsere Ernährung zu dominieren begannen, so die Theorie, stellten geringere Anforderungen an unsere Kiefer, auch wenn der Stein, mit dem wir sie mahlten, Krater in unseren Zähnen hinterließ. Das führte zu einer Art Nudelsuppen-Effekt: Weiche, schlürfbare Nahrungsmittel bedeuten weniger Arbeit für unsere Kiefer, weshalb weniger Muskeln dort ansetzen müssen, weshalb sie wiederum nicht so groß sein müssen, um genügend Ansatzfläche zur Verfügung zu stellen; und wenn der Kiefer nicht groß sein muss, dann das Gesicht vielleicht auch nicht. Und schrumpfende Gesichter sind genau das, was wir laut diverser Studien der prominenten physischen Anthropologen Simon Hillson, Clark Spencer Larsen und C. Loring Brace beobachten. Kleiner werdende Gesichter wären weder eine positive noch eine negative Auswirkung der Landwirtschaft, gäbe es da nicht das Problem, dass in unseren Gesichtern auch unsere Zähne stecken. Zähne werden relativ stark über die Gene gesteuert und reagieren daher wesentlich weniger plastisch auf Veränderungen in Gebrauch und Umgebung als der Rest des Skeletts. Wenn die Zähne in kleineren Kiefern gleich groß bleiben oder auch nur langsamer schrumpfen, führt das zu einem Engstand und zu der Dysgnathie (schief stehende Zähne), die man an vielen Überresten vom Höhepunkt der Jungsteinzeit beobachtet. Wahrscheinlich spielt auch eine gute Portion genetisches Glück eine Rolle dabei, wie gut unsere Zähne in unseren Kiefer passen, aber diejenigen unter uns, die sich die schmerzenden Weisheitszähne ziehen lassen mussten, würden nur zu gern die Zahnarztrechnung an die frühen Bauern schicken, die unsere leicht zu kauende Nahrung auf den Weg brachten.
Nicht nur die Größe unserer Kiefer und Zähne hat sich in den letzten 12.000 Jahren verändert. Unsere allgemeine Zahngesundheit hat auch ziemlich was abbekommen. Karies (oder Kavitäten) sind die Löcher, die rührige Bakterien in unsere Zähne graben, wenn sie die richtige Umgebung vorfinden. Diese Löcher können die empfindlichen Nervenenden im Zentrum unserer Zähne freilegen, was zu Empfindlichkeit (gegenüber Wärme, Kälte oder Kontakt) und gelegentlich zu höllischen Schmerzen führt. Zwar haben unsere Zähne einen eingebauten Verteidigungsmechanismus und bilden Bollwerke zum Schutz des Nerven, wenn der harte äußere Zahnschmelz von der Milchsäure weggeätzt wird, die gut genährte Bakterien absondern. Karies arbeitet jedoch schneller und kann beträchtliche Verheerungen anrichten, die sogar zum Verlust des ganzen Zahns führen können. Die entscheidenden Faktoren in diesem absolut schmerzhaften Prozess sind die Zusammensetzung der Mundbakterien (die man wahrscheinlich mehr oder weniger erbt*) und die Nahrungsmittel, mit denen sie jedes Mal gefüttert werden, wenn man sich etwas in den Mund steckt. Kariesbakterien sind pH-sensitiv; sie gedeihen in einer basischen Umgebung und sind in einer sauren weniger aktiv. Wenn wir essen, verändert sich der pH-Wert im Mund je nach Art der Nahrung, die wir verdauen müssen. Stärkehaltiges, kohlenhydratreiches, zuckerhaltiges Essen aktiviert Kariesbakterien am besten – der Zucker, der beim Verzehr solcher Nahrungsmittel entsteht, senkt den pH-Wert im Mund über längere Zeit, sodass die Karies mehr Zeit zum Entstehen hat. Wenn wir also Zähne aus der Vergangenheit voller Löcher sehen, können wir mit Fug und Recht annehmen, dass hier eine stärkereiche, zuckerreiche Ernährung am Werk gewesen ist; mit der Entwicklung der Landwirtschaft sehen wir dann eine wahre Epidemie fauler Zähne.
Natürlich haben wir gute Belege dafür, dass die Menschen schon lange einen großen Teil ihrer Kalorien aus Kohlenhydraten beziehen. Mobile Gruppen der Werkzeuge benutzenden ibéromaurusischen Kultur in Marokko (ganz und gar keine Bauern) hatten ziemlich schlechte Zähne. Karies scheint ein großes Problem bei diesen Jägern und Sammlern gewesen zu sein. Als wahrscheinliche Ursache identifizierten Forscher Eicheln – eine gute Nährstoffquelle, aber eine schlechte Wahl, wenn man Wert auf nicht faulende Zähne legt. Ein weiterer Störfaktor in der einfachen Annahme „Karies gleich Bauern“ ist die unterschiedliche Kariesrate bei verschiedenen Gruppen mit ähnlicher Nahrung. Dank zunehmend besseren DNA-Analysetechniken könnten wir irgendwann feststellen, dass verschiedene Stämme Karies verursachender Bakterien mehr oder weniger virulent sind und dass die ererbte Mundflora eine beträchtliche Auswirkung auf das Überleben der Zähne haben könnte. Auch die natürliche Fluorisierung durch lokale Wasserquellen spielt eine Rolle beim Kariesschutz. Verfaulende, schiefe Zähne sind zwar vielleicht nicht der unwiderlegbare Beweis für landwirtschaftliche Innovation, doch die Zahlen deuten darauf hin, dass sie etwa um die Zeit zu einem echten Problem für unsere Spezies wurden, als wir den Ackerbau entdeckten.
Wie riskant also war die Neolithische Revolution? Sie hat vielleicht unsere Zähne ruiniert, aber reichte das, um uns zu töten? Wie müssen wir angesichts der ansteigenden Geburten und der Fruchtbarkeits-„Revolution“ die Faktoren verstehen, die unseren Bestand in Schach hielt? Mit dieser Frage haben sich einige Kollegen und ich beschäftigt, indem wir uns die Informationen über den Lebenslauf ansahen, die im harten Zahnschmelz menschlicher Zähne stecken. Zähne, wie Sie vermutlich noch häufiger in diesem Buch lesen werden, sind eine wunderbare Informationsquelle. Sie bestehen zu etwa 98 Prozent aus Mineralien, sind robust und in den meisten archäologischen Böden beständig und können Tausende von Jahren mehr überdauern als die empfindlicheren Knochen. Zähne werden schon vor der Geburt angelegt und formen sich im Gegensatz zu Knochen während des Lebens niemals um,* daher tragen sie für immer die chemische und physikalische Signatur der Zeit, in der sie entstanden sind. Dem rührigen Dentalanthropologen stehen eine Reihe von Techniken zur Verfügung, mit denen er diese Signale rekonstruieren kann, was uns die recht einzigartige Gelegenheit verschafft, einen Blick auf das Leben von Menschen in der Vergangenheit zu werfen statt auf den Tod.
Wenn Sie das Konzept der Jahresringe von Bäumen kennen, können Sie sich einen ähnlichen Mechanismus vorstellen, der in Ihren Zähnen am Werk ist. Ein Baum wächst in aufeinanderfolgenden Schichten, die jeweils von einem Ring begrenzt werden, wenn der Baumstamm sich Jahr um Jahr weiter ausdehnt. In guten Jahren wächst der Baum ein ganzes Stück und der Ring, den er bildet, ist breiter; in schlechten wächst er weniger und der Ring ist schmaler. Es ist zwar nur eine sehr grobe Analogie,† doch Ihre Zähne bilden sich in ähnlichen aufeinanderfolgenden Schichten.‡ Diese Schichten folgen einer Art angeborenem Rhythmus, einem inneren Timer, der etwa eine Woche läuft, und wo das Wachstum anhält (und wieder einsetzt), hinterlässt es einen kleinen Ring um den Zahn. Jeder über 18 wird die meisten dieser kleinen Ringe vermutlich schon beim Zähneputzen entfernt haben, aber gelegentlich können sie mithilfe einer kräftigen Lampe und eines guten Spiegels doch noch zu sehen sein. Das Zählen von Zahnringen ist natürlich aus demselben Grund nützlich wie das Zählen von Baumringen – sie verraten uns, wie lange das betreffende Objekt schon wächst. Aber darüber hinaus sagen uns vor allem fehlende Ringe, was während des Zahnwachstums passiert ist. Sind Lücken im normalen Ringmuster zu erkennen – im Prinzip Furchen oder Linien auf den Zähnen –, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das normale Wachstum ausgesetzt hat; meist aufgrund eines schlechten Gesundheitszustands, möglicherweise aufgrund von Krankheiten oder sogar von Mangelernährung. Diese Furchen heißen Zahnschmelzhypoplasie und können Bioarchäologen verraten, ob das Kind, dem die Zähne wuchsen, gesund war – oder vielmehr, wann es nicht gesund war.
Forscher kennen die Verbindung zwischen Zahnfurchen und Gesundheit in der Kindheit schon seit einer Weile. Erst durch die Menschen von Dickson Mounds jedoch wurde klar, wie wichtig sie ist, um herauszufinden, wie menschliche Populationen mit veränderlichen Lebensumständen umgehen. Diese Studie aus den 1970er-Jahren zeigte als eine der ersten, dass sich Belege für Krankheit und Mangelernährung in der Kindheit in den Zähnen zwischen Bauern und Nichtbauern vergleichen ließen; nach Auswertung der Ergebnisse stellte sich heraus, dass die Bauern eine wesentlich stärkere Zahnschmelzhypoplasie aufwiesen als die Nichtbauern. Man ist sich einig, dass der Übergang zur Landwirtschaft zu einer Zunahme der Rillen in den Zähnen führte – das wird nicht nur im Nahen Osten beobachtet, sondern fast überall dort, wo die Landwirtschaft sich durchsetzte. Das ist ein kritischer Punkt – wenn wir insgesamt widerstreitende Belege dafür haben, wie belastend der Übergang zur Landwirtschaft war, können wir dann überhaupt solche pauschalen Aussagen treffen? Genau das tun Archäologen eben,* aber wir können uns verschiedene Regionen der Welt und unterschiedliche Arten von Jungsteinzeiten ansehen und stellen fest, dass die Beobachtungen, die für die Ostküste der USA zutreffen, nicht unbedingt mit denen woanders, etwa in Thailand, übereinstimmen. Zunehmend bessere Technologie verschaffte den Bioarchäologen immer genauere Informationen darüber, wann und wie Kinder in der Vergangenheit krank waren, und so machte ich mich 2012 mit einem Zahnköfferchen und dem blinden Glauben an meine Fähigkeit, durch Anatolien fahren zu können, auf, um mir eine bestimmte Ausgrabungsstätte (viel) genauer anzusehen: Aşklı Höyük.
Aşikli Höyük ist ein großer Erdhaufen an den Ufern des Flusses Melendiz am Rand der bergigen Region Kappadokien in der Türkei. Die nächste moderne Stadt ist Aksaray, aber es ist von so ziemlich überallher eine lange* Fahrt. Die Ausgrabungen am Hügel begannen 1992 unter der Leitung von Ufuk Esin, einem zukunftsweisenden türkischen Archäologen, und werden heute unter der Leitung seiner Studentin Mihriban Ozbasaran von der Universität Istanbul fortgesetzt. Ich hatte Mihriban und ihr Team kennengelernt, als wir beide 2008 an der UNESCO-Welterbestätte Çatalhöyük arbeiteten. Çatalhöyük ist ebenfalls eine Hügelstätte auf der anatolischen Hochebene und recht bekannt – jahrzehntelange Ausgrabungen haben dort ein Gewirr von Schlammziegelhäusern zutage gefördert, die mit bemaltem Putz und Rinderschädeln verziert sind und über Begräbnisstätten im Keller verfügen.† Mit einem Alter von etwa 9000 Jahren gilt Çatalhöyük als eine der ältesten „Städte“ der Welt; zu ihren Hochzeiten lebten hier vielleicht 10.000 Menschen und betrieben Landwirtschaft. Ein Spitzenteam physischer Anthropologen aus aller Welt versammelte sich dort in jeder Feldsaison, um die Überreste dieser frühen Bewohner zu untersuchen, und mich faszinierte die Möglichkeit, mehr über das Leben dieser Menschen am Rande der Neolithischen Revolution zu erfahren. Ich war daher verständlicherweise aufgeregt, als ich hörte, dass das Team aus Istanbul an einer anderen Siedlungsstätte in Anatolien grub – die sogar noch älter war.
Trotz einer etwas unglücklichen Einführung* luden Mihriban und ihr stellvertretender Grabungsleiter Güneş Duru mich liebenswürdigerweise für die Sommersaison 2012 nach Aşıklı ein. Es erwies sich als eine Stätte von enormer Bedeutung. C14-Daten zeigten, dass die erste Siedlungsphase auf dem Hügel vor rund 10 500 Jahren stattgefunden hatte – fast 1000 Jahre vor dem Trubel in Çatalhöyük. Mehr noch, die Stätte deckte die Besiedlung fast eines Jahrtausends ab, von frühen Rundhütten, die nur einen Tick dauerhafter waren als die Saisonlager zeitgenössischer Jäger-und-Sammler-Stätten, bis hin zu einem ausgewachsenen Schlammziegeldorf mit weiten öffentlichen Plätzen und den Sensen und Lagergefäßen, die als Kennzeichen für ein bäuerliches Leben gelten. Natürlich musste ich unbedingt dorthin und mir die menschlichen Überreste ansehen. Hier bot sich die Chance, der Neolithischen Revolution mitten ins Gesicht zu schauen – wobei ich persönlich mehr an den Zähnen interessiert war. Mit der Unterstützung des British Institute in Ankara und von Yılmaz und Dilek Erdal von der Universität von Hacettepe nahm ich Zahnabdrücke von den Toten und transportierte sie vorsichtig in meine Höhle im Keller des archäologischen Instituts am University College London. Dort verbrachte ich eine ganze, recht ermüdende Weile damit, in einem sonnenlosen Raum mit großer Sorgfalt Linien auf Zähnen auszuzählen.
Glücklicherweise zahlte es sich aus. Die Aşıklı-Zähne zeigten ein sehr schwaches Muster von Unterbrechungen der normalen Wachstumslinien. Die Zähne der Menschen aus der späteren Periode wiesen deutliche Rillen dort auf, wo das Wachstum unterbrochen worden war, in einem zweijährigen Abstand ab einem Alter von etwa zwei Jahren. Bei einem einzelnen Menschen jedoch fand ich ein etwas anderes Signal – hier gab es mehr Hinweise auf eine Wachstumsunterbrechung im Alter von ungefähr drei Jahren. Dies war ein Skelett aus der frühesten Phase, die in Aşıklı identifiziert worden war – die Phase der Rundhütten und mehrdeutigen Belege hinsichtlich einer Abhängigkeit von Landwirtschaft oder domestizierten Tieren. Nun macht zwar ein Skelett noch keine Schlussfolgerung, aber es ist verlockend anzunehmen, dass die Probleme, die diese Kinder in der Wachstumsphase hatten, mit den Veränderungen zu tun haben, die Bocquet-Appel und Kollegen erkannt hatten: mehr Babys in kürzeren Abständen. Für viele Primaten kommt der gefährlichste Moment der Kindheit, wenn die Mutter ihre Aufmerksamkeit dem nächsten Säugling zuwendet; ein Kind, das gerade erst angefangen hat, frei umherzulaufen, kann Probleme mit der Nahrungsversorgung und Krankheit bekommen. In Aşıklı könnte diese abrupte Störung der kindlichen Gesundheit mit der Geburt neuer Geschwister zusammengehangen haben. In einer Zeit der Experimente ohne problemlosen Zugang zu Fertigsnacks (ob nun glutenfrei oder nicht) könnte die Fruchtbarkeit, die das sesshafte Leben entfesselt hatte, ihren Tribut von der Gesundheit der Kinder der Revolution gefordert haben. Nun müssen wir warten, bis mehr Belege zutage gefördert werden, und die Ausgrabungen in Aşıklı dauern noch an.
Unsere allgemeinen Vorstellungen der Jungsteinzeit sind also vielleicht gar nicht so allgemein. Der physische Anthropologe Dan Temple hat fast* so viel Zeit wie ich mit dem Auszählen von Linien auf Zähnen verbracht. Von seiner Arbeit mit Clark Spencer Larsen an der Ohio State University an den Skeletten und Zähnen von Wildbeutern und nachfolgenden Bauern, die das prähistorische Japan bewohnten (Jōmon- und Yayoi-Kultur), berichtete Temple, dass die Einführung der Landwirtschaft nicht zu mehr Furchen auf den Zähnen oder anderen Markern schlechter Ernährung führte. Die einzigen negativen Anzeichen, die er in der Japanischen Neolithischen Revolution findet, sind Belege für eine leicht erhöhte Last von Infektionskrankheiten. Es ist interessant, dass der Nassreisanbau diesen Effekt offenbar nicht nur in Japan hat, sondern auch in der gut dokumentierten Neolithischen Revolution in Thailand.
Je ausgefeilter die bioarchäologischen Techniken werden, desto mehr werden Archäologen über das Überleben und die Fitness der frühesten Bauern sagen können. Fortschritte in aDNA-Techniken können ebenfalls Aufschluss über den Erfolg – im Populationsmaßstab – der jungsteinzeitlichen Lebensweise geben. Hochentwickelte Modelliertechniken können ebenfalls zu neuen Einsichten führen: Eine Gruppe unter der Leitung von Steven Shennan hat in jüngerer Zeit eine gewaltige Anzahl früher Ackerbaustätten in Europa aufgespürt und ihre Daten zeigen eine Ausweitung ackerbauabhängiger Lebensweisen mit Aufund Abschwüngen. Der nur in der Vorstellung stetige Fortschritt als gerade Linie zwischen der Erfindung der Landwirtschaft und dem Höhepunkt der modernen Zivilisation* entspricht in Wahrheit eher einem Veitstanz – zappelig, unvorhersehbar und mit ziemlich vielen Todesfällen am Ende.
* Ihr seid gemeint, Daily Mail.
* Siehe jeder Satz, der mit „Zu meiner Zeit …“ beginnt.
† Eine wesentlich ausführlichere Erörterung findet sich im ausgezeichneten Buch Paleofantasy von Marlene Zuk.
* Gemäß Loren Cordains Website. Es bleibt unklar, wofür der Empfehlende der weltweit führende Experte ist, aber man darf vermuten, dass es sich wohl nicht um Paläoarchäologie handelt.
† Jeder hat Diabetes! Jeder hat Asthma! Jeder hat Allergien! Jeder hat Zöliakie!
* Viele dieser Gruppen wurden bisher in ihrer Gesamtheit als die San (wörtlich „jene, die etwas vom Boden auflesen“, aber mit abwertenden Assoziationen) oder „Buschleute“ des südlichen Afrikas bezeichnet, aber es besteht eine große linguistische und kulturelle Vielfalt in dieser vereinfachenden Gruppierung.
* Meine Kollegin und ehemalige Bürogenossin Laura Buck erfreute mich über mehrere Monate mit ethnografischen Belegen für den Verzehr von Rentiermagen, lehnte aber unerklärlicherweise meinen Vorschlag für die Artikelüberschrift („Rentierbäuche und die Neandertaler, die sie liebten“) ab.
* Dieses Zitat und weitere Informationen zur Entwicklung der Archäobotanik sind auf Professor Dorian Fullers Website zu finden: https://sites.google.com/site/archaeobotany/
* Lose allerdings, mit viel Revision und weitaus weniger Revolution.
† Das ist vielleicht die simplifizierendste Beschreibung der marxistischen Theorie in der Geschichte der Archäologie; allen, die mehr über Childes Marxismus und seinen Einfluss auf die Archäologie erfahren möchten, empfehle ich wärmstens Randall McGuires 2006 erschienenen Artikel „Marx, Childe, and Trigger“ in: The Works of Bruce G. Trigger: Considering the Contexts of His Influences.
* Allerdings lässt sich gemäß den anspruchsvollen wissenschaftlichen Forschungsarbeiten des Nobelpreisträgers George W. Beadle daraus Popcorn herstellen.
* Wie Dorian Fuller in seinem 2014 in Nature erschienenen Artikel „Domestication: The birth of rice“ schrieb: „Niemand spricht von den Eicheln.“
* Die vielen verschiedenen Kulturen, die im zentralen Teil und im Südosten der heutigen USA überall beeindruckende Erdbauten hinterließen, die von vor 5000 Jahren bis zur Kontaktperiode im 16. Jahrhundert datieren.
* Ein Großteil dieser Forschungsarbeiten findet sich im 2011 erschienenen Buch Human Bioarchaeology of the Transition to Agriculture, herausgegeben von R. Pinhasi und J. T. Stock.
* Und vermutlich auch weitaus weniger Zahnärzte.
* Und sogar Werkzeuggebrauch – in einer Welt vor der Erfindung der Tischklemme wurden Zähne oft als dritte Hand missbraucht.
† Das ist übrigens heute noch so: Steingemahlenes Mehl enthält immer noch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Steinmehl aus dem Mahlprozess.
* Kariesbakterien werden gewöhnlich direkt an einen Säugling übertragen – vorgekautes Essen und mütterliche Zuneigung sind hier die Hauptschuldigen.
* Jeder, dem schon einmal ein Stück Zahn herausgebrochen ist, wird sich dieser Tatsache schmerzlich bewusst sein.
† Sollten die Betreuer meiner Doktorarbeit je über diese Passage stolpern, erwarte ich umgehend Meldungen über spontane Selbstentzündungen eminenter physischer Anthropologen.
‡ Und in mehreren Reihen, wie beim Hai: Die Milchzähne beginnen vor der Geburt zu wachsen, die Weisheitszähne sind im Alter von etwa 15 Jahren ausgewachsen. Das Stadium dazwischen, wenn beide Zahnsätze in gewissem Umfang vorhanden sind, sieht auf Röntgenbildern wirklich Angst einflößend aus.
* Vor allem die Verwegenen, die Bücher für die breite Öffentlichkeit schreiben.
* Ganz zu schweigen von langsam. Ich brauchte einmal fast 30 Minuten, um das kleine Dorf Kıyılkaya in der Nähe der Stätte zu durchqueren; schuld waren mehrere Staus, die durch Kühe, Kuhhirtinnen, Gänse, Eseltreiberinnen auf der Spur der Kühe, Hühner, Frauen auf den Spuren der Eseltreiberinnen, Hunde und, etwa 2 Meter vor dem Tor, die unmotivierteste Schildkröte der Welt verursacht wurden.
† Das klingt vielleicht nach einer Beschreibung für eine bestimmte Art von Dorfkneipe, aber die Dekoration ist tatsächlich etwas apokalyptischer – beispielsweise gibt es ein Wandbild eines ausbrechenden Vulkans.
* Eventuell habe ich dabei versehentlich eine 9000 Jahre alte Mauer zerstört.
* Das ist mein Buch. Er kann in seinem eigenen Buch behaupten, der Bessere zu sein.
* Gemäß dem ursprünglichen Konzept war dies in der Regel das British Empire. Gelegentlich allerdings auch das französische. Niemand, aber auch wirklich niemand hat dieses Konzept je zur Beschreibung einer Welt mit Reality-TV benutzt.