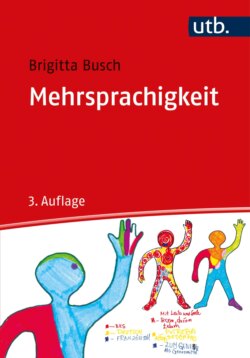Читать книгу Mehrsprachigkeit - Brigitta Busch - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVorwort
zur dritten Auflage
Als Frau Kruse vom Verlag facultas/utb gefragt hat, ob ich mir vorstellen könne, das Buch Mehrsprachigkeit im Hinblick auf eine dritte Auflage zu aktualisieren, habe ich einen Moment lang gezögert. Auf der einen Seite stand die Freude, dass das Buch auch nach acht Jahren im ganzen deutschen Sprachraum weiterhin nachgefragt und verwendet wird, auf der anderen der Zweifel, ob es von seiner Grundstruktur und Orientierung her den Erwartungen, die heute an ein wissenschaftliches Fachbuch zu Mehrsprachigkeit gestellt werden, noch gerecht zu werden vermag. Ich glaube, es kann. Der seinerzeit gewählte multiperspektivische Zugang zum Thema erlaubt es nicht nur, dieses von verschiedenen Seiten her zu beleuchten – mit Fokus einmal auf handelnde und erlebende Subjekte, dann auf verfestigte Diskurse und Sprachideologien und schließlich auf räumlich und zeitlich situierte Praktiken –, sondern ermöglicht es auch, das Blickfeld in verschiedene Richtungen auszuweiten. Letzteres war aus mehreren Gründen notwendig. Die Mehrsprachigkeitsforschung ist in diesen Jahren nicht stehen geblieben, Teilgebiete wie Familiensprachpolitik, Raciolinguistics, visuelle Methoden oder Forschung zu International Sign sind vermehrt ins Blickfeld gerückt und haben sich als eigenständige Forschungszweige etabliert. Eine junge Generation von Wissenschafter*innen ist auf die Bühne getreten, die neue Sichtweisen einbringt und andere Schwerpunkte setzt, etwa zur Rolle von Sprache in Prozessen wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und kultureller Umformungen, die mit Begriffen wie Neoliberalismus oder Spätkapitalismus nur unzulänglich erfasst [5] werden können. Und schließlich hat mich meine eigene Arbeit auf Basis dessen, was bereits in der ersten Auflage dieses Buches angelegt war, zu neuen Fragestellungen herangeführt, so zum Beispiel zur Frage nach sprachlichen und nichtsprachlichen Formen der Darstellung traumatischer Erfahrungen.
Um diesen Umständen Rechnung zu tragen, habe ich nach einer kritischen Relektüre des Buches eine Reihe von Aktualisierungen in Bezug auf neuere Entwicklungen und Literaturhinweise vorgenommen. Darüber hinaus lassen sich einige neue Passagen zu Themen finden, die in den bisherigen Auflagen nicht oder aus heutiger Sicht unzulänglich behandelt wurden. Dies betrifft unter anderem Abschnitte zur Positionierungstheorie, zu Gebärdensprachen, zu migrations- und sprachenpolitischen Neuausrichtungen unter dem Vorzeichen sogenannter Sicherheitspolitiken, zu Alltagspraktiken der Mediennutzung, zu Sprachregimen in urbanen Räumen und in der Arbeitswelt sowie zum Themenkomplex ‚sprachliche Diversität und Bildung‘.
Danken möchte ich an dieser Stelle allen Kolleg*innen, die mir durch ihr Feedback auf das Buch geholfen haben, Stellen zu identifizieren, die einer Vertiefung bedurften, sowie dem Verlag facultas/utb, namentlich Frau Kruse, für die Betreuung des Projekts und Frau Hauser für das engagierte und sorgfältige Lektorat.
Ich hoffe, dass dieses Buch ein brauchbares Werkzeug bleibt, nicht nur im Hinblick auf das Studium von Phänomenen sprachlicher Vielfalt, sondern auch im Hinblick auf die notwendige Auseinandersetzung mit Politiken, die darauf abzielen, gesellschaftliche Ungleichheiten und Ausschlüsse mit ‚Sprache‘ zu begründen und über Sprache auszutragen.
Wien, im April 2021
Brigitta Busch [6]