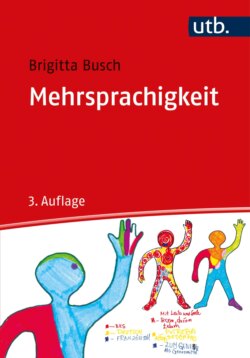Читать книгу Mehrsprachigkeit - Brigitta Busch - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEinleitung
Mehrsprachigkeit ist von einem Randthema zu einem zentralen Thema geworden, sowohl gesellschaftlich-politisch als auch wissenschaftlich betrachtet. Lange Zeit wurde Einsprachigkeit als Normalfall angesehen, Zweioder Mehrsprachigkeit – ob es um einzelne Sprecher*innen, Regionen oder Länder ging – als Sonderfall. Angesichts weltweiter wirtschaftlicher Verflechtungen und politisch-räumlicher Neukonfigurationen, angesichts weitverbreiteter Mobilität, Migration und Teilnahme an transnationalen Kommunikationsnetzwerken, also angesichts von Phänomenen, die unter dem Stichwort ‚Globalisierung‘ zusammengefasst werden, wird Mehrsprachigkeit immer mehr als Teil der Alltagsrealität wahrgenommen.
Der Titel dieses Buchs – Mehrsprachigkeit – beschreibt also ein Alltagsphänomen. Er klingt einfach und zugleich etwas vermessen, denn die Mehrsprachigkeitsforschung hat sich im letzten Jahrzehnt international gesehen zu einem bedeutenden und ständig wachsenden Feld wissenschaftlicher Tätigkeit entwickelt. Das Buch erhebt nicht den Anspruch, einen ausgewogenen Überblick über dieses verästelte und nahezu unüberschaubar gewordene Feld zu geben, in dem sich nicht nur Soziolinguistik, Sprachlehr- und -lernforschung, Psycholinguistik, Neurolinguistik und andere Zweige der Sprachwissenschaft bewegen, sondern darüber hinaus auch andere Disziplinen wie Literaturwissenschaft, Soziologie, Kultur- und Sozialanthropologie oder Politikwissenschaft. Wohl aber sollen in diesem Buch aktuelle Themen, Entwicklungen und Tendenzen in der Mehrsprachigkeitsforschung zur Sprache kommen. [9]
Behandelt werden Konzepte wie Sprachrepertoire, Sprachideologien oder lokale Sprachregime, die vor allem für sprachwissenschaftlich geschulte oder interessierte Leser*innen von Interesse sein werden. Die Kapitel zu Methoden greifen vor allem neuere Zugänge auf. Dazu zählen die biografisch orientierte Forschung oder visuelle Methoden wie Linguistic Landscape oder kreative wie das Zeichnen von Sprachenporträts. Diese Kapitel richten sich über den Kreis von Studierenden der Sprachwissenschaft hinaus auch an solche benachbarter Studienrichtungen wie Philologien, Bildungswissenschaft oder Sozialwissenschaften. Die Darstellung der Themen erfolgt anhand konkreter Beispiele, die sowohl auf meine eigene Forschungspraxis in Österreich, Südosteuropa und Südafrika als auch auf internationale Literatur zurückgreifen. Damit soll das Buch über weite Strecken auch für Leser*innen zugänglich sein, die an Fragen der Mehrsprachigkeit interessiert sind, aber nicht unbedingt über spezifisches Fachwissen verfügen.
Das Buch führt die Lesenden an verschiedene Orte, zum Beispiel in Volksschulen in einem Wiener Gemeindebezirk und einem Arbeiterviertel von Kapstadt, in den Schalterraum der Einwanderungsbehörde in Barcelona oder in eine zweisprachige Gemeinde in Südkärnten. Es lädt dazu ein, sich an diesen verschiedenen Orten mit den Wirkungsmechanismen von Sprachideologien zu beschäftigen: So wird anhand des Asylverfahrens danach gefragt, was geschieht, wenn Sprecher*innen mit einem multilingualen Repertoire auf Institutionen mit einer monolingualen Routine treffen, und es wird gezeigt, wie Sprachtests in den Dienst von Abschottungspolitiken gestellt werden. Am Beispiel von Südosteuropa wird offengelegt, wie aus einer Sprache drei, dann vier wurden, und am Beispiel der österreichischen Statistik, wie aus mehrsprachigen Sprecher*innen einsprachige werden. Und das Buch macht mit Menschen bekannt: Sie erzählen davon, wie sie Ausschluss aufgrund von Sprache erfahren haben, weil sie vom Dorf in die Stadt umgezogen sind; oder davon, wie sie unter Sprachverlust und Sprachwechsel gelitten haben, nachdem sie aus ihrem Land vertrieben wurden; auch davon, wie sie damit umgehen, mit einem Bein in Frankreich und einem in Deutschland zu stehen; oder davon, wie sie ihre sprachlichen Ressourcen spielerisch und kreativ einsetzen.
Essenzialisierende Konzepte von Sprache und Mehrsprachigkeit werden dabei stets einer kritischen Prüfung unterzogen. Demgegenüber stellt das Buch den sprechenden Menschen bzw. das multilinguale Subjekt in den Mittelpunkt, arbeitet die soziale und diskursive Konstruiertheit sprachlicher Kategorien heraus und betrachtet sprachliche Praktiken [10] in unterschiedlichen sozialen Kontexten. Diesen Schwerpunktsetzungen folgend gliedert sich das Buch in drei Teile, welche Mehrsprachigkeit aus der Subjekt-, der Diskurs- und der Raumperspektive in den Blick nehmen.
Zweisprachigkeit, Mehrsprachigkeit, Diversität, Heteroglossie
Mehrsprachigkeit – der Begriff ist nicht ganz unproblematisch und wird innerhalb der angewandten Sprachwissenschaft zunehmend kritisch hinterfragt. Lange Zeit wurde die Beschäftigung mit Mehrsprachigkeit vor allem ausgehend vom englischen Sprachraum unter dem Begriff ‚Bilingualismus-Forschung‘ zusammengefasst, womit die Zweisprachigkeit als Sonderfall von der als Normalfall betrachteten Einsprachigkeit abgegrenzt wurde. Manche benützten in der Folge auch den Begriff ‚Trilingualismus‘, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass oft mehr als zwei Sprachen im Spiel sind. Um die Reihenfolge des Spracherwerbs oder Hierarchisierungen im individuellen sprachlichen Repertoire zu bezeichnen, hat man Begriffe und Abkürzungen wie Erstsprache, Zweitsprache, L1, L2, L3, Ln eingeführt. Das impliziert die Annahme, dass Sprachen klar voneinander abgrenzbar und somit zählbar seien.
Seit einigen Jahren wird in der angewandten Sprachwissenschaft darüber diskutiert, wie aus der Perspektive des Fachs Sprache gefasst und verstanden werden kann. Hinterfragt wird dabei vor allem die Vorstellung von Sprachen als voneinander klar abgegrenzte Entitäten, also die Annahme, dass Sprachen wie etwa Deutsch, Englisch, Russisch im Gebrauch trennscharf unterschieden werden können, was letztlich Auswirkungen auf damit verbundene soziale Zuschreibungen und Abgrenzungen hat (Makoni und Pennycook 2007). Geht man von konkreten sprachlichen Praktiken aus und nimmt eine Sprecher*innenperspektive ein, so kann Sprache nicht als etwas Objekthaftes verstanden werden. Im englischsprachigen Raum wird daher von einigen Autor*innen der Begriff languaging dem Wort language vorgezogen, um das Dynamische und Prozesshafte sprachlicher Hervorbringungen zu unterstreichen (z. B. García 2009).
„Es ist unmöglich, die Sprachen abzuzählen“, gibt Jacques Derrida (1997: 25) zu bedenken. Und er führt weiter aus: „Es gibt keine Abzählbarkeit [comptabilité] der Sprachen, weil die Einheit der Sprache, die sich aller arithmetischen Abzählbarkeit entzieht, niemals bestimmt ist.“ Tatsächlich kommt man, wenn man sich mit konkreten sprachlichen Praktiken, mit Sprache in der Interaktion auseinandersetzt, nicht umhin, sprachliche [11] Differenz und Differenzierung als Ausgangspunkt anzunehmen. Diese sprachliche Vielfalt umfasst eine ganze Bandbreite sprachlicher und kommunikativer Ressourcen – verschiedene Varietäten, Register, Jargons, Genres, Akzente, Stile, mündlich wie schriftlich –, die sich teilweise einem Sprachsystem, teilweise einem anderen zuordnen ließen, teilweise auch mehreren oder keinem. Sprecher*innen bewegen sich in ihrem Alltag gewöhnlich sicher, und ohne sich dessen bewusst zu werden, in dieser komplexen Vielfalt: Sie greifen auf unterschiedliche sprachliche Ressourcen zurück, die beispielsweise für ein kurzes Gespräch auf der Straße auf eine regional gefärbte Umgangssprache verweisen, auf Lingua-franca-Englisch, wenn sie einem Touristen den Weg erklären, auf ein fachsprachliches Register, um über ein Problem am Arbeitsplatz zu sprechen, auf eine literarisch ausgeprägte Standardsprache, wenn sie einen Roman lesen. Jede dieser Arten des Sprachgebrauchs nimmt Bezug auf unterschiedliche sozialideologisch geprägte Diskurse, sie greift auf unterschiedliche individuelle Stimmen zurück und bedient sich sprachlicher Mittel, die auf unterschiedliche geografische, soziale und historische Kontexte verweisen (siehe Kapitel 1.2). Mit der Orientierung auf Redevielfalt stützt sich das Buch auf grundlegende Arbeiten des russischen Literatur- und Sprachwissenschafters Michail Bachtin aus den 1930er Jahren, der mit seinem Konzept der Heteroglossie die Vorstellung in Frage stellt, Sprachen als in sich geschlossene, einheitliche Systeme zu betrachten. Die einheitliche Sprache ist nicht etwas Gegebenes [dan], sagt Bachtin (1979: 164), sondern etwas, das vorgegeben oder vorgeschrieben wird [zadan], und sie steht immer im Gegensatz zur Realität der Heteroglossie, zur „tatsächlichen Redevielfalt“.
Der Begriff ‚Heteroglossie‘ bezeichnet die vielschichtige und facettenreiche Differenzierung, die lebendiger Sprache innewohnt. Bachtin folgend (Todorov 1984: 56) ist es sinnvoll, in der Beschäftigung mit sprachlichen Praktiken in multilingualen Kontexten den Begriff in drei Richtungen zu differenzieren: Multidiskursivität [raznorečie] meint, dass in jedem Sprechen Verweise auf verschiedene Räume und Zeiten enthalten sind, die auf unterschiedliche Weise sozialideologisch konstituiert sind. Jede dieser Zeiten – bestimmte Epochen, Perioden oder Tage – und jeder dieser Räume – Staaten, Altersgruppen, Familien oder Szenen – ist verbunden mit spezifischen Weltsichten und Diskursen. Vielstimmigkeit [raznogolosie] meint, dass wir uns im Sprechen gegenüber diesen Welten, Weltsichten und Diskursen positionieren und dass wir uns dafür die Stimmen anderer sozusagen ,ausborgen‘ und als Stile zu eigen machen. Sprachenvielfalt [raznojazyčie] meint, dass sich Spuren soziokultureller Differenzierung in [12] der Sprache auffinden lassen. Durch unterschiedliche Positionierungen bilden sich unterschiedliche Arten des Sprechens heraus. Man hat es nicht mit einer Sprache, sondern mit Sprachenvielfalt zu tun, mit einem „Dialog von Sprachen“ (Bachtin 1979: 186), egal ob sich dieser Dialog innerhalb dessen abspielt, was man als eine Sprache bezeichnet, oder zwischen solchen, die „zueinander Kontakt aufgenommen und einander erkannt haben“ (ebd.). Wenn in diesem Buch also von Mehrsprachigkeit die Rede ist, so ist damit nicht eine Vielzahl von Einzelsprachen gemeint, sondern ein Konglomerat, das in Bachtins Sinn heteroglossisch ist.
Zum Aufbau dieses Buches: drei Perspektiven auf Mehrsprachigkeit
Häufig wird in der Mehrsprachigkeitsforschung zwischen individueller und gesellschaftlicher Mehrsprachigkeit unterschieden, wobei die eine eher von der Psycholinguistik, die andere eher im Rahmen der Soziolinguistik behandelt wird. In diesem Buch wähle ich einen Zugang, der nicht auf einer Gegenüberstellung Individuum – Gesellschaft basiert, sondern der es ermöglicht, an den Gegenstand etwas anders heranzugehen. Praktiken der Mehrsprachigkeit bzw. des Umgangs mit gesellschaftlicher Heteroglossie werden von drei Seiten her beleuchtet: (1) von der des erlebenden, sprechenden und agierenden Subjekts, das mit anderen interagiert; (2) aus der Perspektive von Diskursen, durch die das Subjekt als erlebendes, sprechendes, agierendes positioniert wird und denen gegenüber es sich positioniert; und (3) aus der von Räumen, eigentlich Raum-Zeiten, in denen sich kommunikative Praktiken etablieren und situierte Interaktionen stattfinden.
Im ersten Teil werden Konzepte von Spracherleben und Sprachrepertoire diskutiert, wobei nicht nur die historisch-politische Dimension des Repertoires, sondern auch die leiblich-emotionalen Dimensionen von Spracherleben, die bisher weniger Beachtung gefunden haben, hervorgehoben werden. Theoretisch bezieht sich das Kapitel auf Judith Butlers Konzept von Performativität und auf Maurice Merleau-Pontys phänomenologische Annäherung an Leib, Emotion und Sprache. Besonderes Augenmerk liegt in diesem Teil auf sprachbiografischen Zugängen, die in den letzten Jahren zunehmend Verbreitung finden. Für dieses relativ neue Gebiet werden methodologische Erwägungen angestellt und es werden praktische Anregungen zum sprachbiografischen Arbeiten gegeben. Zwei Kapitel werden dem Aufwachsen mit und dem Leben in mehreren Sprachen gewidmet; besprochen werden dabei unter anderem Themen wie [13] Gebärdensprachen oder Mehrsprachigkeit im Alter. Der erste Teil schließt mit der Besprechung sprachbiografischer Darstellungen, einem autobiografischen literarischen Text sowie einem Sprachenporträt, die zeigen, wie sich Spracherleben und Sprachideologien im sprachlichen Repertoire niederschlagen.
Am Anfang des zweiten Teils stehen Zugänge zu Sprachideologien, wie sie zuerst in der linguistischen Anthropologie entwickelt wurden. Ergänzt werden diese eher theoretischen Überlegungen durch einen Exkurs zum Verhältnis Ideologie–Diskurs, in dem philosophische bzw. sprachphilosophische Positionen von Valentin Vološinov, Antonio Gramsci, Louis Althusser und Michel Foucault angerissen werden. Die Wirkungsmacht von Sprachideologien bzw. Diskursen über Sprache und Sprachlichkeit wird dabei anhand der folgenden Fallbeispiele veranschaulicht: Zensuserhebung und Statistik, Schaffung und Implementierung von Nationalsprachen, (post-)koloniale Sprachenpolitiken, Integration-durch-Sprache-Diskurse sowie Minderheitensprachen und Sprachenrechte.
Der dritte Teil beginnt mit Überlegungen zur Rekonfiguration sprachlicher Räume im Zusammenhang mit Prozessen der Globalisierung. Entwickelt wird ein Konzept räumlicher Sprachregime, das sich an die Raumtheorie von Henri Lefebvre anlehnt und am Beispiel der Polarität Deutsch–Slowenisch in Kärnten erläutert wird. Es folgt ein kurzes methodisches Kapitel zur Exploration von Sprache im Raum. Die Frage, wie Organisationen mit Mehrsprachigkeit umgehen, wird in Kontexten wie Administration, Rechts- und Gesundheitswesen besprochen, wobei dem Community-Dolmetschen spezielle Aufmerksamkeit zukommt. Den Abschluss bildet ein Kapitel zu Mehrsprachigkeit und Schule aus einer räumlichen Perspektive. Im Einzelnen geht es um das Erheben von Schulsprachprofilen, um verschiedene Modelle bilingualen Unterrichts und schließlich um Heteroglossie als pädagogisches Prinzip. [14]