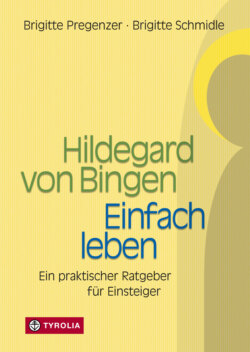Читать книгу Hildegard von Bingen – Einfach Leben - Brigitte Schmidle - Страница 7
Das Leben der heiligen Hildegard von Bingen
Оглавление1098 wird Hildegard als zehntes Kind des Grafen Hildebert und seiner Frau Mechthild von Bermersheim im Rheinland geboren.
Sie hat von Kindheit an die so genannte »Schau« (Ahnung von bevorstehenden Ereignissen), hält aber ihr Wissen mehr und mehr zurück, da sie Unverständnis und Furcht bemerkt.
Hildegard ist von Natur aus schwächlich und oft krank – aber genau deshalb ist sie glaubwürdig in ihrem Bestreben, ganzheitlich gesund zu werden.
1106 wird sie gemäß der herrschenden Tradition als »Zehent« dem Kloster sozusagen als Dank überlassen.
Sie kommt unter die Obhut von Jutta von Sponheim und erhält eine für die damalige Zeit umfassende Ausbildung.
Die einzigen Bildungsstätten zu jener Zeit sind die Klöster. Frauen haben überdies keine andere Möglichkeit sich Wissen anzueignen. Zudem dürfen nur Adelige ins Kloster gehen, die sich auf diese Art auch oft einen Platz als »Rentenversicherung« erkaufen. Die Klöster sind auf die finanzielle Unterstützung der Adeligen angewiesen. So erst wird Studium und Forschung im damaligen Sinn möglich.
Klöster sind aber auch Anlaufstellen für Reisende, für Schutzsuchende und das »gemeine« Volk, wenn es um medizinische Belange geht.
Jutta von Sponheim – eine kluge, gebildete Frau und mütterliche Freundin von Hildegard – ist Äbtissin in der Frauenklause des Klosters Disibodenberg. Sie unterrichtet ihre Zöglinge in Schreiben und Lesen, im Singen der Psalmen und in praktischen Arbeiten.
1136 stirbt Jutta von Sponheim und hinterlässt eine blühende Klause bzw. ein stattliches Benediktinerkloster.
Hildegard wird von ihren Mitschwestern einstimmig zur neuen Äbtissin gewählt, obwohl sie oft kränkelt. Aber ihr Wesen, das als demütig und bescheiden beschrieben wird, muss eine immense Ausstrahlung besessen haben.
Hildegard ist 38 Jahre alt, als sie das schwere Amt antritt.
1141, nachdem sie fünf Jahre als Äbtissin gewirkt hatte, erhält sie von Gott den Auftrag, ihre Visionen niederzuschreiben. In ihrer Demut will sie diesen Ruf nicht annehmen und erkrankt wieder einmal schwer, möglicherweise aus Angst, dem göttlichen Ruf nicht gerecht zu werden, sich gegen Gott zu versündigen oder aus Furcht vor den Reaktionen des Klerus. Jedenfalls kann man nachfühlen, dass Hildegards Begabung mehr Belastung als Freude war.
Als sie sich entschließt, ihre Visionen niederzuschreiben, gesundet sie sofort und beginnt mit ihrem ersten großen Werk: »SCIVIAS« – »Wisse die Wege«.
Als Kostprobe der damaligen Sprache und zur Erläuterung ihrer Schau ein kurzes Zitat:
»Im Jahre 1141 der Menschwerdung Christi, des Gottessohnes, als ich zweiundvierzig Jahre und sieben Monate alt war, kam ein feuriges Licht mit Blitzesleuchten vom offenen Himmel hernieder. Es durchströmte mein Gehirn und durchglühte mir Herz und Brust gleich einer Flamme, die jedoch nicht brannte, sondern wärmte, wie die Sonne einen Gegenstand erwärmt, auf den sie ihre Strahlen legt. Nun erschloss sich mir plötzlich der Sinn der Schriften, des Psalters, des Evangeliums und der übrigen katholischen Bücher des Alten und Neuen Testaments …«
Ihre Visionen hat sie immer in wachem Zustand. Sie sind mystischen Ursprungs, entstehen aus einem geistigen Dialog mit Gott.
In einem Antwortbrief an den Mönch Wibert von Gembloux, der sich sehr für ihre Niederschriften interessiert, schreibt sie viele Jahre später:
»Von meiner Kindheit an erfreue ich mich der Gabe dieser Schau in meiner Seele bis zur gegenwärtigen Stunde, wo ich doch schon mehr als siebzig Jahre alt bin.
Und meine Seele steigt – wie Gott will – in dieser Schau empor bis in die Höhe des Firmaments.
Ich sehe aber diese Dinge nicht mit den äußeren Augen und höre sie nicht mit den äußeren Ohren, auch nehme ich sie nicht mit den Gedanken meines Herzens wahr, noch durch irgendwelche Vermittlungen meiner fünf Sinne. Ich sehe sie vielmehr einzig in meiner Seele, mit offenen leiblichen Augen, so, dass ich dabei niemals die Bewusstlosigkeit einer Ekstase erleide, sondern wachend schau ich dies, bei Tag und Nacht.«
»Das Licht, das ich schaue, ist nicht an den Raum gebunden. Es ist viel, viel lichter als eine Wolke, die die Sonne in sich trägt. Weder Höhe noch Länge noch Breite vermag ich an ihm zu erkennen. Es wird mir als der ‚Schatten des lebendigen Lichtes‘ bezeichnet. Und wie Sonne, Mond und Sterne in Wassern spiegeln, so leuchten mir Schriften, Reden, Kräfte und gewisse Werke der Menschen in ihm auf …
Alles, was ich in der Schau sehe und lerne, das behalte ich lange Zeit in meinem Gedächtnis, wie, sobald ich es sehe oder höre, es in mein Gedächtnis eingeht. Ich sehe, höre und weiß gleichzeitig, und wie in einem Augenblick erlerne ich das, was ich weiß. Was ich aber nicht sehe, das weiß ich nicht, denn ich bin ungelehrt und wurde nur unterwiesen, in Einfalt Buchstaben zu lesen …«
»In diesem Licht sehe ich zuweilen, aber nicht oft, ein anderes Licht, das mir das ‚lebendige Licht‘ genannt wird. Wann und wie ich es schaue, kann ich nicht sagen.
Aber solange ich es sehe, wird alle Traurigkeit und alle Angst von mir genommen, so dass ich mich wie ein junges Mädchen fühle und nicht wie eine alte Frau …«
Nahtod-Berichte und Grenzerfahrungen zeugen ebenfalls immer von einem hellen Licht und einem unbeschreiblichen Wohlbefinden. Wer diesen Berichten Glauben schenkt, kann auch Hildegards Visionen problemlos annehmen. Wem Hildegards Visionen suspekt erscheinen, der sollte jedoch bedenken, dass ihre Anleitungen immer wieder wirken.
An diesem großen Werk »SCIVIAS« und den aufwendigen Bildtafeln arbeitet sie zehn Jahre lang. Der Mönch Volmar vom Disibodenberg wird bis zu seinem Tod ihr Sekretär und treuer Freund. Zu dieser Zeit tritt Richardis von Stade ins Kloster ein und die beiden Frauen verbindet eine lebenslange innige Beziehung. Die Familie von Stade wiederum ist mit ihrem weltlichen Einfluss sehr hilfreich für Hildegard.
Ihre Begabungen und Visionen werden bekannt und bringen ihr nicht nur Freude und Freunde ein. Neid und Missgunst (warum wird ausgerechnet eine Frau mit wenig Bildung von Gott auserwählt?) begleiten sie ebenso wie Freude und Begeisterung.
1147 anerkennt Papst Eugen III. während der Synode in Trier ihre Sehergabe als echt.
Da ihre Klostergemeinschaft ständig wächst und sie – sei es Wunsch oder Vision – ein eigenes unabhängiges Kloster gründen will, bittet sie den Abt vom Disibodenberg um Erlaubnis.
Das Stammkloster ist nicht erfreut, da durch Hildegard ein reger Zulauf zum Kloster entstanden ist und zahlreiche Spenden eingehen.
Nach einem anfänglichen »Nein« erkrankt Hildegard einmal mehr und als der Abt schließlich einwilligt – vielleicht nach dem Motto »Besser eine weit entfernte Äbtissin als gar keine« –, gesundet sie und zieht mit ihren Schwestern an den dreißig Kilometer entfernten Rupertsberg.
1150 gründet sie dort das gleichnamige und eigenständige Kloster.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten wächst die Gemeinschaft intensiv und das »Sprachrohr Gottes«, als das sie sich mittlerweile selbst bezeichnet, wird immer mehr zur Mahnerin und Lehrerin für die Persönlichkeiten ihrer Zeit und für die einfachen Leute, die in ihrem Kloster beraten, betreut und gesund gepflegt werden.
1151–1158: In dieser Zeit schreibt Hildegard zwei weitere Werke: »PHYSICA« – »Heilkraft der Natur« und »CAUSAE ET CURAE« – »Ursachen und Behandlung von Krankheiten«.
1158–1163: In diesem Zeitraum entsteht das »LIBER VITAE MERITORUM«, das Buch der Lebensverdienste, bekannt als »Der Mensch in der Verantwortung«. Gleichzeitig unternimmt sie Predigtreisen ins Frankenland, nach Lothringen und ins Rheinland.
Dies ist deshalb hervorzuheben, da es für Frauen damals völlig unüblich war, öffentlich Reden zu halten. Auf Marktplätzen appelliert sie an das Volk, die Liebe zu Gott nicht zu verlieren, zumal das Schisma (= Kirchenspaltung) damals eine zusätzliche Bedrohung für den Glauben darstellte.
1163 entsteht »LIBER DIVINORUM OPERUM«, das Buch vom Wirken Gottes, auch bekannt unter »Welt und Mensch«.
Während all der Zeit ist sie als Äbtissin, Mahnerin und Korrespondentin aktiv. Von ihrem regen Briefwechsel mit Adel und Klerus sind rund 300 Briefe erhalten geblieben. In der spärlichen Freizeit komponiert sie 77 Lieder und ein Singspiel. Sie wagt sich an eigene Klangbilder heran und beschreitet für damalige Verhältnisse völlig neue Wege. Sie empfiehlt das Singen und Musizieren zum »Stimmen der Seele«, denn nur eine gut gestimmte Seele diene zur Freude Gottes.
1164: Hildegard gründet auf der anderen Seite des Rheins bei Rüdesheim das Kloster Eibingen. Diese zweite Klostergründung wird notwendig, da der Rupertsberg einen immensen Zuwachs erfährt.
Sie fährt zwei Mal pro Woche über den Rhein, um in beiden Klöstern nach dem Rechten zu sehen. (Das nur noch teilweise erhaltene Kloster Eibingen ist das einzige, in dem heute ein Museum untergebracht ist.)
1178 wird das »Interdikt« (= Verbot kirchlicher Amtshandlungen) über das Kloster am Rupertsberg verhängt, weil Hildegard einen exkommunizierten Adeligen auf dem Klosterfriedhof beerdigen lässt. Als sie sich weigert, ihn exhumieren zu lassen, kommt es zu dieser schwerwiegenden Strafe.
Für ein Kloster war es die größte Strafe überhaupt, keine Gottesdienste mehr feiern, keine Sakramente empfangen und keine Loblieder mehr singen zu dürfen.
Sie gibt nicht nach und schreibt einmal mehr an den Klerus, sich seiner eigentlichen Aufgaben zu besinnen.
1179: Am Anfang dieses Jahres wird das Interdikt schließlich wieder aufgehoben.
Am 17. September 1179 stirbt Hildegard. An ihrem Todestag ist Berichten zufolge ein großes helles Kreuz am Himmel zu sehen.
Am 7. Oktober 2012 erhebt Papst Benedikt XVI. die heilige Hildegard zur Kirchenlehrerin.