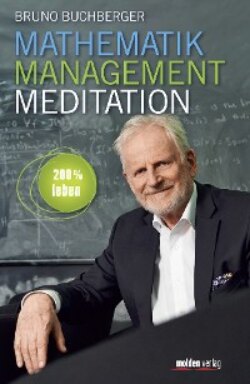Читать книгу Mathematik – Management – Meditation - Bruno Buchberger - Страница 7
DIE GRÖBNER-BASEN
DANKE FÜR EINE HARTE NUSS!
ОглавлениеIn der internationalen Mathematik sind Sie durch die Erfindung der Theorie der sogenannten „Gröbner-Basen“ bekannt. Wie sind Sie auf die Gröbner-Basen gekommen?
Ich hatte das unverschämte Glück, dass ich – als Werkstudent – auf der verzweifelten Suche nach einem Dissertationsthema 1964 von Professor Wolfgang Gröbner1 auf ein Problem gestoßen wurde, das seit 1899 offen war.2 Die Wichtigkeit und Schwierigkeit des Problems, den Umstand, dass es schon so lange ungelöst war, und dass er selbst schon 25 Jahre immer wieder an dem Problem arbeitete, hatte Gröbner mir verschwiegen. Aus heutiger Sicht war für mich beides ein Glück: dass das Problem wichtig war und dass ich nicht wusste, wie lange es schon offen war. Sonst hätte ich mich als junger Student, der nicht in akademischen, sondern in bescheidenen Kreisen aufgewachsen war, vielleicht so einschüchtern lassen, dass ich schon von vornherein aufgegeben hätte. So aber war ich unter dem Druck, zu studieren und gleichzeitig zu arbeiten, gierig darauf, das Problem möglichst bald hinter mich zu bringen.
Die Zeit der Arbeit an diesem Problem war für mich kein Honiglecken. Ich arbeitete Vollzeit als Programmierer am ersten Computer der Universität Innsbruck (einer ZUSE Z23) und in der „freien Zeit“ an meiner Dissertation. Freilich bemerkte ich bald, dass das Problem schwierig war, und ich war oft der Verzweiflung nahe, dass ich offensichtlich zu dumm war für ein so „leicht zu formulierendes“ Problem. Auch hatte ich kaum eine positive Rückkopplung vonseiten Professor Gröbners, der eine Vielzahl von Dissertanten betreute. Ich hätte sehr forsch sein müssen, um öfter bei ihm vorsprechen zu können. Er war im Prinzip ein sehr freundlicher Herr, aber eben ständig umlagert von einem Schwarm von Assistenten und Studenten. Ich wiederum war sehr schüchtern und habe dann rasch beschlossen, mir den Umweg über das Hin und Her von Sich-in-Erinnerung-Rufen, Terminvereinbarungen, Wiederholungen von Erklärungen etc. zu ersparen und allein auf meine eigene Denkkraft zu vertrauen.
All das war aus heutiger Sicht eine glückliche Fügung. Denn die Lösung des Problems gelang mir dann auf einem ganz anderen Weg als die Wege, die implizit von Gröbner oder in der damaligen Literatur vorgeschlagen wurden. Doch bis zur Lösung war es ein wirklich steiniger Weg: intellektuell, psychisch und auch physisch. Eineinhalb Jahre drehte ich das Problem in meinem Kopf hin und her: auf vielen Seiten Papier, später in ersten Experimenten auf „der ZUSE“3, in den Arbeitspausen, an langen Abenden, an Wochenenden, im Café, beim Gitarrespielen, wenn ich auf den Output der langen Rechnungen auf der ZUSE wartete, am Handtuch im Schwimmbad, im Lesesaal der Universität (wo sich die schönsten Mädchen aufhielten). Dann sah ich plötzlich die „tragenden Fäden“ im Spinnennetz der Polynomideale. Das war ein großes Glücksgefühl und es war nur mehr ein relativ „kurzer“ Schritt (mehrere Monate), bis ich auch den Beweis fertig hatte, dass die tragenden Fäden wirklich tragen und keine anderen Fäden notwendig sind, um das Gesamtnetz zu beherrschen.
Das Glücksgefühl bezog sich hauptsächlich darauf, dass nun bald meine Doppelbelastung durch Studium und Arbeit zu Ende wäre, weniger weil ich dachte, ich hätte etwas Wesentliches gefunden oder geleistet. Im Gegenteil: Ich fand es beschämend, dass ich so lange gebraucht hatte, um das Problem zu lösen. Aber im Geheimen war es auch ein Glücksgefühl, etwas wie die endlichen vielen „wirklich wesentlichen Knoten“ im unendlichen Netzwerk der Polynomreduktionen zu sehen. Ich erinnere mich heute noch an jene Straßenkurve in Innsbruck, wo mir am Weg zur Universität auf dem Rad der entscheidende Gedanke gekommen ist.
Getreu meinem Prinzip, alles allein zu machen, gab ich meine gebundene Dissertation in den Weihnachtsferien 1965 im Dekanat ab, ohne das Resultat vorher noch Gröbner zu zeigen. Aus irgendeinem Grund, den ich bis heute nicht nachvollziehen kann, habe ich dann nach einiger Zeit zwar die Verständigung erhalten, dass meine Dissertation angenommen und ich zum Rigorosum4 zugelassen sei, aber ich habe nie von Gröbner einen persönlichen Kommentar erhalten, dass er das Problem damit als gelöst betrachte oder gar, dass er das prima fände. Ich vermutete damals – und weiß es heute –, dass er meine Dissertation nicht im Detail gelesen, sondern einem Assistenten zur Überprüfung übergeben hatte. Das erscheint nicht sehr nett, aber man muss verstehen, dass Professoren damals wie heute oft mit einer Flut von zu betreuenden Arbeiten konfrontiert sind, sodass nichts übrig bleibt, als die meisten Arbeiten durch Mitarbeiter anschauen zu lassen.
Das hat mich damals dann doch ziemlich frustriert, und ich habe mich deshalb dann einem anderen Gebiet der Mathematik zugewandt, weil ich aus Gröbners Verhalten den Schluss gezogen habe, dass das Ganze schon nicht so wichtig wäre.
Heute ist in den akademischen Studien ja sehr viel reglementiert. Bedauern Sie heute, dass Sie wenig Betreuung erhalten haben?
Auch wenn meine Betreuung nach landläufigen Vorstellungen nicht optimal und in gewisser Weise planlos war und ich psychisch total auf „mach es selbst“ ausgerichtet war, kann ich aus heutiger Sicht sagen, dass ich in gewisser Weise ideal auf mein Dissertationsproblem vorbereitet war.
Ich war in dreifacher Hinsicht vorbereitet:
Durch die zahlreichen Vorlesungen, die ich bei Gröbner kolloquiert hatte, war ich inhaltlich im mathematischen Thema völlig drin.
Zweitens war ich mit dem damaligen formal-logischen Level der Mathematik schon als Student in den ersten Semestern nicht zufrieden (und bin es auch heute nicht) und hatte mir deshalb im Selbststudium wesentliche Inhalte der mathematischen Logik angeeignet, in denen es ja hauptsächlich um das mathematische Denkwerkzeug „Beweisen“ geht. Und ausgefeilte Beweistechnik ist gerade in den abstrakten Gebieten der Mathematik von ausschlaggebender Bedeutung.
Drittens war ich durch meine Arbeit als Programmierer bis zum letzten Bit mit den damaligen Computern vertraut. Und zwar nicht nur mit der praktischen Seite des Programmierens zum Lösen von Problemen in allen Disziplinen, sondern auch mit der grundlegenden logischen Funktionsweise von Computern, die sich ja im Wesentlichen bis heute nicht geändert hat und eine Art „Denkkonstante“ darstellt.
Unabhängig vom mathematischen Resultat in meiner Dissertation war dieses Zusammenspiel von Mathematik, Logik und Computer in meinen Studien- und vor allem Dissertantenjahren mein wichtigster USP für den Rest meines Berufslebens.5 Denn diese „Massage“ des Gehirns und auch der Psyche durch diese drei unterschiedlichen, zum Teil gegensätzlichen und zum Teil zusammenschwingenden Aspekte hat mich später befähigt, auch gesellschaftlich „schräge“ Dinge, die nirgends vorgesehen waren, in kurzer Zeit „vom Punkt null“ auf die Beine zu stellen. So zum Beispiel den Softwarepark Hagenberg, dessen Dynamik genau aus dem Zusammenspiel von Forschung und akademischer Lehre (im Bereich der Mathematik und der Software) und Anwendung, Wirtschaft, Business resultiert.
Bis jetzt haben Sie nur erklärt, was Sie in Ihrer Dissertation gemacht haben, dass das eine ziemlich einsame Ho-ruck-Aktion war und dass Ihr betreuender Professor Gröbner außer bei der Problemstellung kaum erreichbar war. Warum haben Sie die Erfindung in Ihrer Dissertation dann „Gröbner-Basen“ genannt?
Die abstrakten Objekte, die ich in meiner Dissertation eingeführt und später „Gröbner-Basen“ genannt habe, habe ich in meiner Dissertation nicht mit einem Namen verbunden. Es ist auch nicht üblich, dass man neue mathematische Begriffe mit dem Namen eines Mathematikers versieht. Das machen – wenn überhaupt – später Leute, die die neuen Dinge für nützlich befinden. Auch meinen Algorithmus6 zur Berechnung von Gröbner-Basen habe ich natürlich nicht mit einem Namen versehen. Heute wird dieser Algorithmus in der Literatur allerdings als „Buchberger-Algorithmus“ bezeichnet. Dass ich dann – zehn Jahre nach Erfindung – den Namen Gröbner mit den Polynombasen meiner Dissertation verbunden habe, war eine Augenblickseingebung. Und das kam so …
Für meine Erfindung der Gröbner-Basen sowie den Algorithmus zu ihrer Konstruktion hat sich damals (1965) niemand interessiert. Aus heutiger Sicht ist ziemlich klar, warum das so war. Die Mathematiker haben sich damals nicht wirklich für den Computer interessiert, und wenn, dann nur für das, was man „numerisches Rechnen“ (Rechnen mit Zahlen) nennt. Bei den Problemen in der Theorie der Polynomideale (eine abstrakte Fassung dessen, was man auch „Algebraische Geometrie“ nennt) geht es aber um Problemstellungen in abstrakten mathematischen Räumen. Da kann man nicht einfach „mit Zahlen rechnen“ (auch wenn sich zum Schluss die zahlreichen Anwendungen wieder in den konkreten Realitäten wie Roboter oder Kryptografie abspielen). Es war damals eine große Herausforderung, wie man überhaupt in solchen abstrakten Räumen „rechnen“ können soll.
Die Mainstreammathematiker haben sich damals also nicht erwartet, dass aus dem Bereich der Leute, die sich mit Computern beschäftigen, etwas wirklich mathematisch Interessantes kommt. Umgekehrt gab es damals noch keine „Computer Science“ (Informatik). Und die wenigen, die sich mit dem Computer beschäftigt haben, haben nicht wirklich auf die Mathematik geschaut, sondern auf die praktischen Schwierigkeiten, wie man die drängenden Probleme der Anwendungen in allen Bereichen der Naturwissenschaften, der Technik, der Medizin etc. durch „Programmieren“ auf dem Computer lösen könnte. Das Ergebnis meiner Dissertation war damals also genau „zwischen den Stühlen“ der traditionellen Mathematik und der beginnenden Informatik.
Dazu kam noch folgender bedauernswerter Umstand: Da ich vonseiten Gröbners keine Ermutigung bekam, habe ich mein Ergebnis zunächst nicht in einer Zeitschrift publiziert. Wie erwähnt war meine Selbsteinschätzung nicht groß genug, mein Ergebnis für wichtig und publikationswürdig zu halten. Erst als ich in den folgenden Jahren langsam verstand, wie der akademische Betrieb weltweit läuft, habe ich mich auf Anraten zweier Kollegen7 aufgerafft und über das Hauptergebnis meiner Dissertation eine Publikation verfasst und an die mathematische Zeitschrift aequationes mathematicae geschickt. (In der Forschung hatte ich mich inzwischen auf andere Themen konzentriert.) Da ich damals als Mitglied der Computergilde gesehen habe, dass in diesem Bereich Englisch die Lingua franca wird, habe ich die Arbeit auf Englisch verfasst. Der damalige Herausgeber der Zeitschrift, Professor Alexander M. Ostrowski – ein bedeutender Mathematiker des 20. Jahrhunderts –, hat aber befunden, dass es besser sei, wenn ich die Arbeit in meiner Muttersprache Deutsch schriebe. Aus heutiger Sicht natürlich genau das Falsche! Denn das hat das Bekanntwerden meines Resultats sicher um Jahre verzögert. (Die mathematische Leserschaft, die deutsche Papers liest, umfasst weltweit vielleicht ein Prozent!)
Also eigentlich schlechteste Chancen für Ihr Resultat. Wie kam es dann zum Durchbruch?
Wie oft im Leben sind Dinge, die eigentlich negativ und hinderlich sind, dann auf überraschende Weise ein sehr großer Gewinn, den man auf „linearem“ Weg nicht erzielen würde.
In meinem Fall kam das so: Ich war 1976 an die Universität Kaiserslautern eingeladen, um einen Vortrag über meine damalige Forschung (die logische Grundlegung des damals neu aufkommenden Gebiets der Programmiersprachen) zu halten. Als ich mich in einem kleinen Nebenraum auf meinen Vortrag vorbereitete, kam ein Professor der angewandten Physik herein und sagte zu mir: „Ich möchte Ihnen nur mitteilen, dass ich nicht zu Ihrem Vortrag kommen werde.“ Ich dachte: „Ein sehr höflicher Mensch, entschuldigt sich noch, dass er keine Zeit hat.“ Er fuhr dann aber fort: „Nicht, dass ich keine Zeit habe, aber ich finde bereits den Titel Ihres Vortrags unsinnig!“ Ich war schockiert.8
Fast hätte ich mich als gelernter Österreicher auf dem Absatz umgedreht und wäre nach Hause gefahren. Da bäumte sich in mir meine Tiroler „Andreas-Hofer-Mentalität“ für das Überleben in schwierigen Situationen auf und ich fragte: „Bitte, was forschen Sie denn so Sinnvolles?“ Und er erzählte, dass jetzt in der Physik und auf anderen Gebieten Computerverfahren für die qualitative Analyse nicht linearer Systeme ganz wichtig wären, dass „da aber schon die grundlegendsten Fragen ungelöst sind“. „Was zum Beispiel?“, fragte ich. Da erklärte er mir ein Problem, von dem mir schon während seiner Darstellung klar wurde, dass es sich auf das grundlegende Problem zurückführen ließ, das ich in meiner Dissertation (und der zugehörigen Publikation in der Zeitschrift aequationes mathematicae) gelöst hatte.
Ich sagte deshalb: „Ich weiß, wie man Ihr Problem löst.“ Da schaute er mich sehr mitleidig an, so quasi, „der ist so beschränkt, dass er nicht einmal sieht, wie schwierig das Problem ist“, und meinte dann nur: „Das wäre wirklich unglaublich, schicken Sie mir doch Ihr Paper!“ Später fand ich heraus, dass er kurz davor bei einer Konferenz ein Paper mit der Vermutung präsentiert hatte, dass das Problem, von dem wir sprachen, vielleicht „algorithmisch unlösbar“ wäre. Solche Probleme gibt es in der Mathematik. Das sind Probleme, von denen man beweisen kann, dass es aus gewissen logischen Gründen niemals ein Computerverfahren geben wird, welches das Problem in seiner Allgemeinheit wird lösen können. Seine Vermutung war in gewisser Weise plausibel, denn 1970 hatte der russische Mathematiker Yuri Matiyasevich9 gezeigt, dass ein Problem, das sehr ähnlich zu dem Problem in meiner Dissertation ausschaut, tatsächlich algorithmisch unlösbar ist. Dass mein deutscher Kollege also in der internationalen Öffentlichkeit die Vermutung aufgestellt hatte, dass sein Problem algorithmisch unlösbar sein könnte, ließ ihn also gegenüber meiner Ankündigung, dass ich es lösen könne, sehr skeptisch sein!
Ich schickte ihm also mein Paper. Einen Tag später rief er mich an und war wirklich beeindruckt: „Das ist ja unglaublich! Wir müssen Ihr Resultat jetzt rasch bekannt machen in den Kreisen, die heute auf Fortschritte in diesem Bereich warten.“ Er drängte mich, sofort eine neue Arbeit zu schreiben (auf Englisch), in der ich die wesentlichen Teile meiner Theorie und des darauf aufbauenden Algorithmus kompakt und mit einem besser strukturierten und sehr detaillierten Beweis noch einmal darstellte. Diese Arbeit wurde dann im Bulletin der „Special Interest Group for Symbolic and Algebraic Computation“, der (US) Association for Computing Machinery, sofort veröffentlicht. Und ab da war meine algorithmische Theorie in aller Munde und wurde in vielen Forschungsgruppen weltweit weiter bearbeitet, in verschiedener Hinsicht verbessert, verallgemeinert und andererseits auch spezialisiert und vor allem in allen modernen mathematischen Softwaresystemen (die damals gerade im Entstehen waren) implementiert.
Und wie kam dann „Gröbner“ in den Namen der „Gröbner-Basen“?
Als ich die neue Arbeit über meine Theorie schrieb, habe ich spontan entschieden, die wesentlichen mathematischen Objekte, um die es in meiner Theorie geht, mit dem Namen meines akademischen Lehrers zu versehen. In dieser Arbeit 1976 habe ich also den Namen „Gröbner-Basen“ eingeführt. Diese Widmung meiner Arbeit an Gröbner war zwar eine Augenblickseingebung, aber aus einem ganz tiefen Verständnis heraus: Die Erfindung hatte ich mit 23 Jahren gemacht und ich hatte mich damals von Gröbner schlecht behandelt gefühlt und war frustriert gewesen, weil er mein Ergebnis nicht beachtet und mich in keiner Weise motiviert hatte, in diesem Gebiet weiterzumachen. Im Jahr 1976 war ich 34 und inzwischen selbst schon Professor (an der Johannes Kepler Universität Linz). In diesem Augenblick, wo die Aufmerksamkeit der internationalen Research Community plötzlich auf meiner Lösung des Problems lag, das mir Gröbner für meine Dissertation gestellt hatte, ist mir eines ganz klar geworden: Das größte Geschenk, das ein Lehrer seinem Schüler machen kann, ist, ihm ein tolles Problem zu schenken!
Gröbner hat mir zwar während meiner Dissertantenzeit keine „Streicheleinheiten“ zukommen lassen oder Hilfen für meine Karriere etc. gegeben. Aber er hat mir ein Problem geschenkt – und zwar eines, von dem er wusste, dass es wichtig und schwierig war! Noch dazu eines, an dem er selbst schon 25 Jahre gearbeitet hatte. Er war damals 65 Jahre alt, hatte einen ungeheuren Überblick über die Mathematik und in vielen wichtigen Bereichen selbst gearbeitet. Ich verstand 1976 auf einmal, dass Gröbner mir in der Stunde, in welcher er in seinem Seminar das Problem erklärt, und in der halben Stunde nach dem Seminar, als er zugestimmt hat, dass ich das Problem als mein Dissertationsthema nehmen darf, ein ungeheures Geschenk gemacht hatte. Wie ein Vermächtnis eines wesentlichen Teils seines intensiven Forscherlebens! Ich war in dem Augenblick, als ich 1976 die neue englische Arbeit schrieb, völlig überzeugt, dass die Einführung des Namens „Gröbner-Basen“ für meine Erfindung die angemessene Geste wäre, das geistige Geschenk des Problems, das mir Gröbner 1964 gemacht hatte, zu würdigen.
Also ein geistiges Geschenk in Form eines Problems statt einer Lösung. Hat Professor Gröbner noch erfahren, dass Ihre Theorie der „Gröbner-Basen“ internationale Anerkennung findet?
In gewisser Weise schon. Das war dann fast schon wieder lustig: Ich hatte die neue Arbeit, in welcher ich die mathematischen Objekte, die ich 1965 eingeführt hatte, „Gröbner-Basen“ nannte, 1976 an Professor Gröbner geschickt und erwähnt, dass sich die Leute nun weltweit dafür interessierten. Da schrieb er mir in seiner wunderbaren Handschrift zurück, dass er sich darüber sehr freue, er mich dazu beglückwünsche – und dass er meine Arbeit einem Assistenten zum Lesen gegeben habe! Also back to the roots! Ich kam mir wieder vor wie der Student im Jahre 1965. Aber es war trotzdem ein sehr schönes Gefühl. Ich hatte den Kreis geschlossen und ihm ein Denkmal gesetzt, das er in jeder Hinsicht verdiente.
Nicht nur wegen des „Problemgeschenks“, das er mir persönlich gemacht hat. Sondern für sein einmaliges wissenschaftliches Lebenswerk: Er war einer der wenigen, die die drei wesentlichen mathematischen Sichtweisen „Algebra“, „Geometrie“ und „Analysis“ in seinem Kopf, in seiner Forschung und auch in seiner Lehre vereinigt hat. Keiner seiner Schüler (von denen viele Professoren an verschiedensten Universitäten weltweit geworden sind) hat diesen Überblick je wieder erreicht. Möglicherweise tue ich damit aber meinen „Kommilitonen“ unrecht: Vielleicht haben manche von ihnen wieder diesen Überblick und noch mehr. Mir selbst ist dieser Überblick nie gelungen. Meine Herangehensweise ist anders: Ich habe immer versucht und versuche, Mathematik, Logik und „Computerei“ in meinem Kopf zusammenzuhaben und in ihren Interaktionen zu verstehen und zu beleben. Die Breite innerhalb der Mathematik ist mir nicht gelungen.
Seine Forschung war umfassend und immer mit der Lehre verbunden. Er hat bedeutende neue Arbeiten mit großartigen Einsichten und Ideen, aber auch zahlreiche Lehrbücher geschrieben. Seine Vorlesungen waren vorbildhaft. Man hätte die Tafeln mit seiner Handschrift kopieren können und hätte das als Lehrbuch verwenden können. Er war aber auch ein Vorkämpfer für die Freiheit des Denkens. Seine abendlichen Seminare zu „Grenzfragen“ zogen Professoren und Studenten aus allen Wissensgebieten an. Es ging oft sehr heiß her. Für mich persönlich waren diese Seminare ein wichtiger Impuls, mich geistig zu befreien, kritisch gegenüber „allein selig machenden“ Ideologien zu werden, das Leben zu erfahren und selbst zu deuten und auch ohne ideologischen Sicherheitsgurt engagiert für die Gesellschaft zu arbeiten. Gröbners Freidenkertum brachte ihm in der damaligen Tiroler und österreichischen Gesellschaft spürbaren Gegenwind bis hin zur Androhung der Entziehung der Lehrbefugnis durch gewisse konservative Kreise und bis hin zu persönlichen Nachteilen, indem ihm akademische Ehren, die ihm schon längst zugestanden wären, nicht zuerkannt wurden. Das hat er mit größter Gelassenheit zur Kenntnis genommen.
Wolfgang Gröbner verdient ein Denkmal und ich bin froh, dass ich dazu beitragen durfte, ihn unvergesslich zu machen. Er starb 1980 im Alter von 81 Jahren. Zu seinem 100. Geburtstag 1999 veranstalteten seine Schüler, die von nah und fern anreisten, eine Gedenkfeier. In deren Vorbereitung wurde auch im Internet über Gröbner recherchiert und da kommt sein Name überwiegend im Zusammenhang mit den „Gröbner-Basen“ vor. Das war für mich eine tiefe Freude.
Die Kritik des deutschen Kollegen war eigentlich harsch, aber doch sehr entscheidend für den Durchbruch, Ihre Theorie und Methode der Gröbner-Basen bekannt zu machen. Wäre die Geschichte anders verlaufen, wenn Sie damals nicht zufällig bei Ihrem Vortrag in Kaiserslautern mit dieser Kritik konfrontiert worden wären?
„Was wäre, wenn …“ ist immer sehr schwer zu beantworten.
Da die Probleme, die mit Gröbner-Basen behandelt werden können, doch sehr grundlegend sind, wäre ich wahrscheinlich früher oder später darauf gekommen, dass sich Leute nun mit diesen Fragen befassen, und ich hätte mich einbringen und sagen können, dass ich diese Probleme mit meiner Methode lösen kann.
In der Tat hat es schon einige Monate vor meinem Vortrag in Deutschland einen Kontakt von Wolfgang Trinks von der Universität Kaiserslautern gegeben, der einen Masterstudenten auf die Implementierung meiner Gröbner-Basen-Methode angesetzt hatte und selbst eine sehr schöne Darstellung meiner Arbeit aus einem allgemeineren Blickwinkel geschrieben hatte. Das Interesse war aber weniger kämpferisch vorgetragen und die Relevanz für die entstehende Welt der mathematischen Softwaresysteme kam nicht heraus! Dementsprechend war ich durch diesen Impuls noch nicht motiviert, mich wieder mit den Gröbner-Basen zu befassen und mein damaliges Forschungsgebiet hintanzustellen.
Oder es wäre so etwas wie die Gröbner-Basen irgendwann von jemandem anderen erfunden worden. Das ist sehr schwer zu sagen, denn immerhin war das Problem ja vorher – seit 1899 – offen gewesen.
Die Zufallsbekanntschaft mit dem deutschen Kollegen10 war für mich persönlich aber auf jeden Fall sehr entscheidend. Wir sind dann auch sehr schnell freundschaftlich verbundene Kollegen geworden. Die deutsche Mentalität ist halt manchmal etwas harsch, aber geradlinig, und man kommt gleich zum Punkt. Das kann ein großer Vorteil sein. Und in der Wissenschaft ist ohnedies die freie Kritik der Schlüssel für den Fortschritt. Die Kritik wird meist anonym, geschützt durch das sogenannte „peer reviewing system“ ausgeübt, damit der Kritiker nicht möglichen Repressalien durch den Kritisierten ausgesetzt ist. Rüdiger Loos war ehrlich genug, die Kritik persönlich und „ungeschützt“ anzubringen. Das kann man auch als sehr mutig bezeichnen.
Seine Kritik an meinem damaligen Forschungsgebiet („Schon der Titel Ihres Vortrags ist unsinnig“) hat sich aber als falsch erwiesen. Denn circa seit 1995 werden die Dinge, die ich damals studiert hatte, mit großer Intensität und auch großem Erfolg in der Softwaretechnologie eingesetzt und zwar unter dem Stichwort „Abstract State Machines“. Ich war halt immer ein bisschen „gegen den Strom“ oder jedenfalls nicht immer im Hauptstrom und, wie sich gezeigt hat, damit meist etwas meiner Zeit voraus, wenn ich das einmal unbescheiden sagen darf.
Jedenfalls hat mich Loos darauf hingestoßen, dass die Dinge, mit denen ich mich in der Dissertation beschäftigt hatte, jetzt von größtem Interesse für die Entwicklung einer neuen Generation mathematischer Softwaresysteme wären, und zwar eben für Probleme, für die man damals keine Methoden hatte. Und das hat mich gewaltig motiviert, mich in der Forschung wieder mit vollem Fokus auf das Gebiet der Gröbner-Basen zu stürzen, das ich seinerzeit aus Frust über die Nichtbeachtung durch Gröbner verlassen hatte. Als Resultat habe ich kurz darauf eine wesentliche Verbesserung meines Algorithmus gefunden und diese 1979 publiziert, ohne die auch mit heutigen Rechnern nur kleine Beispiele in vernünftiger Rechenzeit gelöst werden könnten.
Ich habe mich dann auch intensiv in die damals noch kleine internationale Community eingebracht, die das Gebiet der „Computer-Algebra“ und der darauf aufbauenden mathematischen Softwaresysteme hochgezogen hat. Loos verdanke ich auch die Bekanntschaft mit George E. Collins, dessen Methode der „cylindrical algebraic decompositions“ (1975 erstmalig in völliger Allgemeinheit publiziert) einen revolutionären Beitrag zur Computer-Algebra darstellt, deren Bedeutung nicht überschätzt werden kann. Leider kann ich seine Leistung und die Grundgedanken seiner Methode in diesem Rahmen nicht wirklich erklären. Wir haben uns jedenfalls 1982 zusammengetan, um das erste Sammelwerk über das junge Gebiet der Computer-Algebra zu schreiben, was dem Gebiet, wie ich hoffe, einen wesentlichen Impuls gegeben hat.11
Ein interessantes mathematisches Problem, das Sie in Ihrer Dissertation gelöst haben, und ein interessanter Grund, warum die Gröbner-Basen den Namen von Gröbner haben: Aber was sind nun die Gröbner-Basen?
Die Theorie der Gröbner-Basen ist eine mathematische Theorie, mit welcher es möglich ist, beliebige sogenannte nicht lineare, algebraische Gleichungssysteme zu behandeln. Der abstrakte Raum, in welchem sich diese Theorie abspielt, ist der Raum der sogenannten „Polynomideale“.
Nicht lineare Gleichungssysteme kommen faktisch überall in den Naturwissenschaften, in der Technik, Medizin, Wirtschaft vor. Einige Beispiele von Problemen aus Naturwissenschaft und Technik, die durch Polynomideale beschrieben werden können, habe ich in einer der vorigen Fragen gegeben (vgl. Seite 16).
Die „Nicht-Linearität“ macht hier die Schwierigkeit aus. Eine Tischoberfläche ist etwas „Lineares“, ein Bilderrahmen ist (meist) etwas Lineares. Wenn man einen Bilderrahmen auf einen Tisch stellt, entsteht eine Kante, wo sich Tisch und Bild schneiden. Die ist „linear“. Wenn hingegen ein Ball (etwas „Nicht-Lineares“) in eine spiegelglatte („lineare“) Wasseroberfläche eintaucht, ist die Schnittlinie etwas „Nicht-Lineares“, nämlich ein Kreis. Eine Tischoberfläche ist „zweidimensional“, die Bilderrahmenkante ist „eindimensional“, die Balloberfläche ist „zweidimensional“, der Ball selbst mitsamt seinem Inhalt ist „dreidimensional“. In der Technik, Wirtschaft, Biologie etc. kommen (gedankliche) Gebilde vor, die viele Dimensionen (auch „Freiheitsgrade“/„unabhängige Variable“/„Parameter“ genannt) haben.
Zum Beispiel hat ein Roboterarm mit drei Gelenken und einem Greifer, der sich in jede Richtung orientieren kann (und dazu weitere drei Gelenke braucht), sechs voneinander unabhängige Möglichkeiten, die Position zu beeinflussen. Er hat also sechs „Freiheitsgrade“, bewegt sich also in einem „sechsdimensionalen“ Raum. Die Abhängigkeit der Position des Greifers von den Gelenkstellungen ist nicht linear. Wenn sich zwei Roboter in einem Arbeitsraum so bewegen sollen, dass sie nicht zusammenstoßen, geht es darum, die Schnittmenge zweier sechsdimensionaler nicht linearer Gebilde zu analysieren, um zum Beispiel herauszufinden, wo durch Kollision der Arme etwas passieren könnte.
Es ist sehr schwierig, Probleme mit nicht linearen Gebilden mathematisch zu behandeln. Deshalb behilft man sich meist dadurch, dass man die nicht linearen Gebilde durch viele kleine lineare approximiert, zum Beispiel eine Kugel durch lauter kleine Dreiecke an der Oberfläche. Dann werden alle Probleme linear und bei diesen (auch mit sehr vielen Dimensionen) weiß man seit Langem, wie man sie effizient lösen kann. Leider entstehen durch das Ersetzen von nicht linearen Gebilden durch lineare Gebilde Fehler, die sich aufschaukeln und zu gefährlichen Fehlschlüssen, falschen Vorhersagen, fehlerhaften Konstruktionen, Abtriften in gefährliche Bereiche etc. führen können. Man wusste seit 1899 durch die Arbeiten des deutschen Mathematikers Paul Gordan, dass sich faktisch alle wichtigen Probleme für nicht lineare Gebilde und Systeme solcher Gebilde einheitlich lösen ließen, wenn man alle solchen Gebilde in eine gewisse „Standardform“ überführen könnte, bei der die einzelnen Variablen in einem gewissen Sinne entkoppelt sind. Genau das leisten die Gröbner-Basen!