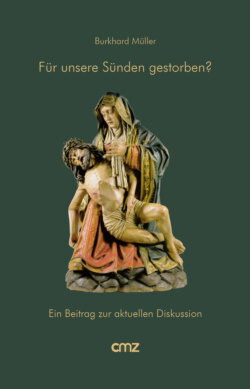Читать книгу Für unsere Sünden gestorben? - Burkhard Müller - Страница 8
3. Das zweite Fremdwort in dieser Sache: »Inkulturation«
ОглавлениеES WIRD HEUTE häufiger ein anderer Ausdruck gebraucht, der etwas ganz Ähnliches bezeichnet: Inkulturation. Man kann sich das leicht selbst übersetzen: Inkulturation ist das Hineinwachsen des Evangeliums in die Kultur der jeweiligen Zeit oder Gesellschaft, um dort richtig anzukommen und zuhause zu sein. Bei der Inkulturation in unsere Zeit ergeben sich ganz spezifische Probleme. Rudolf Bultmann hat das in den inzwischen klassisch gewordenen Satz gekleidet: »Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geisterund Wunderwelt des Neuen Testaments glauben.« Natürlich gibt es Christen, die das versuchen. Aber viele können das nicht, weil sie nicht mit gespaltenem Bewusstsein leben wollen. Sie brauchen die Inkulturation in unsere Zeit.
Vieles verstehen wir heute anders Misstrauische Menschen sehen in der Inkulturation den Versuch, sich an den Zeitgeist anzupassen. Sie spotten: Wer sich mit dem Zeitgeist verheiratet, ist bald Witwer! Manche sehen darin eine unglaubliche Arroganz des heutigen Menschen, klüger sein zu wollen als die Früheren. Aber dass Inkulturation notwendig ist, müsste jedem einleuchten – schon allein deshalb, weil im Verlauf der Jahrhunderte bestimmte Erkenntnisse gewonnen wurden, die sich auf den Glauben auswirken.
Wir wissen heute: Die Erde ist keine Scheibe. Die Erde ist nicht die Mitte der Welt. Adam und Eva waren nicht das erste Menschenpaar.
Wo ist der Himmel Gottes? Früher, als man die Welt für eine Art mehrstöckiges Haus hielt mit dem Totenreich unter der Erdscheibe und dem Himmel über ihr, konnte man klar sagen: Die Hölle (= Totenreich) ist unten, der Himmel ist oben. Viele haben sich die Himmelfahrt Christi als eine Bewegung nach oben vorgestellt.
Aber jetzt, da wir wissen, dass die Erde eine Kugel und das Weltall unendlich weit ist, muss man eine neue Antwort finden auf die Frage: Wo ist der Himmel Gottes? Und diese Antwort zu finden ist die Aufgabe der Inkulturation. Oder man kann sich Gott als Schöpfer nicht mehr so vorstellen, wie er in 1. Mose 2 beschrieben wird, als eine Art Töpfer, der den Menschen aus einem Erdenkloß formt. Auch nicht so, wie er sonst in unserer Religion oft gesehen wird, als der, der liebevoll alles, was ist, selbst erschaffen hat. Die Evolutionstheorie als eine zeitgemäße Vorstellung von der Entwicklung der Natur zwingt uns, anders von Gott dem Schöpfer und von der Natur als Schöpfung zu reden.
Dabei kann man durchaus zu verschiedenen Ergebnissen kommen. So gibt es Christen, die die Evolutionstheorie nicht akzeptieren, sondern gegen sie eine eigene, scheinbar christliche Lehre aufbauen. Sie behaupten: Es gibt einen »Designer«, der hier und da und überhaupt grundsätzlich alle Entwicklung bestimmt hat.
Wenn ich dagegen mit anderen sage: Die Natur hat sich von selbst entwickelt, aber Gott hat ihr seinen EhrenTitel »Schöpfung« verliehen und uns zu den hoffentlich gewissenhaften Verwaltern dieser Schöpfung gemacht; und wenn ich weitersage: Wir Menschen haben tatsächlich mit den Affen gemeinsame Vorfahren, aber Gott hat uns (anders als die Affen) als seine Kinder »adoptiert« und uns unverlierbare Menschenwürde verliehen – dann sind unsere Standpunkte zwar grundverschieden, aber eines haben sie gemeinsam: Sie sind Inkulturation in die heutige Zeit.
Um Inkulturation kommt keiner herum, auch nicht derjenige, der sich mit allen Kräften gegen die historischkritische Methode wehrt und dagegen die Lehre von der wortwörtlichen Eingabe der ganzen Bibel durch Gott aufrechterhält, so dass er darüber im Extremfall zum gefährlichen Fundamentalisten wird. Das ist auch Inkulturation, anders allerdings als bei demjenigen, der sich von der historischen Forschung, helfen lässt, die Bibel als etwas historisch Gewachsenes besser zu verstehen.
»Wie war es denn wirklich?« Mir erscheint als ein wesentliches Merkmal der Neuzeit, dass immer sofort die Frage lauert: Wie ist das denn wirklich gewesen damals? Was haben der und die denn wirklich gesagt?
Wir fragen nicht immer so kritisch. Wenn ein Künstler ein Bild malt, etwa von der Geburt Jesu, und den Personen seines Bildes die Kleidung aus seiner eigenen Zeit gibt, kämen wir nie auf den Gedanken zu sagen: »Er lügt! Das war ja in Wirklichkeit ganz anders!«
Sondern wir erkennen, dass der Künstler das Wunder der Weihnacht ganz bewusst in seine Zeit transportiert. Wir erlauben ihm die historische Inkorrektheit. Die Wahrheit in der Kunst ist eben etwas anderes als die Richtigkeit der Darstellung.
Auch in Romanen dürfen Dinge so erzählt werden, wie sie nie passiert sind. Wir verstehen sofort, dass hier die Wahrheit keine historische Wahrheit ist, sondern vielleicht eine gedankliche Wahrheit, für die der Schriftsteller uns mit seinem ausgedachten Text die Augen öffnen will.
Aber bei anderen Texten wie bei denen der Bibel ist immer die Frage lebendig: Ist das so passiert? Wie hat sich das abgespielt? Wie ist der Bericht darüber entstanden? Denn man weiß, dass hier von Vergangenem geredet wird, das ja für die Gegenwart bedeutsam sein soll. Und darum wird die Bibel, weil sie so wichtig ist, von den Forschern besonders genau untersucht. Ich verstehe, dass für manchen die Ergebnisse nicht einfach zu akzeptieren sind:
−Es gibt zwei Schöpfungsgeschichten, die sich widersprechen.
−Die Bücher Mose sind nicht von Moses geschrieben.
−Die »Richter« haben nichts mit der Justiz zu tun.
−Die Geschichte von Jona und dem Wal ist eine Novelle.
−Keiner der vier Evangelisten kannte Jesus persönlich.
−Der Paulusbrief an die Kolosser ist wahrscheinlich gar nicht von Paulus.
−Die Bergpredigt ist keine Predigt, sondern ist eine Sammlung von Sprüchen.
Trotzdem ist das geradezu unser Schicksal, an solcher historischen Arbeit nicht vorbeigehen zu können. Diese Erkenntnisse aufzunehmen ist ein Stück Inkulturation heute.
Trinitätslehre: eine Inkulturation in griechisches Denken Als der christliche Glaube die Welt der griechischen Religionen und Philosophien erreichte, mussten die Christen ihren Glauben gegenüber kritischen, neugierigen und spöttischen Fragen rechtfertigen. »Was, ihr habt drei Götter, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist? Wer sind diese drei? Was haben sie miteinander zu tun? Sind sie etwa drei Götter? Oder wer von ihnen ist der Gott?«
Da gerieten die Christen in Erklärungsnot. Bei ihnen selbst waren ja auch schon solche Fragen laut geworden. Sie nahmen die gedankliche Herausforderung an und versuchten zu klären, was zu klären war. Dazu mussten sie sich der Sprache und der Begriffe der griechischen Philosophie bedienen. In den ersten Jahrhunderten der Kirche hat man darüber lebhaft und leidenschaftlich diskutiert, zum Teil auf höchstem Niveau. Konzilien wurden einberufen. Dabei ging es allerdings nicht immer ordentlich zu. Vor allem der Kaiser spielte seine Macht aus. Unter solchen nicht immer idealen Umständen entwickelten sie die altkirchliche Trinitätslehre, eine großartige Leistung der Inkulturation in das griechische Denken.
Aber nur kurze Zeit und für wenige in den Gemeinden war das Ergebnis das, was es sein wollte: wirklich verständlich. Für die Christen im lateinischen Sprachraum, also im Westen des Mittelmeerraums, war das von Anfang an schwierig zu verstehen. Denn auf dem Konzil zu Nicäa im Jahr 325, zu dem der Kaiser Konstantin eingeladen hatte, um die Fragen der Trinität zu klären, waren unter den 250 Bischöfen nur 5 Bischöfe aus dem Westen, dem lateinischen Sprachraum. Die Trinitätslehre ist eben eine Inkulturation in das griechische Denken. Schon das römische Denken hatte seine besondere Mühe bei der Übertragung.
Immer schwerer hatten es die Menschen, den tiefen Gedanken zu folgen. Heute muss man schon hochgescheiter AltHistoriker oder Kirchengeschichtler sein, um dieses Dogma und seine theologischen Feinheiten zu verstehen.
Ich vermute, dass wegen dieser Verstehensschwierigkeiten die Trinitätslehre zunehmend als »geoffenbartes Mysterium« verkauft wurde, das man nicht verstehen kann, sondern letztlich glauben und anbeten muss. Leider, denn vermutlich hat die Ehrfurcht vor dieser alten Lehre verhindert, die Trinitätslehre zu aktualisieren. Das aber wäre dringend nötig, weil heute ganz neue Fragen gestellt werden und eine neue Inkulturation nötig wäre.
Die »Regensburger Rede« von Papst Benedikt XVI. Doch das Bemühen um solche Inkulturation in unser gegenwärtiges Denken prallt auf viel Widerstand, so auch bei Papst Benedikt XVI. Mit seiner berühmten Regensburger Rede, die er am 12. September 2006 in der Aula Magna der Universität Regensburg gehalten hat, machte er zwar vor allem wegen seiner Äußerungen zum Islam Furore. Aber nachdem der Rauch dieses Feuers verweht ist, lohnt es sich, den Blick auf den eigentlichen Inhalt dieser Rede zu werfen.
Benedikt preist zunächst die Inkulturation in der frühen Christenheit, die er als ein wunderbares Zusammenkommen von hebräischaramäischem Denken und griechischer Philosophie der Vernunft zu einer harmonischen Synthese ansieht. Der biblische Glaube sei dem Besten des griechischen Denkens von innen her entgegengegangen. Dieses innere AufeinanderZugehen von biblischem Glauben und griechischem philosophischem Denken ist für Benedikt XVI. nicht nur religionsgeschichtlich, sondern weltgeschichtlich ein entscheidender Vorgang, der uns auch heute in die Pflicht nehme. Die Ergebnisse haben so geradezu Offenbarungscharakter.
Danach, so beklagt er, seien immer wieder Versuche gestartet worden, das Rad der Geschichte zurückzudrehen und das Christentum von den griechischen Elementen zu reinigen. Man wolle sich dabei das Recht nehmen, hinter die Inkulturation in das Griechische zurückzugehen und auf die einfache Botschaft des Neuen Testaments zurückzugreifen, um diese Botschaft dann in ihre gegenwärtigen Zusammenhänge jeweils neu zu inkulturieren. Angesichts der Begegnung mit der Vielheit der Kulturen sage man heute gern, die Synthese mit dem Griechentum, die sich in der alten Kirche vollzogen habe, sei nur eine erste Inkulturation des Christlichen gewesen, die Inkulturation in andere Kulturen müsse folgen. Dies aber lehnt Benedikt strikt ab.
Kein Wunder, dass Benedikt zur Inkulturation des Evangeliums in der Gestalt der Befreiungstheologie Südamerikas oder zur feministischen Theologie keinen Zugang hat. Aber es ist eine Selbsttäuschung, ohne Inkulturation auskommen zu können. Wer heute nur dasselbe sagt, was man früher gesagt hat, sagt heute etwas anderes, als früher gesagt wurde – weil es heute anders verstanden wird als früher. Darum bedarf es der Inkulturation als einer Übersetzung und Übertragung aus früher Zeit in die Gegenwart.
Wenn wir uns mit der Frage des Sühnopferdenkens heute beschäftigen, werden wir uns – ob wir ihr zustimmen oder sie ablehnen – in einem Prozess der Inkulturation befinden, weil wir sie notgedrungen nicht so hören wie die Menschen damals im Mittelalter, für die Anselm von Canterbury seine Theologie formuliert hat.
Inkulturation bei den Germanen Die germanischen Volksgruppen, die sich im Zuge der Völkerwanderung nördlich der Alpen niedergelassen hatten, dachten anders über Gott und die Welt als die Griechen und Römer. Beim Überschreiten der Alpen kam das Evangelium aus der griechischen und lateinischen Welt in den germanischen Raum und musste neu inkulturiert werden.
Germanisches Denken blieb viele Jahrhunderte lebendig. Die profilierteste Fassung der Sühnopfertheologie, nämlich die des Anselm von Canterbury, ist nicht ohne das germanische Denken zu verstehen. Sie ist eine Inkulturationsleistung hervorragender Art. Sie ist aber nicht der erste und einzige Versuch, das Evangelium in die germanische Welt zu inkulturieren.
Der »Heliand« Die Sachsen waren durch Karl den Großen christianisiert, zwangschristianisiert worden. Die Herzen der Sachsen blieben dem Christentum fern. Der christliche Glaube war aufgepresst, nicht inkulturiert. Heimlich erzählte man sich die alten germanischen Heldensagen und praktizierte vorchristliche Bräuche.
Man weiß nicht, wer dann den interessanten Auftrag gab, hier eine Wende herbeizuführen. War es der König, waren es Bischöfe? Man weiß auch nicht, wer diesen Auftrag bekam und ausführte. Spuren weisen auf das Kloster in Fulda hin. Gegen 830 n. Chr. machte sich dort ein Unbekannter, wohl ein hochgebildeter Mönch, ans Werk, ein christliches Heldenepos zu verfassen, das neben den germanischen Heldensagen bestehen könnte. Dieses »Heliand« genannte Epos schrieb er in germanischem Stabreim. Das Evangelium wurde nacherzählt, aber ganz typisch verändert und für germanische Ohren passend gemacht. Christus war ein Volkskönig, ein Heerführer und erhabener Fürst. Die Jünger waren die Gefolgsleute, die mit ihm eine Genossenschaft bildeten und ihm durch germanisches Treueund Schwurverhältnis verbunden waren. Sie waren tapfere Kämpfer von edler Abstammung, nicht wie in der Bibel Menschen aus den unteren Volksschichten.
Feindesliebe? Dieses Gebot Jesu wird im »Heliand« unterschlagen. Germanen hätten das nicht verstanden. Es fehlt auch die Szene, in der Christus dazu auffordert, bei einem Schlag auf die rechte Wange auch die linke darzubieten. Das war nichts für heldensüchtige kampfbereite Germanen. Den Eselsritt des Königs Jesus nach Jerusalem musste man streichen: Ein König reitet doch nicht auf einem Esel!
Die Hirten auf dem Felde waren keine Schafshüter, sondern bewachten Pferde. Biblische Städte wurden zu Burgen gemacht und die Wüste Juda zum deutschen Urwald. Die Bergpredigt war ein Thing des Volkskönigs, die Hochzeit zu Kana ein germanisches Metgelage.
Ein spannender Kampf musste her, ein Zweikampf. So wird der Kampf des Petrus mit Malchus, dem Knecht, ausführlich und spannend mit 15 Langversen erzählt. Die Bibel kommt mit einem Vers aus.
Dass Petrus die Treue zu Jesus bricht, ist für germanisches Gefolgschaftsdenken das schlimmste Vergehen, die übelste Kränkung des Heerführers und Vasallenherrn Jesus. Der »Heliand« nimmt darauf Rücksicht und entschuldigt den Treuebruch und macht ihn so klein wie möglich.
Grundzüge dieses germanischen Denkens blieben Jahrhunderte hindurch lebendig: Gott erwartet Vasallentreue. Wird seine Ehre verletzt, kann Gott nicht mild und barmherzig sein, sondern muss Gerechtigkeit walten lassen. Nur durch Buße und Sühne (ein Wort, das in dieser Zeit entsteht!) kann die Vasallenordnung wieder hergestellt werden. Dieses germanische Rechtsempfinden saß tief in den Menschen der folgenden Jahrhunderte. Jeder Versuch der Inkulturation musste diesem germanischen Grundgefühl gerecht werden.
Die Logik des Berengar Dazu kam im Mittelalter ein elementares Bedürfnis, die Geheimnisse des Glaubens zu verstehen, vernünftig zu durchdenken und in ihrer Logik zu erklären. Aber Logik allein genügte nicht, um erfolgreich zu inkulturieren.
Das musste Berengar von Tours (gestorben um 1088) erfahren. Er wollte mit Logik und Vernunft den Glauben erklären. Er sagte: »Ich verlasse die Worte der Väter und der Tradition nicht. Aber wenn die Dialektik, die Logik, die Vernunft die Wahrheit klarer erkennen lassen, so will ich lieber die Autorität der Tradition und der Väter beschneiden als die Vernunft. Denn in unserer Vernunft besteht die Gottebenbildlichkeit.« Diesen Grundsatz wandte er auf das Abendmahl an. Er konnte es mit seiner Logik nicht einsehen, dass sich das Brot auf dem Altar beim Abendmahl in das Fleisch des gekreuzigten und erhöhten Herrn verwandelt. Eine solche Verwandlung würde voraussetzen, dass das Brot zu existieren aufhört und das Fleisch zu existieren anfängt, was aber nicht sein kann, weil das Fleisch unseres Herrn bereits seit seiner Auferstehung im Himmel ist.
Aber trotz aller Logik der Argumentation wurde Berengar kräftig widersprochen und bekämpft. Ist Gott nicht allmächtig, so dass er das Unmögliche und Unlogische tun kann? So wie er Steine in Brot verwandeln kann? Schließlich wurde Berengar vor den Papst geschleppt und musste das Bekenntnis unterschreiben, dass das Brot auf dem Altar der Leib Christi sei und sinnfällig durch die Zähne der Gläubigen zermalmt werde. Es war riskant, seine Vernunft zu gebrauchen, die Logik der Dialektik einzusetzen, wenn man dabei die religiöse Praxis und Tradition verletzte. Wer in der Inkulturation erfolgreich sein wollte, musste eben drei Dinge gleichzeitig tun:
1 dem germanischen Weltgefühl entsprechen;
2 logisch argumentieren;
3 die Tradition und Frömmigkeitspraxis nicht verletzen, sondern bestätigen.
Der, dem das besonders gut gelang, ist Anselm von Canterbury. Er hat eine überaus erfolgreiche Theologie entwickelt, die das fromme Denken der folgenden Jahrhunderte bestimmt hat. Er ist schuld daran, dass wir bis heute die Frage stellen: »Braucht Gott das Sühnopfer Jesu?« und eifrig darüber diskutieren.
Anselm von Canterbury Es überrascht mich immer wieder, wie international die Lebensläufe großer Menschen des Mittelalters waren. Konnten sie deshalb so umfassende Theorien entwickeln, weil sie auch geographisch mit einem weiten Horizont dachten und lebten?
Anselm wird 1033 in Aosta (Italien) geboren. Mit 23 Jahren tritt Anselm in ein französisches Benediktinerkloster ein. Er wird Abt. Dann wird er zum Erzbischof von Canterbury berufen. Wegen politischer Auseinandersetzungen (Investiturstreit) muss er zweimal für längere Zeit aufs Festland fliehen. Er stirbt 1109. 1494 wird er heilig gesprochen und 1720 von Clemens XI. zum »doctor ecclesiae«, zum »Lehrer der Kirche«, ernannt, also 600 Jahre nach seinem Tod. Schon daraus kann man die lang anhaltende Bedeutung dieses großen Theologen erkennen.
Uns interessiert hier seine Lehre, mit der er dem Tod Jesu die wichtige sühnende Funktion gibt. In seiner Schrift »Cur Deus homo?« (Warum wurde Gott Mensch?) entwickelt er diese Gedanken, in denen man deutlich germanische Prinzipien wiedererkennt: Der Mensch hat durch seine Sünde die Ehre Gottes verletzt. Nun darf Gott nicht mild und barmherzig reagieren. Einfach durch Barmherzigkeit die Schuld niederzuschlagen, ziemt sich nicht.
Wie der germanische Lehnsherr von seinem Vasallen zwingend Genugtuung, Satisfaktion verlangt, also Wiedergutmachung, so verlangt auch Gott vom Sünder Satisfaktion. Schuld muss gesühnt werden, Gott kann nicht verzeihen ohne Satisfaktion. Alle Sünde verlangt Bestrafung und Genugtuung. Nur so kann die Gerechtigkeit, der höchste Wert, wiederhergestellt werden.
Wer aber kann diese Genugtuung leisten? Der Mensch? Natürlich nicht. Denn selbst wenn er gerecht wäre und nur gute Werke täte, brächte er Gott nur das entgegen, was er ihm ohnehin schuldet. Nur einer, der größer ist als der Mensch, nur Gott selbst, kann Genugtuung leisten. Aber da Menschen die Ehre Gottes verletzt haben, muss dieser eine nicht nur Gott sein, sondern auch Mensch.
Darum gibt einen logischen Ausweg: Gott selbst wird Mensch. Nur der Gottmensch, der ohne Sünde ist, kann die Ehre Gottes wiederherstellen, indem er den Tod auf sich nimmt als das Strafleiden, das er nie verdient hat, weil er ohne Sünde war, aber das er stellvertretend für uns erleidet.
Der Tod Jesu ist die Entschädigung Gottes für die Sünden der Menschen, weil Jesus Gott nur ein sündloses Leben schuldet, nicht aber den Tod. Der Sühnetod Jesu ist die logische Notwendigkeit zur Wiederherstellung der Ehre Gottes und zur Erlösung der Sünder. Durch das Blut Jesu, das vergossen wird, erfährt der gekränkte Gott die Genugtuung. Jesu SelbstOpferTod hat den Menschen Heil und Seligkeit verschafft.
Natürlich ist auch das nur ein logisches Konstrukt, eine gute Interpretation unter vielen anderen. Aber es kommt daher in der Gestalt eines Dogmas, im Gewand der Wahrheit: »So ist die Wahrheit«. Und diese Lehre findet Akzeptanz. Sie leuchtete ein: Weil sie germanisch war, weil sie logisch war, weil sie der Bibel und der kirchlichen Tradition vom Tod Christi wunderbar zu entsprechen schien und viele Stellen der Bibel sich von daher gut erklären ließen.
Anselm auch bei Protestanten Diese Lehre ist unglaublich wirksam gewesen. Sie hat auch die Reformatoren beeinflusst. Schlagen wir die lutherische »Confessio Augustana« auf, dann lesen wir dort über Jesu Leiden und Sterben, »dass er ein Opfer wäre nicht allein für die Erbsünde, sondern auch für alle andere Sünde und Gottes Zorn versöhnt«.
Und lernen reformierte Christen den Heidelberger Katechismus auswendig, dann haben sie bei der Frage 37 (»Was verstehst du unter dem Wörtchen ›gelitten‹?«) aufzusagen: »Daß er an Leib und Seele die ganze Zeit seines Lebens auf der Erde, besonders aber an dessen Ende, den Zorn Gottes gegen die Sünde des ganzen Menschengeschlechts getragen hat […], um mit seinem Leiden als dem einmaligen Sühnopfer […] unseren Leib und unsere Seele von der ewigen Verdammnis zu erlösen und uns Gottes Gnade, Gerechtigkeit und ewiges Leben zu erwerben.«
Auch in zahllosen Gesangbuchliedern lebt diese Theologie weiter. Wenn im Gottesdienst die Nummer 102,2 angeschlagen ist, dann singt die Gemeinde mit Luther aus dem Evangelischen Gesangbuch (EG):
»Der ohn Sünden war geborn,
trug für uns Gottes Zorn,
hat uns versöhnet,
dass Gott uns sein Huld gönnet.
Kyrie eleison. «
Zu Weihnachten hört man bisweilen den Kehrvers aus dem Lied EG 29: »Gottes Sohn ist Mensch geborn, hat versöhnt des Vaters Zorn.«
Aber Gottesdienstbesuchern fällt doch auf, dass solche Lieder, in denen die Opfertheologie sehr deutlich vorkommt, in denen gar vom Zorn Gottes die Rede ist, der versöhnt werden muss, nur sehr selten gesungen werden. Deutet sich da etwa eine neue Inkulturation an, eine Inkulturation weg von der mittelalterlichen Sühnopfertheologie?
Kritik kommt auf Wie wenig diese Lehre zu anderen Sätzen und Botschaften der Bibel und der Tradition passte, wurde zunächst nicht wahrgenommen. Trotzdem wurden seit der Aufklärung bis heute Vorwürfe und Einwände gegen Anselms Lehre immer lauter, die ich gut nachvollziehen kann. Hier nenne ich einige mir wichtige Punkte:
1 »Gott ist Liebe« – das ist doch die Botschaft des Evangeliums! Wie kann aber die Kränkung der Ehre Gottes und sein Zorn darüber das Motiv für die Menschwerdung Jesu sein statt der Liebe Gottes? Jesu Leben verdankt sich nicht unserer Sünde, nicht Gottes Gekränktsein, sondern allein der Liebe Gottes zu seiner Menschheit.
2 Wo bleibt bei Anselm die Freiheit Gottes? In dieser Theologie ist Gottes Liebe nicht der oberste Wert, sondern die Liebe steht unter dem Zwang der Gerechtigkeit. Bei Anselm darf – entsprechend dem germanischen Denken – Gott nicht einfach vergeben, nicht einfach aus Liebe handeln. Er muss vielmehr die Gerechtigkeit durchsetzen. Da ist Gott sehr unfrei.
3 Die Bibel verabscheut Menschenopfer. Mit Schaudern beobachtet das Alte Testament, dass andere Völker Kinder opfern oder sie z. B. töten, um ihre Leichen in neue StadtmauerBefestigungen einzumauern. Wenn aber Gott seinen Sohn opferte, täte er nicht vergleichbar Schauerliches? Dass Gott seinen Sohn benutzt als Opfer, ist eine absurde Vorstellung. Noch absurder ist es, gerade darin den Beweis für die unendliche Liebe Gottes erkennen zu wollen. Es ist in der biblischen Tradition undenkbar, dass Gott seinen Sohn tötet. Nietzsche hat das erkannt und sagt in den »Aphorismen« (41): »Das Schuldopfer, und zwar in seiner widerlichsten, barbarischsten Form, das Opfer des Unschuldigen für die Sünden der Schuldigen! Welches schauderhafte Heidentum!«
4 Stellvertretung ist ein Grundmotiv dieser Satisfaktionslehre. Stellvertretendes Handeln gibt es überall zwischen uns Menschen. Ohne Bereitschaft, stellvertretend zu handeln, kann unser Miteinanderleben nicht gelingen, kann unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Aber kann es eine Stellvertretung in Fragen der Schuld geben? In einer magisch denkenden Zeit konnte Schuld einfach übertragen werden, zum Beispiel durch den Priester auf ein Tier. Aber wo in personalen Kategorien gedacht wird – der Mensch als verantwortliche Persönlichkeit –, ist der Gedanke der Stellvertretung in Fragen der Schuld nicht nachzuvollziehen. Eine Person kann nicht statt der anderen Schuld übernehmen.
5 Der Spitzensatz der Menschenrechte, der in Verfassungen zu finden ist, lautet: »Die Würde des Menschen ist unantastbar.« Für die Kirchen ist dies eine gute Beschreibung dessen, was den Menschen auszeichnet. Aber damit ist unvereinbar, wenn man Gott seinem Mensch gewordenen Sohn den Kreuzestod antun lässt.
6 Das ganze Christentum wird auf das SündeSühneSchema konzentriert. Dieser Sündenmonismus ist nicht biblisch. Nur in dieser Kategorie »Sünde« zu denken, ist eine Verarmung gegenüber der biblischen Botschaft. Alles wird hier aufs Sterben Jesu bezogen. Das Leben Jesu spielt für diese Theologie kaum eine Rolle. Die Auferstehung ist auch Nebensache. Denn das Sterben Jesu ist das Heilsgeschehen.
7 Aus Liebe übt Gott Gewalt. Aus Liebe lässt er töten. In diesem Gottesbild verbinden sich Liebe und Gewalt. Es ist ein Gottesbild, das die Gewalttätigkeit der Christen und Kirchen in ihrer Geschichte gefördert hat. Es gibt den »heiligen Zorn«, die Quelle von Gewalttätigkeit. Dieses Gottesbild zwischen Liebe und gewalttätigem Zorn gibt der Praxis der Gewaltausübung wie in den Kreuzzügen starken Rückenwind, wie Untersuchungen deutlich gemacht haben. Man hat festgestellt, dass dieses Gottesbild sich sehr leicht mit »schwarzer Pädagogik« verbündet: Die Bosheit von Kindern muss aus Liebe mit Gewalt (Prügelstrafe) von Anfang an ausgetrieben werden. Der Stock, mit dem der Pädagoge zuschlägt, ist Zeichen der Liebe.
8 Was bildet sich der Mensch eigentlich ein, wer er ist? Er ist so eitel und selbstverliebt, dass für seine Sünden das Äußerste geschehen muss: Gott opfert seinen Sohn. Welch ein Narzissmus! Das Beste ist für unsere Fehler gerade gut genug. Der Sohn Gottes muss es schon sein. Ganz anders verhält es sich in der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Die Menschen bauen einen riesigen Turm, der bis in den Himmel reichen soll. Die Bibel erzählt mit dem ihr eigenen Humor: Gott kann es von da oben gar nicht richtig wahrnehmen. Gott muss heruntersteigen, um zu sehen, welchen kümmerlichen Turm sie bauen: »Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm« (1. Mose 11)
9 Und hier der Grundfehler: Bei Anselm ist Gott der Empfänger der Versöhnung. Gott muss versöhnt werden, damit er nicht mehr zürnt. Aber in der Bibel wird immer nur der Mensch versöhnt. (2. Korinther 5,19 »Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber.«) Nicht Gott ist der Empfänger dieser Opfertat, sondern der Mensch empfängt das Geschenk der Versöhnung.
»Anselm light« Dieser letzte Gedanke hat sich inzwischen weit verbreitet. Nicht Gott muss versöhnt werden – wir müssen versöhnt werden. Gott schenkt die Versöhnung. Er ist das Subjekt, nicht das Objekt der Versöhnung. Mit dieser Einsicht grenzen sich viele von Anselm ab. Aber dann lehren sie eine Theologie, die ich hier »Anselm light« nennen möchte. Anselms Lehre ist nur ein ganz klein wenig verändert, alles andere bleibt.
Gott will uns versöhnen, aber er kann uns nicht einfach durch Vergeben aus seiner Güte versöhnen. Nein, die Sünde muss gesühnt werden. Und das geht auch hier nur durch ein Opfer, ein Blutopfer. Wie bei Anselm: Gottes große Liebe zeigt sich darin, dass er seinen Sohn am Kreuz töten lässt. Auch hier: Gewalt und Liebe sind in Gott fest verbunden.
Aber warum braucht es denn ein Blutopfer? Kann Gott nicht versöhnen ohne Blut und Tötung? Welchem Sühnegesetz wird hier Gottes Güte unterworfen? Kann ich nicht glauben, dass Gottes Liebe so stark, kreativ und kräftig ist, dass sie Neues setzen, Versöhnung schaffen kann, ohne dass entsprechend archaischen Strafund Rachegesetzen Blut fließen muss? Was für ein Gott wird uns da vor Augen gestellt?
Alle oben aufgeführten Anfragen an Anselms Theorie bleiben auch bei dieser etwas veränderten Form seiner Sühnopfertheologie, auch bei »Anselm light«.