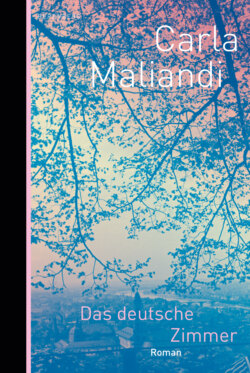Читать книгу Das deutsche Zimmer - Carla Maliandi - Страница 6
2
ОглавлениеIch träume, dass ich auf einer Liege aufwache, die in einer Art Gehege für Menschen steht. Neben mir schläft ein etwa dreijähriger Junge. Ich wecke ihn und frage, wo wir sind, der Junge kann aber nicht sprechen. Ich sage zu ihm, dass wir hier wegmüssen. Ich nehme ihn auf den Arm und gehe los. Ich trage die Kleidung, die ich auf der Reise anhatte, einen grauen Pullover und Jeans, Schuhe habe ich aber keine an. Der Junge ist in eine Decke eingewickelt und ziemlich schwer. Wir durchqueren eine riesige Halle und kriechen danach unter dem Stacheldrahtzaun durch, der das Gelände umgibt. Dann stehen wir auf einem Feld. Kühe sind zu sehen, der Boden wird jedoch von Nebel verdeckt. Neben einer der Kühe kauert ein Mann, er ist damit beschäftigt, sie zu melken. Ich kann nicht allzu viel von ihm erkennen, nur dass er ziemlich groß ist und wie ein typischer Alpenbewohner aussieht. Als wir an ihm vorbeigehen, bietet er uns ein Glas Milch an. Ich nehme das Glas und halte es dem Jungen hin. Da wird der Mann böse und erklärt, die Milch sei für mich. Wir fangen an zu streiten, ich verstehe aber nicht, was der Mann sagt, weil er einen so starken Dialekt spricht. Irgendwann starrt er meine Brüste an, deutet mit dem Finger darauf und sagt, auf einmal klar und deutlich: »Da ist genug Milch für alle drin.« Erschrocken laufe ich mit dem Jungen davon. Ich halte ihn jetzt an der Hand, aber er befreit sich von mir, wieder ergreife ich seine Hand, wieder befreit er sich, wieder ergreife ich seine Hand, wieder befreit er sich. Da wache ich auf.
Das Bett meines Wohnheimzimmers ist wirklich sehr bequem. Dazu kommt der Blick durchs Fenster in den Garten, die Landschaft, die ich von hier aus sehen kann, hat nicht das Geringste mit dem öden Feld aus dem Traum zu tun. Das Wohnheim übertrifft alle meine Erwartungen einer falschen Studentin.
Nachdem die Heimleiterin Frau Wittmann gestern meine Daten aufgenommen und mir die Räumlichkeiten gezeigt hatte, wies sie mich darauf hin, dass es nur bis halb zehn Frühstück gibt. Ich muss also schnell aufstehen, wenn ich nicht zu spät kommen will. Trotzdem denke ich noch eine Weile über den Traum nach und betaste meine Brüste, sie sind ungewöhnlich stark angeschwollen. Wahrscheinlich bekomme ich bald meine Tage, hoffentlich habe ich nicht vergessen, Sertal einzupacken. Ich stehe auf, ziehe mich rasch an, fahre mir, statt mich zu kämmen, bloß mit den Fingern durch die Haare und gehe in den Speiseaal hinunter. Dort machen sich mehrere Studenten gerade Kaffee und bestreichen Toaste. Mir ist nicht klar, wie das mit dem Frühstück geregelt ist, ich weiß nicht, ob ich mich einfach bedienen darf oder zuerst jemanden fragen muss. Dass dies kein Hotel ist, versteht sich, das Essen servieren wird mir niemand. Jetzt begreife ich, was Frau Wittmann mit »Frühstück machen« gemeint hat. In jedem Fall isst hier jeder etwas Verschiedenes, die einen Toast, andere bloß Joghurt oder Obst oder Müsli. Die Sachen entnehmen sie einem großen Kühlschrank, ich sehe, dass auf den Gefäßen, in denen sich die Speisen befinden, Namensschildchen kleben. Vor der Kaffeemaschine hat sich eine kleine Schlange gebildet, an einigen Tischen werden leise Unterhaltungen geführt, an anderen frühstückt jemand allein vor seinem aufgeklappten Notebook, ohne sich umzusehen. Es ist mir peinlich, so unschlüssig und schlecht gekämmt dazustehen. Ich beschließe, in die Stadt zu gehen und in einem Café zu frühstücken, wenigstens heute.
Heidelberg ist ein Ort wie aus einem Märchen, wie aus einer anderen Wirklichkeit, eine der wenigen deutschen Städte, die im Zweiten Weltkrieg nicht völlig zerbombt wurden. Ich versuche, die Straßen wiederzuerkennen. Ich habe die ersten fünf Jahre meines Lebens hier verbracht. Manches ist mir noch vertraut – die Bäckereien, das Neckarufer, der Geruch auf der Straße. Es ist ein warmer, strahlend schöner Tag. Ich gehe in dem Märchen spazieren, atme tief durch, tue, als hätte ich mich verlaufen, finde – welch Überraschung! – den Weg wieder. Am Marktplatz betrete ich ein Café und bestelle ein Frühstück. Es besteht aus Brötchen, Käse, Wurst, Orangensaft und einem großen Milchkaffee. Der Kellner fragt, woher ich komme, er spricht über Fußball, kennt die Namen aller Spieler der argentinischen Nationalmannschaft. Ich nutze die Gelegenheit, um Deutsch zu üben, ohne mich allzu sehr anstrengen zu müssen. Ich habe bereits gemerkt, dass ich die Sprache nicht mehr ohne weiteres verstehe, ich habe viel vergessen, die paar Grammatikübungen, die ich mir vor der Abreise im Internet zusammengesucht habe, haben nicht gereicht, und nur mit meiner guten Aussprache kann ich das alles, anders als gedacht, nicht wettmachen. Während der Kellner mir von Messi erzählt, überlege ich, wie ich das mit der Verständigung am besten hinbekomme. Wenn es nicht anders geht, kann ich auch Englisch sprechen. »Sí, Messi es un genio«, sage ich zuletzt auf Spanisch. Der Kellner lacht und geht zu einem Gast an einem anderen Tisch. Auf dem Weg dorthin wiederholt er amüsiert »genio«, »ein Genie, ha ha«. Ich verschlinge das Frühstück gierig bis auf den letzten Krümel. Ein alter Mann am Nachbartisch beobachtet mich aus dem Augenwinkel, neben ihm sitzt ein kleiner Hund, offensichtlich sein Begleiter. Der Mann streichelt ihn mit der einen Hand, in der anderen hält er seine Tasse. Ich überlege, wie alt er sein mag, und frage mich, was er wohl im letzten Krieg gemacht hat. Was soll’s, selbst wenn er ein Nazi war, lange hat er so oder so nicht mehr zu leben. Plötzlich lächelt der Mann mich an. Vielleicht habe ich einfach zu viele Vorurteile, auf einmal kommt er mir jedenfalls bloß wie ein freundlicher alter Mann vor, der gemerkt hat, dass ich nicht von hier bin. Was denken die Leute, die mich hier sitzen sehen, wohl über mich? Ich versuche, mir vorzustellen, wie ich aussehe, mit dem ungekämmten Haar, das mir auf die Schultern fällt, der schlecht sitzenden Spange, die ich mir heute Morgen in aller Eile angesteckt habe, und der schönen, aber völlig verknitterten Bluse. Auf einmal kommt es mir nur noch lächerlich vor, wie ich hier versuche, die Ruinen zu kaschieren. Kaputt ist kaputt, egal, wo ich mich befinde – im Augenblick Tausende von Kilometern von meinem Heimatland entfernt, ohne mich mit meiner Umgebung richtig verständigen zu können und ohne zu wissen, was ich eigentlich vorhabe.
Wenn ich wieder im Wohnheim bin, werde ich mir von Frau Wittmann eine Schere leihen und mir die Haare schneiden. Schon habe ich etwas vor. Die Haare hätte ich mir längst schneiden sollen. Der alte Mann vom Nachbartisch steht auf und geht hinaus, draußen auf dem Bürgersteig bleibt er noch einmal stehen und winkt mir zum Abschied durchs Fenster zu. Gerührt beobachte ich, wie er mit dem kleinen Hund davongeht. Ich zähle die Münzen für das Frühstück ab, sieben Euro. Sieben Euro ist für mein Reisebudget wahnsinnig viel. Ich frage mich, ob zwei dieser Münzen für mehrere Anrufe reichen. Ob es mir gelingen wird, meine Mutter zu beruhigen, die immer noch jammert, weil ich mich von Santiago getrennt habe, und jetzt auch noch damit wird fertig werden müssen, dass sie mich eine ganze Weile nicht zu sehen bekommt. Ob mir für die Leute, für die ich arbeite, eine gute Ausrede einfallen wird, wo ich diese Arbeit ohnehin fast verloren habe, weil ich im letzten Monat beinahe jeden Tag zu spät gekommen bin. Und ob ich imstande sein werde, den Anschluss des Hauses zu wählen, in dem ich bis vor kurzem gewohnt habe. Ob ich also imstande sein werde, Santiago anzurufen, mit dem ich schon so lange nicht mehr gesprochen habe, um ihm zu sagen: »Hallo, wie geht’s? Ich bin gerade in Deutschland.« Und dabei nur eins im Kopf zu haben – die flehentliche Bitte, an mich selbst und sämtliche Götter dieser Welt, dass mir ja nicht die Stimme versagt.