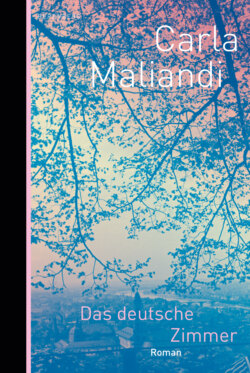Читать книгу Das deutsche Zimmer - Carla Maliandi - Страница 7
3
ОглавлениеIch bleibe den ganzen Tag in der Stadt. Erst um acht kehre ich ins Wohnheim zurück, da ist es schon dunkel. Frau Wittmann empfängt mich an der Tür und sagt, dass im Speisesaal jemand auf mich wartet. Mein Herz fängt an, wie wild zu klopfen, ich sehe Santiago vor mir, er ist gekommen, um mich zu holen, aber das kann nicht sein, unmöglich. »Auf mich? Sind Sie sicher?«, frage ich. »Ein Student aus Ihrem Heimatland, er möchte mit Ihnen sprechen«, erwidert sie, ohne mich anzusehen. Ich lächle ergeben und bedanke mich. Bevor ich weitergehe, frage ich, ob sie mir eine Schere leihen kann, und Frau Wittmann sagt, sie wird mal nachsehen, ob sie eine findet. Im Speisesaal sitzt ein junger Mann mit dunklem Teint, alles an ihm wirkt unverhältnismäßig groß, zugleich macht er einen etwas kindlichen Eindruck. Er beugt sich über ein Schachbuch. Als er aufblickt und sieht, dass ich auf ihn zukomme, erhellt sich sein Gesicht. Er dürfte nicht älter als fünfundzwanzig sein. Er sagt, er hat den ganzen Nachmittag auf mich gewartet. Ich habe ihn noch nie gesehen, aber er tut, als wären wir verwandt oder würden uns seit Ewigkeiten kennen. Er sagt, er ist aus Tucumán und heißt Miguel Javier Sánchez. Und dass er ein CONICET-Stipendium hat und dazu noch eins vom DAAD, dass er Wirtschaftspolitik studiert, vor einer Woche angekommen ist und heute erfahren hat, dass es noch jemanden aus Argentinien im Wohnheim gibt, mich. Er fragt, was ich studiere. Ich lüge und sage, ich mache einen Master in deutscher Dramaturgie. Frau Wittmann unterbricht uns, überreicht mir eine Schere und sagt, ich soll bitte vorsichtig damit umgehen. Ich bedanke mich bei ihr. Miguel Javier hört nicht auf zu sprechen, er erzählt von seinem Leben in Tucumán, von seiner bescheidenen Herkunft und davon, wie stolz seine Familie auf ihn ist, er ist der Einzige, der studiert, das Wunderkind. Dann fragt er, ob ich morgen mit ihm das Schloss besichtigen will. Ich sage ja, und dass der Weg dorthin herrlich ist, eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen. Er erklärt begeistert, dass er belegte Brote mitbringt und außerdem die Kamera, die er sich von der ersten Stipendienrate gekauft hat. Seine Begeisterung rührt mich ein wenig. Er hat den typischen Akzent der Leute aus Tucumán. Er sagt, er hat gelesen, dass das Schloss sehr schön sein soll. Dann höre ich nicht mehr zu und überlege stattdessen, wie ich mir die Haare schneiden soll. Zuerst die Spitzen, und dann so kurz, wie ich mich traue. Wenn es nicht gut aussieht, macht das nichts, hier kennt mich sowieso niemand. Miguel Javier – ein schrecklicher Name, wie sich das anhört! Die Kombination, so wie er selbst sie ausspricht, tut einem fast in den Ohren weh. Da fragt Miguel Javier, woran ich denke. Er sagt, er merkt, dass ich mit dem Kopf woanders bin. Ich erwidere, dass ich einen langen Tag hinter mir habe und müde bin. Dann verabschiede ich mich und sage, wir sehen uns morgen beim Frühstück.
Nach dem Duschen und Haareschneiden bin ich erschöpft. Todmüde falle ich ins Bett, ich, die Prinzessin im Exil, die Studentin, die keine ist, die einsame Reisende, die Flüchtlingsfrau. Ich bin gerettet. In diesem Augenblick gibt es nichts Schöneres auf der Welt als die Einsamkeit dieses gemieteten Zimmers, mein europäischer Unterschlupf, nicht luxuriös, aber sehr komfortabel, mit soliden Fensterläden, einem weißen Federbett und einem makellos sauberen Kissen. Ich erinnere mich an das Märchen von der Prinzessin auf der Erbse, nicht einmal zwanzig Matratzen reichen aus, um sie ruhig schlafen zu lassen, sie spürt die harte Hülsenfrucht trotzdem, aber dafür ist sie adlig. Ich dagegen bin eine falsche Prinzessin, und nichts kann mich um den Schlaf bringen. Keine Stimme flößt mir Angst ein, nichts stört mich, nichts bringt mich zum Zittern, triumphierend schlummere ich ein – ich bin in Deutschland und kann endlich ruhig schlafen. Ich schnuppere an dem frischen Laken und stelle mir vor, ich sei jemand anders, alles, was mich interessiert, ist der morgige Tag, mal sehen, was ich mache, was es zum Frühstück gibt, welche Straßen ich entlangspaziere.
Es klopft an der Tür, und ich wache auf. Zuerst glaube ich, ich habe das Geräusch bloß geträumt, aber dann klopft es wieder, und ich stelle fest, dass es draußen bereits hell ist. Ich stehe auf und mache, noch im Nachthemd, die Tür auf. Vor mir steht der Tucumaner und sieht mich zufrieden und vorwurfsvoll zugleich an: »Es ist schon halb neun!«, sagt er.
Ich sage, er soll bitte unten warten, ich muss mich noch fertig machen. Dann schließe ich die Tür. Während ich mich anziehe, sage ich vor mich hin, was ich davor nicht zu ihm gesagt habe: »Was schaust du so? Klopf bloß nicht nochmal so früh bei mir an, verpeilter Tucumaner.«
Ich gehe in den Speisesaal hinunter, der Anblick der frühstückenden Studenten unterscheidet sich in nichts von dem des Vortags, abgesehen davon, dass jetzt ein Bekannter unter ihnen ist. Dort drüben steht er, in der Schlange vor der Kaffeemaschine. Als er mich sieht, hebt er den Arm und schwenkt einen Teelöffel. »Hier, hier bin ich!«, ruft er.
Als wir schließlich zusammen am Tisch sitzen, erklärt der Tucumaner, dass Kaffee und Milch vom Wohnheim gestellt werden, alles Übrige müssen die Studenten selbst kaufen und mit Schildchen versehen, wenn sie es im Kühlschrank aufbewahren wollen. Da ich noch nichts zum Frühstücken habe, sagt er, ich soll mir von seinen Sachen nehmen, und fügt hinzu, dass die Läden hier am Sonntag zu haben, weshalb ich heute auf dem Rückweg vom Schloss unbedingt noch einkaufen sollte. Der Tucumaner hat unter anderem Schinken, Frischkäse und Süßkartoffelgelee anzubieten. Er öffnet eine Tupperdose und zeigt mir die dick mit Mayonnaise bestrichenen Sandwichs darin. Er sagt, er hat sie für unseren Ausflug gemacht, schon ganz früh heute Morgen, als ich noch schlief.
Das Schloss liegt hoch über der Stadt, der Weg vom Wohnheim bis dorthin dauert etwa eine Stunde. Der Tucumaner geht mit seiner Kamera voraus. Alle zehn Schritte dreht er sich um, kommentiert etwas oder macht ein Foto von mir. Während er durch den Sucher blickt, lässt er sich über meine Frisur aus, er sagt, die langen Haare hätten mir viel besser gestanden. Ich sage mir, dass wir uns noch kaum kennen, eigentlich dürfte er nicht so offen mit mir sprechen, aber die Umgebung ist viel zu schön, als dass ich meinem Begleiter irgendetwas übelnehmen könnte. Auf halber Strecke fühle ich mich plötzlich sehr müde und muss eine Pause einlegen. Miguel Javier macht sich über mich lustig. Eine amerikanische Familie, die ein kleines Stück entfernt hinter uns herging, holt uns ein und fragt, ob wir sie fotografieren können. Die Eltern sind um die vierzig, ihre drei Kinder irgendwas zwischen fünf und zwölf. Sie posieren wie professionelle Fotomodels. Als ich ihre Kamera zurückgebe, umarmt der Jüngste mich. Die Mutter zerrt ihn am Arm fort, und sie gehen weiter. Ich muss an den Traum von der Ankunftsnacht denken, an die kleine Hand des Kindes, das sich immer wieder losriss, während wir vor dem Bauern davonrannten, der meine Brüste anstarrte. Der Tucumaner sieht mich an und sagt, ich sei ganz blass. Er öffnet den Rucksack, holt die Tupperdose raus und bietet mir ein Sandwich an. Ich sage, dass ich nichts möchte, dass mir nicht gut ist – und trete an den Wegrand und übergebe mich. Der Tucumaner hält mir die Stirn, und als ich alles von mir gegeben habe, reicht er mir seine Wasserflasche und eine Serviette, damit ich mich saubermachen kann. Eine Weile sitzen wir schweigend da. Von hier oben sieht man den Fluss, der durch Heidelberg fließt, die roten Dächer und die Kirchenkuppeln. Schließlich sage ich zu dem Tucumaner, dass es mir wieder besser geht, und stehe auf, um den Weg fortzusetzen. »Wenn du mich fragst, bist du in anderen Umständen«, sagt er und erhebt sich. »In was für Umständen?«, frage ich wie gelähmt. »Du bist schwanger«, erwidert er und spricht auf dem restlichen Weg kein Wort mehr mit mir.
Der Eintritt ins Schloss kostet zehn Euro, die wir ein wenig geknickt bezahlen. An der Tür erklärt man uns, die Führung auf Spanisch beginne in zehn Minuten, wir sollten bitte warten. Miguel Javier sieht mich nicht an und sagt weiterhin nichts, man könnte meinen, er kennt mich überhaupt nicht inmitten all der Touristen. Ich breche das Schweigen.
»Woher weißt du das?«
»Was?«
»Woher weißt du beziehungsweise wie hast du gemerkt, dass ich schwanger … sein könnte?«
Der Tucumaner sieht mich auf einmal ganz anders an. Sein Gesicht, das mir im ersten Moment etwas kindlich vorkam, wirkt jetzt reif, als wäre er ein Träger uralten Wissens.
»Ich habe sechs Schwestern und fast zwanzig Nichten und Neffen. Bei jeder und jedem habe ich die Schwangerschaft mitbekommen, mit allem, was dazugehört, ich weiß, wie das abläuft. Und du hast dich nicht nur gerade übergeben, man sieht es dir auch am Blick an.«
»Was ist denn mit meinem Blick?«
»Deine Augen glänzen irgendwie, als wärst du betrunken.«
»Du kennst mich doch gar nicht, vielleicht sehe ich ja immer so aus.«
»Kann sein, aber an deiner Stelle würde ich schleunigst einen Test machen und dem Vater Bescheid geben.«
Da kommt der Touristenführer und sagt, wir sollen uns bitte im Halbkreis vor ihm aufstellen, weil es jetzt losgeht.