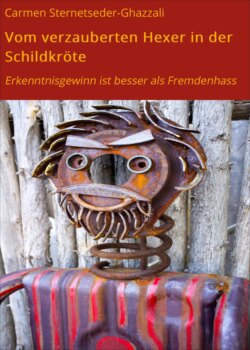Читать книгу Vom verzauberten Hexer in der Schildkröte - Carmen Sternetseder-Ghazzali - Страница 4
Wie alles anfing: Das Bordbuch des Kolumbus
ОглавлениеAls Kolumbus auf der Suche nach einem kürzeren Seeweg nach Indien am 12. Oktober 1492 auf die Bewohner der Bahamasinsel Guanahani stieß, reagierten die spanischen Seeleute angesichts der fremdartigen Menschen geschockt, ablehnend und fasziniert zugleich. Was passierte da genau? Die Guanahanier wurden von den Spaniern augenblicklich als radikal andere Menschen erkannt, die alles auf den Kopf stellten, was sie bisher von der Welt zu wissen glaubten.
Man muss wissen: Zur Zeit Kolumbus′ prägte der auf höfische Manieren und eleganten Kleidungsstil Wert legende spanische Hof das Menschenbild, daher waren die „nackten braunhäutigen“ Guanahani für die Spanier auf körperlicher Ebene wie ein Schlag ins Gesicht. Aber nicht nur das: Es folgte auch auf beiden Seiten die beunruhigende Erkenntnis, dass die jeweils fremde Kultur durchaus auch eine attraktive Alternative zum eigenen Lebensstil hätte darstellen können. Man beäugte sich gegenseitig gleichermaßen fasziniert und abgestoßen. Die zwangsläufige Infragestellung der eigenen kulturellen Werte, religiösen Überzeugungen und Weltbilder erschütterte die eigene Identität.
Wenn man die eigene Identität bedroht glaubt, reagierten und reagieren Menschen stets auf ähnliche Weise: Man hebt die kulturell fremden Menschen in transzendente Sphären empor und betrachtet sie als Götter oder Traumwesen. Oder man verweist sie ins Reich des Bösen, Barbarischen, Unzivilisierten. Oder man sieht in ihnen arme, hilflose, oftmals pathologische Kreaturen, die dringend unsere Hilfe benötigen. Für welche Möglichkeit man sich auch immer entscheidet, stets geht es darum, den für uns Fremden nicht auf Augenhöhe zu betrachten, und zu entmenschlichen.
Kolumbus hat sich für die ersten beiden Möglichkeiten entschieden. Er beschreibt in seinem Bordbuch die Arawak der westindischen Inseln als nackte, aber glückselige und edle Wilde und die Kariben als kriegerische und böse Bestien. So wie er die einen idealisierte, so verteufelte er die anderen. Sie waren für ihn keine „normalen“ Menschen, sondern verwilderte Fabelwesen, die jenseits der menschlichen Sphäre existierten. Nur dadurch, dass er die provozierend andersartigen Menschen zu Wilden stereotypisierte, konnte er Mensch bleiben.
Das war vor über 500 Jahren! Daher ist es kaum zu glauben, aber Kolumbus' Bordbuch wirkt bis heute bei uns nach. „Wie bitte“, werden Sie jetzt fragen, „ist mir etwa entgangen, dass Kolumbus′ Bordbuch ein vielgelesener Longseller ist?“ Natürlich ist es das nicht. Longseller aus anderen Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden sind mit Gewissheit Cicero- oder Ovidtexte oder die Bibel. Cicerotexte werden immer wieder neu aufgelegt, weil Lateinschüler sie lesen müssen, und die Bibel, das versteht sich von selbst, ist die Grundlage der christlichen Religion.
Christoph Kolumbus ist für uns zuerst einmal der große Entdecker aus dem Geschichtsbuch oder – noch viel mehr – ein Kinoheld, gespielt vom französischen Schauspieler Gérard Depardieu, aber gewiss kein Autor, der uns mit seinem Bordbuch ein ausgezeichnetes Dokument hinterlassen hätte. Eines, das von dem interkulturellen Erstkontakt zwischen der indigenen Bevölkerung der westindischen Inseln und den Spaniern erzählt. Eines, das uns großspurig von den Anfängen der europäischen Kolonialgeschichte aus der Sicht eines sogenannten Entdeckers erzählt, aber zwischen den Zeilen offenbart, weshalb Kulturkontakte, die von kolonialem Geist getragen werden, katastrophal enden müssen. Aber genau so ein Dokument hat er für uns hinterlassen, auch wenn es stets Spezialisten gewesen sind, die voller Faszination oder Abwehr darin lasen.
Etwa die beiden Philosophen Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau. Sie vertieften sich an ihren Schreibtischen in das Bordbuch, lasen es gründlich, lasen über die Kariben, über die Arawak, der eine in England, der andere in Frankreich, und kamen nach der Lektüre zu unterschiedlichen Schlüssen über "Wilde". Für Hobbes waren sie grundsätzlich böse und gefährlich, für Rousseau glückselige und vorbildliche Wesen. Diese widersprüchlichen Einschätzungen gehen tatsächlich auf Kolumbus′ Gegenüberstellung der „kriegerischen Kariben“ mit den „glückseligen Arawak“ zurück.
So, aber heute sind uns doch die beiden Völker kaum noch bekannt. Was hat das also mit unserem Denken über kulturell fremde Menschen zu tun? Ganz einfach: Es geht um die Denkschablonen, die wir ihnen überstülpen. Da gibt es etwa die "böse" Burka-Trägerin, im Gegensatz zum "weisen" indischen Yogi oder dem "edlen" Amazonasindianer im Federkostüm, der auf Gesundheitskongressen über Naturschutz referiert. Alle drei erfüllen für uns eine Funktion. Wir etikettieren sie, nehmen sie aber nicht als Individuen wahr.
Denn: Alles Fremde und Unbekannte wirft unsere Gewohnheiten und Identitätspfeiler durcheinander. Zu unseren Identitätspfeilern gehören unsere sozialen, religiösen und philosophischen Weltanschauungen, die wir durch unsere Sozialisation vermittelt bekommen haben. Sie sind der Überbau, sie prägen unsere Lebensweise, bestimmen unser Denken und unsere Vorurteile. Auch wenn Kultur sich ständig im Wandel befindet – schließlich leben wir heute auch nicht mehr so wie unsere Großeltern –, provozieren kulturell fremde Menschen uns dennoch. Aus dem einfachen Grund, weil sie auf die großen Fragen des Menschseins andere Wahrheiten und Erklärungsmodelle liefern. Im Lichte so mancher fremden Wahrheiten leuchten die unsrigen vielleicht weniger oder – im Gegenteil – noch viel kraftvoller. Manchmal liefern fremde Lebensweisen und die dahinter stehenden Denkmodelle sogar plausiblere Antworten auf drängende Fragen.
Entweder wehren wir die fremden Denkmodelle dann ab, weil sie unsere eigene Identität erschüttern, oder wir nehmen sie kritiklos an, schwärmen von der fremden Kultur und versuchen, uns möglichst viele Attribute der fremden Kultur anzueignen. In beiden Fällen betrachten wir die fremde Kultur aus europäischer Perspektive. Wir legen an sie unsere eigenen kulturellen Maßstäbe an. Damit versperren wir uns den Weg, das Fremde aus sich selbst heraus zu begreifen.
Heißt das, wir müssen einfach auf kulturell fremde Menschen zugehen und sie fragen, was uns an ihnen interessiert? So einfach ist es leider auch nicht. Denn Interesse an anderen Kulturen bedeutet noch lange nicht, dass wir sie auch respektieren und begriffen haben, wie sie „ticken“. Auch jemand, der jedes Jahr viele Monate in Thailand überwintert, weil Land und Leute so „toll sind“, ist nicht davor gefeit, vorschnelle Fehlurteile über die Anderen zu fällen. Zwischen ihm und den Menschen klafft noch immer ein riesiger kultureller Graben.
Man kennt das Grabenphänomen sogar von Menschen, die man als Überläufer bezeichnet, als Konvertiten, die in andere Kulturen überwechseln, weil sie mit der eigenen Kultur unzufrieden sind. Diese Überläufer dringen oft aber nur scheinbar in eine fremde Kultur ein. Auch wenn sie sich kleiden wie die geliebten Anderen, ihre Sprache lernen und ihre Speisen kochen, verkleinert sich der kulturelle Graben nicht. Sie teilen mit einem kleinen Kreis der kulturell fremden Kultur nur äußere Attribute.
Das lässt sich sehr gut am Beispiel der vielen deutschen jungen Männer zeigen, die seit dem 11. September 2001 in den Islam konvertiert sind. Statt sich textkritisch mit dem Koran und vor allem dem Kontext, in dem er entstanden ist, auseinanderzusetzen oder sich mit möglichst vielen Moslems zu unterhalten, die unterschiedliche Ansichten und Interpretationen zu ihrer Religion liefern könnten, lauschen sie lieber mit Kaftan, Häkelkappe und Vollbart oftmals den bizarren und gehässigen Interpretationen europafeindlicher Prediger.
Viele dieser Konvertiten ähneln den Menschen, die nie gelernt haben, sich eigene Urteile zu bilden. Genug Leichtgläubige fallen auf die Schimpftiraden der Boulevardzeitungen oder das von rassistischem Gedankengut getragene Buch von Thilo Sarrazin „Deutschland schafft sich ab“, oder den Reden der Afd herein. Dieselben weisen aber den Rassismusvorwurf schnell zurück. Sarrazin Buch, gleichwohl wie die Reden der Afd sind genauso rassistisch und von Feindbildern durchwühlt wie die Reden Pierre Vogels. Pierre Vogel, deutscher Konvertit in den Islam und Prediger, sieht im liberalen westlichen Lebensstil den größten Feind für den Islam; Sarrazin sieht in den muslimischen Migranten den größten Feind für das deutsche Bildungsbürgertum. Er glaubt, durch den Zustrom der vielen muslimischen Migranten verdumme die deutsche Gesellschaft, denn da sie schlecht gebildet seien, würden sie uns durch ihren Kinderreichtum allmählich unterwandern. Sarrazin spricht alte Ängste aus und schürt neue. Er etabliert eine moderne Form der alten Xenophobie, die Kulturen durch genetische Ähnlichkeiten erklären will. Auch jeder Leser, der nicht so gerne um fünf Ecken denkt, weiß genau, was Sarrazin damit meint: Die Deutschen sind klüger und haben die besseren Gene. Damit sind wir wieder hundert Jahre zurück bei den Rassentheoretikern.
Für Konvertiten, die Pierre Vogels Reden glauben, symbolisiert jedes Mädchen im Minirock den Teufel. Und unkritische Sarrazinanhänger betrachten jeden muslimischen Einwanderer mit Argusaugen oder reagieren hysterisch, sobald sie im Bus auf eine verschleierte Frau treffen. Die Verschleierte symbolisiert für sie so etwas wie eine steinzeitliche „Idiotin“. Denn sie messen die verschleierte Frau an den westlichen Werten Bildung, Freiheit und Emanzipation. Dumm nur, wenn die verschleierte Frau Abitur hat oder Elektrotechnik studiert und einen Haushalt mit zwei Kindern schmeißt, während der Sarrazinanhänger gerade mal einen Hauptschulabschluss aufweist und Schiller für eine Schnapsmarke hält.
Anstatt das kulturell Fremde aus seinem zeit- und ortsgebundenen Kontext heraus zu betrachten, reagieren die Islamkonvertiten und die Islamgegner auf das kulturell Fremde mit Abwehr (böser Islam) oder Idealisierung (edler Islam).