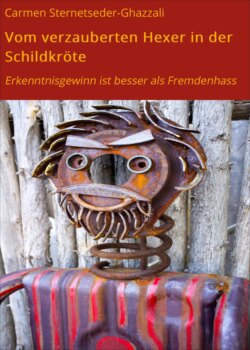Читать книгу Vom verzauberten Hexer in der Schildkröte - Carmen Sternetseder-Ghazzali - Страница 5
Wie Hobbes, Islamophobie und Drohnenkrieg zusammenhängen
ОглавлениеDer Engländer, Philosoph und Denker Thomas Hobbes (1588-1679) studierte von seinem Schreibtisch aus nicht nur das Bordbuch des Kolumbus, sondern auch sonst noch alle möglichen Berichte, die er über außereuropäische Kulturen finden konnten.
Hobbes dürfte sich vor allem aus den Schriften Walter Raleighs bedient haben, der 1585 im Auftrag der englischen Königin Elisabeth I. die Kolonie Roanoke in North Carolina gegründet hatte. Auch aus den Schriften des in Peru missionierenden Jesuiten José de Acosta und außerdem aus den Elegien des spanischen Feldherrn Garcilaso de Vega (1609-1617). De Vega zog gegen die Türken in den Krieg und es liegt auf der Hand, dass er seine Feinde als „primitive Untermenschen“ beschrieb. Auch die Schrift des französischen Theologen Jean de Léry über die brasilianischen Kannibalismusfälle (1578) dürfte auf Hobbes′ Schreibtisch gelegen haben, genauso wie das Buch von Richard Hakluyt (1589-1600) über die Berichte englischer Kapitäne und Entdecker.
Alle fünf Autoren blasen ins gleiche Horn. In das Horn, in das Menschen wie Sarrazin auch über 400 Jahre später noch blasen können, weil der Ton so schön vertraut ist. Die fünf beschreiben fremde Völker als primitiv, dumm und kriegslüstern. Letztere Eigenschaft erklären sie damit, dass diese Völker ohne Staat und Führerschaft in unstrukturierten Horden leben würden. Was ist eine Horde? Unter einer sogenannten Horde versteht man eine größere gemeinsam handelnde soziale Einheit wie eine Jäger- und Sammlergesellschaft. Man nennt sie auch Wildbeuter.
Leben Wildbeuter wirklich in strukturlosem Chaos und einer schlägt dem anderen den Schädel ein? Nein! Durch Studien bei den australischen Aborigines oder den südafrikanischen !Kung San wissen wir heute, dass die Jäger- und Sammlergesellschaften durchaus eine politische Einheit sind. Auch wenn die Gemeinschaft nur aus zwei Dutzend Individuen besteht, werden politische Angelegenheiten so lange diskutiert, bis man einen Konsens gefunden hat. Es gibt Respektpersonen, die aufgrund ihres Alters oder ihrer Erfahrungen eine übergeordnete Stellung in der Gemeinschaft erhalten, es existierte aber kein formeller Boss, der über andere Befehlsgewalt hätte. Da jeder Einzelne der Gruppe freien Zugang zu den natürlichen Ressourcen wie Süßwasser, Nahrungspflanzen und Wildtiere hat und die Gruppenmitglieder untereinander zwanglos Werkzeuge und Arbeitsmaterialien austauschen, ist eine politische Machtinstanz, die per Kontrolle und Gesetz über Ressourcen und Privilegien herrschen will, überflüssig.
Wildbeuter lehnen in vielen Fällen sogar eine Machtinstanz explizit ab, wie der französische Ethnologe Pierre Clastres herausfand. Clastres forschte zwischen 1963 und 1974 bei zahlreichen amazonischen Ethnien (Guayaki, Guarani, Chulupi und Yanomami). In der Aufsatzsammlung La société contre l`État, Staatsfeinde, vertritt er die interessante Ansicht, dass diese kleinen abgeschotteten, politischen Einheiten aus Selbstschutz dafür sorgen würden, dass keiner ihrer Häuptlinge jemals zu mächtig würde. Schließlich würde er seine Macht zulasten aller anderen dafür einsetzen, noch mächtiger zu werden.
Deshalb sind ihre Häuptlinge eher Redekünstler als Bosse. Sie müssen jeden Abend aufs Neue durch Gesänge beweisen, wie toll sie sind, dürfen aber niemals Kriege anführen oder Befehle austeilen. Schlimmer noch: Trotz ihrer herausragenden Stellung sind sie die Ärmsten ihrer Gruppe, weil sie nichts horten dürfen, weil sie alle Prestigegüter sofort weiter verschenken müssen. Statt dass der Häuptling sein Volk unter die Lupe nimmt, überwacht jeder Einzelne in der Gruppe permanent das Treiben des Häuptlings. Die Menschen ahnen oder wissen: Sobald ein Häuptling zu viel Macht und Privilegien innehat, nimmt das Unglück seinen Lauf. Er würde rasch um sich eine Clique scharen, die ihm hilft, über die Ressourcen und produzierten Güter zu herrschen. Er würde auch Gesetze erlassen, die alle anderen von den Privilegien fernhaften.
Für Clastres ist der Staat erst als Folge von Eigentum entstanden. Zum Schutz des Eigentums. So würde der Häuptling neben den Gesetzen bald schon einen Gewaltapparat schaffen, der über die Einhaltung der Gesetze wacht – und darüber, dass die von allen produzierten Waren und Lebensmittel in die Kanäle seiner Machtelite fließen.
Es birgt also erhebliche Gefahren, wenn sich politische Macht auf wenige Menschen konzentriert. Gesellschaftliche Schichtung, soziale Ungleichheit und ökonomische Ausbeutung sind die kranken Elemente aller Staaten, deren Aufrechterhaltung von einem Justiz- und Polizeiapparat überwacht wird. Um diese Übel zu vermeiden, bleiben nach Clastres viele amazonische Ethnien lieber „Staatsfeinde“ und hindern ihre Häuptlinge stetig daran, wirklich mächtig zu werden.
Man kann durchaus von heutigen Wildbeutergruppen oder von den amazonischen Ethnien auf die „Horden“ schließen, über die Hobbes in seiner Schrift Leviathan (1651) behauptet, sie haben nur geraubt, Schande zu Wasser und zu Lande gebracht und in einem Zustand des Krieges aller gegen alle gelebt.
Hobbes kannte fremde Kulturen nicht aus eigener Anschauung und konnte daher nicht wissen, dass „Horden“ einfach nur politisch anders funktionierten als der englische Staat. Daher ist das, was er von seinem Londoner Schreibtisch aus behauptet, zunächst einmal das Produkt großer Unkenntnis. Es knirscht daher schon arg im Kopf, wenn er behauptet, es gäbe bei den Wilden ohne Staat weder Ackerbau noch Schifffahrt, weder bequeme Behausungen noch Werkzeuge höherer Art, weder Länderkenntnis noch Mathematik oder Kunst. Auch keine Literatur, keine gesellschaftlichen Verbindungen, nur tausendfaches Elend, wobei das Schlimmste die ständige Furcht davor sei, ermordet zu werden. Diese stündliche Todesgefahr, so schließt Hobbes seine abstruse Schilderung, habe den Wilden ohne Staat nur die Aussicht auf ein einsames, kümmerliches, rohes und kurz dauerndes Leben geboten.1
Kann menschliche Existenz noch trostloser klingen?
Natürlich hat Hobbes auch eine Antwort parat, weshalb sich die Wilden permanent gegenseitig ermorden: Weil es keinen Führer gegeben habe, musste jeder Wilde alleine für sein Wohl sorgen und seinen Besitz verteidigen. Denn er habe noch so viel Land besäen, bepflanzen und bebauen können, immerzu sei er in Gefahr gewesen, von einem neidischen Nachbarn aus Lust auf sein Stück Land plötzlich getötet zu werden. Weil manche Wilde sogar so ruhmsüchtig und machtgierig gewesen seien, dass sie sich gerne die ganze Erde untertan gemacht hätten, sei es daher ratsam für jedermann gewesen, selbst durch Mord an den Besitz anderer zu gelangen. Nicht Fleiß und mühsame Arbeit waren die Parameter des Erfolgs, sondern Gewalt und Angriffskriege.
Um seine Argumente zu zementieren, vergleicht er seinen bösen Wilden mit einer bekannten Figur aus dem Alten Testament. Er weist im Leviathan auf den biblischen Brudermord hin. Kain erschlug Abel, glaubt Hobbes, weil er keine Justiz hatte fürchten müssen. Wenn es damals eine allgemein anerkannte Macht gegeben hätte, die eine solche Greueltat hätte rächen können, wäre der Brudermord niemals geschehen.
Dieser Abgesang auf den Jenseitsglauben und den biblischen Gott lässt seinen Lösungsvorschlag umso mehr glänzen: Als Heilmittel gegen das ständige Morden und Töten empfiehlt Hobbes den absolutistischen Staat. Hobbes war in einer Zeit ständiger Kriegsbedrohung im absolutistischen England geboren und bezeichnete sich einmal selbst als Zwillingsbruder der Angst. Absolutismus war schließlich die ihm vertraute Staatsform.
Sein Menschenbild vom gräuelsüchtigen Wilden verrät neben der Angst vor dem Zusammenbruch des absolutistischen Englands auch die Angst vor dem radikal Fremden, versinnbildlicht durch scheinbar anarchistische Wilde ohne Staat. Diese Wilden waren sein Schreckgespenst, seine Feinde. Was er über sie in den ethnografischen Berichten las, erschütterte ihn zutiefst.
Ihre bloße Existenz provozierte nicht nur sein immenses Sicherheitsbedürfnis, sie stellte auch sein komplettes Weltbild auf den Kopf, denn es schien diesen Wilden an allem zu mangeln, was zu den kulturellen Koordinaten seines eigenen Lebens gehörte. Er betrachtete sie als zerstörerische und gefährliche Elemente. Mehr noch, sie symbolisierten die Klassenfeinde der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung. (Erinnert wirklich frappierend an Sarrazins Thesen.)
Die bösen Wilden standen folglich bei Hobbes für alles, was sich dieser Ordnung widersetzte und was seine Gesellschaftsschicht daher als minderwertig und schmutzig abwehrte.
Leviathan ist keine Schrift gegen Anarchie oder ein ethnografischer Beweis, dass Wilde ohne Boss automatisch zum Wolf unter Wölfen werden würden, sondern der simple Versuch, den absolutistischen Staat zu rechtfertigen. Nur von ihm versprach sich Hobbes Schutz vor den grausamen Kriegen, die das England des 17. Jahrhunderts erschütterten. Dank seiner Sprachmächtigkeit und privilegierten sozialen Position ist es ihm gelungen, seine fiktive Denkschablone des bösen Wilden bis in unsere Zeit durchzusetzen, freilich auf Kosten der damaligen Völker aus der Neuen Welt.
Es klingt radikal, wurde aber von der damaligen und jetzigen Realgeschichte schon mehrmals bewiesen: Sinn aller pejorativen Marginalisierungen und grundlegenden Abwertung des kulturell Fremden ist seine Auslöschung. Daher ist es immer ein Alarmzeichen, wenn man andere Menschen als primitive und gefährliche Untermenschen bezeichnet, die unsere zivile Welt bedrohen würden. Sie werden dadurch zu nichts anderem als zu feindlichen Objekten unseres Vernichtungswillens, zur Beute einer Hetzjagd, die erst endet, wenn die provozierend andersartige Lebensform vom Planeten verschwunden ist.2
Sanfter klingt es zwar bei Sarrazin, wenn er über muslimische Migranten sagt: „Wer Türke oder Araber bleiben will, und dies auch für seine Kinder möchte, der ist in seinem Herkunftsland besser aufgehoben.“3 Er meint allerdings dasselbe, wenn auch auf deutschen Boden beschränkt. Seine Botschaft lautet: Eure provozierend andersartige Lebensform muss aus Deutschland verschwinden!
Islam wird gerne mit Islamismus verwechselt. Auch in der Profi-Terrorbekämpfung. Menschenverachtende, gewalttätige Gruppierungen gehören freilich bekämpft, allerdings sollte man differenzieren, wer uns nur durch seine Andersartigkeit provoziert und wer tatsächlich menschenverachtende Praktiken und Gewalttaten ausübt.
In dem von den USA praktizierten Drohnenkrieg gegen Islamisten in Pakistan observieren US-Soldaten von ihrer Station in New Mexico aus auch Zivilisten. Aus 10 000 Kilometer Entfernung studieren die Drohnenpiloten die Menschen beim Bestellen ihrer Felder, beim Wäscheaufhängen und beim Sex auf den Häuserdächern in den heißen Sommermonaten. Sobald ein vermeintlicher Feind im Fadenkreuz erscheint, markiert der Drohnenpilot am Computer die gewünschte Einschlagstelle und gibt per Mausklick den Befehl zum Raketenabschuss. Das geschieht im friedlichen New Mexico. Irgendwo in den Bergen Pakistans schlägt 16 Sekunden später eine Rakete auf freiem Feld oder in ein Gehöft ein. Traurig, wenn während der 16 Sekunden noch ein Kind durchs Fadenkreuz läuft – die Rakete kann keiner mehr aufhalten.
Auf dem Bildschirm in New Mexico erscheint ein Blitz, in Pakistan sterben nebst dem angepeilten Opfer auch Hühner und Hunde, spielende Kinder und ihre Mütter. Dass beim Drohnenkampf unschuldige Zivilisten getötet werden, gab Barack Obama im Januar 2012 zu.
Laut dem Londoner Nachrichtenbüro Bureau of Investigative soll es allein im August 2011 in Pakistan 300 Drohnenangriffe gegeben haben, dabei kamen 2 400 Menschen ums Leben, davon mindestens 400 Zivilisten. Die Tötung von Zivilisten gilt juristisch weltweit als Mordanschlag.
Unabhängig davon stelle man sich die Frage lieber nicht, ob die restlichen 2 000 Menschen wirklich islamistische Terroristen gewesen sind. Schließlich ist bekannt, dass sich pakistanische Hirten und Bauern in jenem drohnenumkämpften Landstrich oftmals wie Taliban kleiden, um von den wirklichen Taliban in Ruhe gelassen zu werden.
Das Problem im Drohnenkampf gegen die Taliban ist das Problem aller Kriege: Die Drohnenpiloten nehmen für die Tötung einzelner Kriegsfeinde die Tötung vieler unschuldiger Menschen in Kauf. Das ist nur möglich, wenn die Piloten diese Menschen als weniger wert und menschlich betrachten als sich selbst.
Damit das so ist, gibt es die Gehirnwäsche durch Feindbilder. Wie das in Diktaturen abläuft, davon berichten beispielsweise später interviewte Profi-Folterer, die während ihrer Ausbildung permanent mit Filmmaterial und suggestiven Nachrichten gefüttert wurden, bis sie wie ein dressierter Hund auf den vermeintlichen Feind reagieren konnten.
Bei den Drohnenpiloten genügt gewiss schon alleine der Verweis auf die Gefahr, die seit dem 11. September in der Welt gärt.
Neben der Entmenschlichung des Feindes erleichtert außerdem der klinische Charakter des Drohnenkrieges das Töten. So unblutig dieser Krieg in New Mexico auf der einen Seite ist, so zerfetzt er auf der anderen Seite Menschen, bei deren Sterben die Drohnenpiloten aus sicherer Distanz bequem zuschauen können. Es fehlen nur die gurgelnden und blubbernden Geräusche, die man aus Computerspielen kennt, wenn Menschen sterben.
Aber der Drohnenkrieg hat nur scheinbar sehr viel mehr mit einem Computerspiel wie Counter-Strike zu tun als mit realer Kriegsführung, tatsächlich wissen die Drohnenpiloten sehr genau, dass sie reale Menschen töten. Um ihre Opfer aber als primitiv, tierisch und weniger wert betrachten zu können, müssen sie erst eine Art Gehirnwäsche über sich ergehen lassen, in der die realen pakistanischen Menschen zu stummen, aber gefährlichen Objekten gemacht werden.
Für die Tötung von Demokratiefeinden nimmt der Drohnenpilot nach der Gehirnwäsche den Tod von Zivilisten in Kauf, weil sie für ihn nichts weiter als stereotype Figuren in einem gerechten Krieg sind. Stereotype Figuren im Sinne von bösen Wilden, primitiven Untermenschen eben, die mit ihrer provozierend anderen Lebensweise unsere Zivilisation gefährden.
Eine Drohne namens Mq-1 Predator kostet 4,5 Millionen Dollar, dafür kann sie auf einer Höhe von über 7 000 Metern über 3 700 Kilometer fliegen und eine enorme Raketenlast tragen. Auch wenn Krieg immer teurer und zielgenauer wird, human wird er niemals sein.
Im Januar 2012 demonstrierten rund 100 000 Menschen aus Karachi gegen die Drohnenangriffe, von denen sie sich zutiefst bedroht fühlen. Obwohl sie in keinster Weise mit den Taliban sympathisieren, empfinden sie es als Zumutung, dass ihr Leben nunmehr in doppelter Weise gefährdet ist. Vom Regime der Taliban und von der US-Regierung.
Aber für viele Drohnenpiloten sind die demonstrierenden Menschen aus Karachi und die Taliban irgendwie ein und dasselbe. Schließlich nehmen sie notfalls auch deren Tod in Kauf. Sie aber zu lehren, andere Kulturen differenzierter zu betrachten, widerspräche dem Wesen des Krieges.
Krieg braucht Feindbilder und die sind immer stereotyp.
Niemals darf ein Soldat die Personen im Fadenkreuz als Menschen betrachten, die genauso schutzbedürftig, lebensfreudig und voller Sehnsucht nach friedlichen Verhältnissen sind wie er selbst. Er muss nur das Böse sehen, das Karzinom, ihm gilt sein Vernichtungswille, dem gefährlichen, bösen Untermenschen. Er ist das Sinnbild des Bösen, das zerstörerische und feindliche Element der eigenen bestehenden Ordnung. Stereotype Denkschablonen gehören daher zum Anfang aller Kriege.
In einer friedlichen Welt taugen sie allerdings nicht viel. Im Gegenteil, sie schaffen Unfrieden, sorgen für Missverständnisse und produzieren eine Kultur der Vorurteile und Nörgelei.