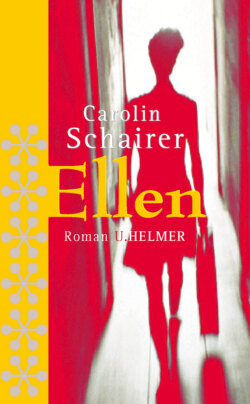Читать книгу Ellen - Carolin Schairer - Страница 4
ОглавлениеDie Berührung kam für Nina völlig unvermittelt. Gerade noch hatte sie im Halbdunkel des kleinen Technikraums das letzte Blatt der Rede kopiert, die der Geschäftsführer gleich halten wollte. Sie fischte das Original aus dem Gerät und wollte eben nach der Kopie greifen, als sie zwei Hände an ihrer Taille spürte. Sanfte Lippen und heißer Atem streiften ihren Nacken und ihren Rücken an jenen Stellen, die ihr hautenges, festliches Kleid frei ließ.
Einen Bruchteil von Sekunden war sie vom Schock der Berührung gelähmt. Dann drehte sie sich langsam um.
Sie hatte geahnt, wer sie da anfasste. Jetzt sah sie ihren Verdacht bestätigt und konnte es doch kaum glauben. Es war ihr, als würde sie die Person, deren Hände immer noch fest ihre Taille umschlossen, nicht wiedererkennen. In dem Gesicht, das ihr sonst durch seine Kälte und Starrheit stets Bauchweh verursachte, stand nun hungrige Gier. Graugrüne Augen funkelten sie an wie die einer Katze, kurz bevor sie auf die erspähte Maus losspringt.
Nun war Nina die Maus. Die Katze stürzte sich lautlos auf sie, ohne auf ein Zeichen der Zustimmung zu warten. Der Zangengriff um ihre Taille schloss sich. Sie wurde gegen die Wand gedrückt und spürte den schlanken, muskulösen Körper, der sich an sie presste. Lippen senkten sich auf ihr weites Dekolletee.
Noch konnte Nina klar denken. Sie wusste, dass die einzig normale Reaktion gewesen wäre, zu schreien und die Gestalt wegzustoßen. Sie hatte diese Berührungen weder gewünscht noch in irgendeiner Form provoziert. Ganz im Gegenteil: Dieselbe Person, die ihr hier nun weiche Knie und ein zunehmendes Hitzegefühl im Bauch bescherte, ließ ihr den neuen Job fast täglich zu einer Horrorvision werden. Die Herablassung, mit der sie von ihr behandelt worden war, hätte sie beinahe dazu veranlasst, gleich wieder zu kündigen. Nur ihre Geldprobleme und die schmale Aussicht, je wieder eine ähnlich gut bezahlte Arbeit zu finden, hatten sie zum Bleiben bewogen.
Die Behandlung, die ihr jetzt zuteil wurde, hatte nichts mit Kälte und Herablassung zu tun. Die sonst so frostigen Lippen glitten ihren Hals entlang und hinterließen kleine brennende Flecken auf ihrer Haut. Die Hände hatten den Zangengriff aufgegeben und streichelten intensiv über ihren Rücken, ihre Brust, ihren Bauch.
Die Hitze in Nina stieg. Sie schloss die Augen und überließ sich den Händen, die nun ihren Po umfassten und sie noch enger heranzogen. Nina warf den Kopf in den Nacken und gab ihren Hals dem Mund ihres Gegenübers preis.
Ich bin verrückt, schoss es ihr durch den Kopf. Völlig verrückt. Ich sollte hier weg. Doch weder ihr Verstand noch ihre zittrigen Beine wollten gehorchen. Stattdessen öffnete sie mit einem unterdrückten Seufzen den Mund und versank in einen gierigen, fordernden Kuss. Noch nie war sie so geküsst worden. Dass ein Kuss bei ihr überhaupt derartiges auslösen konnte, war ihr völlig neu. Sie fühlte sich, als wäre ihr Körper aus weichem Gummi. Die fremde Zunge in ihrem Mund entlockte ihr ein tiefes Stöhnen. Sie selbst verlor sich ganz und gar in dem Mund, der sie küsste, und genoss den lockenden Geschmack des Unbekannten.
Nach kurzem beiderseitigen Ringen um Atem berührten sich ihre Lippen erneut. Nina spürte, dass der Körper, der sich dicht an sie presste, ebenso vibrierte wie ihr eigener. Sie spürte den schnellen Atem auf ihrer Haut und das Feuer, das nicht nur in ihr selbst aufzulodern begann.
Die Lippen lösten sich voneinander. Nina wagte nicht, die Augen zu öffnen. Die begierigen Küsse hatten sie vergessen lassen, wo sie sich befand – und vor allem, mit wem. Hände, die nun sanft ihre Pobacken massierten und Nina zu erregtem Luftholen veranlassten, ließen sie erfolgreich verdrängen, dass sie soeben dabei war, in einer stickigen Kammer mit Druckern, Faxgeräten und Kopierer den Verstand zu verlieren. Und das durch Ellen McGill, eine Frau – eine Frau! –, die normalerweise nur in knappen Imperativsätzen mit ihr kommunizierte oder ihr vermeintliches Unwissen schonungslos durch rhetorische Fragen entblößte. Nina war zu erregt, um sich den Kopf darüber zu zerbrechen, was sie mehr schockierte: Dass sie, die bisher ausschließlich mit Männern zusammen gewesen war, dermaßen auf die Berührung einer Frau reagierte, oder dass es ausgerechnet die McGill war, die ihr nun behände das Kleid nach oben schob und ihre Hand an den seidigen Strümpfen hinaufgleiten ließ.
Nina keuchte. Sie fühlte, wie Nässe zwischen ihre Beine schoss. Die sanfte Berührung von Ellens Hand an der kleinen unbedeckten Stelle zwischen Strumpfband und Halterung brachte ihren Körper noch mehr zum Glühen.
Ellens Hand griff ihr direkt zwischen die Beine. Nina schrie überrascht auf – überrascht, weil sie nicht damit gerechnet hatte, dass die Berührung eine weitere Woge von Hitze und Lust durch ihren Körper jagen würde. Ellen begann ihre Hand gleichmäßig zu bewegen. Der dünne Stoff des Tangas rieb an Ninas Mitte, und sie hatte das Gefühl zu zerfließen. Noch nie hatte eine Liebkosung dieser Art bei ihr dazu geführt, dass sie vor Nässe zu zerlaufen glaubte. Gewöhnlich war dieser Punkt beim Sex genau ihr Problem.
Doch hier und jetzt war das anders. Sie kannte sich selbst nicht mehr. Ellen, die verhasste Ellen, erweckte in ihr Gefühle von Leidenschaft und Lust, von denen sie nie geglaubt hatte, dass sie sie jemals empfinden könnte. Instinktiv bog sie sich ihr entgegen, wollte sie noch mehr spüren … noch intensiver.
Ellen tat ihr den Gefallen. Zwei ihrer Finger fanden den Weg unter Ninas Slip. Nina keuchte noch mehr. Hitze strömte durch ihren Körper, erfüllte in Wogen ihr Innerstes, brachte ihr Blut zum Kochen und ihr Herz zum Pochen, als würde es jeden Augenblick zerspringen.
Ellens erregtes Stöhnen an ihrem Ohr zu vernehmen steigerte ihre Lust und nahm ihr fast den Atem. Ihre Beine waren zu Wachs geworden und drohten wegzuknicken. Ellen stützte sie mit der linken Hand, während die Finger der rechten immer schneller über Ninas Klitoris glitten.
Ninas Wahrnehmung setzte aus.
In ihr brachen sämtliche Dämme. Sie schrie, keuchte, gab Laute von sich, die ihre Stimmbänder noch nicht gekannt hatten. Schließlich sank sie in sich zusammen. Ellens Arme fingen sie auf, sie hörte Ellens erregtes Keuchen, spürte deren rasenden Herzschlag. Ellens Körper war noch immer gespannt wie eine Feder. Nina selbst fühlte sich weich und schwebend. Sie war fern davon, Widerstand zu leisten, als Ellen sie in eine Ecke bugsierte und sich heftig an ihrem Schenkel zu reiben begann.
Nina spürte das angenehme Kribbeln, dass ihr die Reibung verursachte, doch ihr Körper war noch zu erschöpft, um etwas anderes zuzulassen als passives Verharren und ein erstauntes Zusammenzucken, als Ellen schließlich mit einem unterdrückten Aufschrei kam und sich sanft gegen sie fallen ließ.
Nina verlor dadurch das Gleichgewicht und taumelte gegen die Wand. Sie schrie auf – diesmal nicht vor Lust, sondern vor Schmerz. Ein Heizungsrohr drückte unsanft gegen ihren Rücken und beförderte sie von einer Sekunde auf die andere zurück in die Realität. Die Kammer der Lust wurde im Nu zum Kopierraum, und die geschickte Liebhaberin verwandelte sich zurück in Ellen McGill.
Ellen ließ abrupt von ihr ab und wich zwei Schritte zurück. Ihre Blicke trafen sich. Nina sah sekundenlang in zwei verzweifelt blickende Augen, die eine überraschende Verletzlichkeit preisgaben. Dann war es, als lege jemand eine Maske über das Gesicht. Ellen McGill wurde von einem Augenblick zum anderen wieder zu der abweisenden, kalten Person, als die sie Nina kennen gelernt hatte.
»Oh, shit!«
Mehr sagte Ellen nicht. Dann drehte sie sich um und ging.
Nina starrte ihr fassungslos nach. Sie begann am ganzen Körper zu zittern. Innerhalb von wenigen Minuten war ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt worden.
Sie hatte Untreue immer verurteilt. Und jetzt gerade hatte sie ihren Freund betrogen. Sie war an Frauen nie in sexueller Hinsicht interessiert gewesen. Und jetzt hatte sie mit einer geschlafen. Sie hatte einen solch intensiven Orgasmus bisher nur aus blumigen Schilderungen anderer gekannt. Und soeben hatte sie das zum ersten Mal selbst erlebt.
Außerdem hasste sie Ellen McGill. Da passte Sex mit ihr einfach überhaupt nicht ins Bild.
Aber das Schlimmste an allem war: Sie war danach mit einer uncharmanten Aussage einfach sich selbst überlassen worden. Auch das war ihr noch nie passiert. Spontaner Sex, anonymer Sex, One-Night-Stands – das hatte es in ihrem Leben noch nie gegeben. Nina setzte stets auf Vertrauen und Langfristigkeit. Gewöhnlich ging sie mit einem Mann erst nach mindestens fünfwöchiger Bekanntschaft und zehn Treffen ins Bett. Zu groß war ihre Angst vor Verletzung oder der Fremdheit, die sich möglicherweise ihrer bemächtigen würde, wenn sie sich danach in die Augen sahen.
So wie jetzt.
Nina wollte nur noch weinen.
Sie war gerade dabei, mit zitternder Hand ein paar Strähnen in ihrer Hochsteckfrisur zu befestigen, die sich durch das Intermezzo mit Ellen McGill gelockert hatten, als eine vertraute Gestalt im Türrahmen erschien.
»Puh, Nina, hier bist du! Wieso machst du denn kein Licht an?«
Jasna, ihre Kollegin, betätigte den Lichtschalter und tauchte den Raum in gleißendes Neonlicht. Nina kniff geblendet die Augen zusammen. Gleichzeitig versuchte sie, das Zittern ihres Körpers vor Jasna zu verbergen.
»Wir warten auf dich.« Leiser Vorwurf lag in Jasnas Stimme. »Wegen der Kopie der Rede. Der Tontechniker braucht sie ganz schnell, um die Musik an den richtigen Stellen einzuspielen. Hast du sie nun kopiert?«
Sie nickte schwach und wies mit dem Kinn in Richtung des Kopierers. Jasna nahm das Blatt an sich. Ihr Blick blieb an Nina hängen, wie sie kalkweiß und zitternd an der Wand lehnte. »Sag mal – ist dir nicht gut?«
»Mir ist irgendwie schwindlig«, sagte Nina leise. Das war nicht gelogen.
»Ja, um Gottes willen – so plötzlich?« Jasna schien wirklich besorgt. »Magst du nach Hause fahren?«
Nina nickte. »Ja. Ja, ich denke, das ist besser.« Der Gedanke, in ihrem Zustand und nach diesem Erlebnis auf die Firmenfeier zurückzugehen, zu lachen, zu scherzen, Cocktails zu trinken und so zu tun, als sei nichts geschehen, war ihr unerträglich.
»Ich werde dir ein Taxi rufen«, erklärte Jasna hilfsbereit und zückte ihr Handy. Als sie auflegte, fiel ihr etwas ein. »Sag, hast du Ellen gesehen? Sie war noch gar nicht auf der Feier …«
»Nur flüchtig«, sagte Nina ausweichend. Ihr Puls ging bei der bloßen Erwähnung von Ellens Namen schneller und ihr flaues Gefühl im Magen wurde zur Übelkeit.
Jasna zuckte mit den Schultern. »Ach Gott. Die Arme wird wahrscheinlich wieder unzählige Überstunden machen. Ich nehme an, sie wird die Feier spritzen. Soviel ich mich erinnere, muss sie morgen auch noch früh aus den Federn. Dienstreise nach Berkeley, für den Rest der Woche.«
Für Nina war dies die zweitbeste Nachricht, die Jasna ihr hatte überbringen können. So hatte sie ein paar Tage Zeit, nachzudenken, was sie tun konnte. Vielleicht würde sie sogar einen neuen Job finden.
Als Nina fünf Minuten später ins Taxi stieg, hoffte sie jedoch, dass am Montag der nächsten Woche die beste Nachricht ins Haus flatterte: Ellen McGill hat das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen.
Nina konnte sich nicht vorstellen, ihr nach diesem Zwischenfall nochmals über den Weg zu laufen. Sie wollte diese Frau nie wieder sehen. Dieses peinliche Erlebnis musste vergessen werden – so, als wäre es nie geschehen.
»Das heißt, Sie haben das Studium abgebrochen, als Texterin gearbeitet, eine Graphikdesign-Ausbildung begonnen und abgebrochen, haben dann rund ein Jahr lang bei einer PR-Agentur gearbeitet und sind jetzt wieder als Texterin tätig.«
Nina fühlte sich angesichts dieser Kurzfassung ihres Lebenslaufes zunehmend unwohl. Den Mann mit der Hakennase, der hinter dem Schreibtisch thronte und in ihren Unterlagen blätterte, konnte sie schwer einschätzen. Er hatte ihr freundlich die Hand gereicht und ihr aufmunternd zugelächelt, als er sie aufforderte, von ihrem Werdegang zu erzählen. Trotzdem: Jetzt, da er die Stationen ihres Lebens kurz und trocken zusammenfasste, schien es ihr so, als drücke sein Tonfall leichte Missbilligung aus.
»Sie sind in Ihrer Kindheit recht oft umgezogen«, sagte die Frau, die neben ihm saß. Sie hatte sich als Jasna Milic vorgestellt – mit dem Zusatz: »Wenn Sie eingestellt werden sollten, bin ich Ihre Kollegin.«
Für Nina hatte das etwas von der Verkrampfung genommen, die sie bei Vorstellungsgesprächen stets befiel. Sie hasste nichts mehr, als sich selbst präsentieren zu müssen wie ein Stück Rind am Viehmarkt. Seht her, ich bin das Beste, besser als alle anderen, nehmt mich. Sie hielt sich aber nicht für besser, ganz im Gegenteil. Und sie hasste es, anderen die weltgewandte kontaktfreudige PR-Lady vorzuspielen, die sie ihrer Selbsteinschätzung nach wirklich nicht war.
Doch sie brauchte den Job. Sie brauchte ihn weit dringender, als diese Leute es sich vorstellen konnten. Sie und Lukas hatten sonst ein Riesenproblem. Ihr Vermieter würde sich nicht noch um einen weiteren Monat mit der Miete vertrösten lassen, und das Bankkonto war auch schon überzogen. Lukas würde das Problem nicht lösen.
Also biss Nina die Zähne zusammen und versuchte das zu verkörpern, was von ihr als Anwärterin eines Jobs im hiesigen Pressebüro erwartet wurde. Das liebenswürdige Lächeln, mit dem Jasna Milic ihre Feststellung unterstrichen hatte, machte ihr neuen Mut.
»Ja«, erwiderte sie. »Meine Eltern sind im künstlerischen Bereich tätig. Wir haben daher einige Jahre in Italien gelebt und später dann eben in verschiedenen deutschen Städten.«
Ihre Mutter war Performance-Künstlerin mit Gelegenheitsauftritten, ihr Vater Bühnenbildner ohne Festanstellung. Die Umzüge waren schlicht notwendig gewesen, um zu überleben. Außerdem konnten ihre Eltern ohnedies keine Wurzeln schlagen und hatten sich bereits vor Jahren einvernehmlich getrennt, um eigene Wege zu gehen. All das ließ Nina unerwähnt, da gewiss nicht einmal eine Scheidung zu den Wertvorstellungen gehörte, die hier als positiv erachtet wurden. LENOPHARM hatte schließlich solide deutsche Wurzeln. Dass sowohl Michael Brauer, der Personalchef, als auch Jasna Milic einen Ehering trugen, war ihr nicht entgangen.
»Dann können Sie sicher gut Italienisch«, erkundigte sich Jasna interessiert.
»Na ja, wahrscheinlich besser als der Durchschnitt«, meinte Nina bescheiden. Dann rief sie sich in Erinnerung, dass Selbstmarketing wichtig war, und setzte im Brustton der Überzeugung hinzu: »Ich spreche es fast fließend.«
»Unsere Firmensprache ist Englisch«, sagte Brauer ruhig. »Das ist kein Problem, nehme ich an.«
»Aber nein«, sagte Nina. In dem Wissen, dass das so nicht richtig war, krampften sich ihre Hände ineinander. Englisch war keine ihrer Stärken. Wieso sollte sie in einem deutschen Unternehmen auch Englisch sprechen müssen?
Brauer lieferte die Erklärung nach, als könne er in ihren Gedanken lesen. »Als Mitarbeiterin unserer Pressestelle haben Sie natürlich länderübergreifend PR-Maßnahmen abzustimmen. Gelegentlich müssten Sie auch an internationalen Meetings und Workshops teilnehmen.«
»Aha«, sagte Nina. Die Anspannung ergriff wieder von ihrem ganzen Körper Besitz. Der Job war eindeutig eine Nummer zu groß für sie, das war klar. Das finanzielle Darben würde also kein Ende haben. Vor ihrem geistigen Auge sah sie sich und Lukas bereits mit den wenigen Habseligkeiten, die sie hatten, in den U-Bahn-Bögen schlafen.
»Was hat Sie dann letztendlich nach Wien verschlagen?« erkundigte sich die Dame, die wohl nie ihre Kollegin werden würde.
»Mein Freund macht hier eine Musicalausbildung«, antwortete Nina. Da sie innerlich sowieso mit dem angebotenen Job abgeschlossen hatte, machte sie sich schon keine Gedanken mehr, ob ihre Aussage negativ oder positiv bewertet wurde.
»Und was sind Ihre familiären Pläne?«, erkundigte sich Brauer, ohne eine Miene zu verziehen. Nina wusste, auf was er anspielte. Ihre Antwort war ehrlich.
»Mein Freund ist, wie ich sagte, noch in der Ausbildung. Wir haben derzeit keine Pläne, zu heiraten oder Kinder zu kriegen. Allerdings – sollte ich zufällig schwanger werden, würde ich nicht abtreiben.«
Jasna Milic lächelte. Michael Brauner machte sich eine Notiz auf ihrem Lebenslauf.
Nina malte sich aus, dass er etwas vermerkt hatte wie »karriereuntauglich« oder »sentimental«. Aber gut – der Job war ja, wie sie festgestellt hatte, sowieso nichts für sie.
»Tja, nun gut«, setzte Michael Brauer erneut an und leitete damit offensichtlich das Ende des Gesprächs ein. »Gibt es von Ihrer Seite noch Fragen?«
Nina kam nicht dazu, höflich zu verneinen. Denn im selben Moment klopfte jemand energisch an die Türe und trat ein. Dieser Jemand war ein schlanker, hochgewachsener Mann mit Brille, der in einem Alter war, in dem er Ninas Großvater hätte sein können. Er trug Anzug und Krawatte.
»Oh, ich wusste nicht, dass Sie besetzt sind, Brauer«, sagte er. Nina bemerkte den norddeutschen Einschlag in seinem Tonfall. Sie spürte deutlich, dass das Verhältnis der beiden Männer nicht gerade von Sympathie geprägt war.
Brauers Mienenspiel verriet Anspannung, als er eine Spur zu schnell sagte: »Keine Ursache. Nur ein Vorstellungsgespräch für die freie PR-Stelle. Wir wollten die Dame gerade verabschieden.«
Nina wollte sich gerade gehorsam erheben, als der Blick des Norddeutschen auf sie fiel. Es war ein kurzes, irritiertes Aufflackern in seinen Augen, das ihr ebenso wenig entging wie Michael Brauers Reaktion zuvor. Ähnlich wie Brauer hatte sich aber auch der weißhaarige Herr sofort wieder unter Kontrolle. Zu Ninas Erstaunen streckte er ihr nun mit liebenswürdigem Lächeln die Hand entgegen.
»Guten Tag. Philipp Michaelis, Teilhaber von LENOPHARM. Und mit wem habe ich das Vergnügen?«
»Nina Blume.«
Michaelis Lächeln vertiefte sich. »Das ist ein hübscher Name«, stellte er fest. Unaufgefordert nahm er auf dem überzähligen Stuhl auf Brauers rechter Seite Platz und griff nach dem Ausdruck ihres Lebenslaufs. Er überflog ihn kurz, dann sagte er: »Nun, Brauer, ich hoffe, Sie haben der jungen Dame die richtigen Fragen gestellt.«
Brauer nickte, aber Nina merkte, dass ihm die Einmischung von Michaelis absolut nicht gefiel. Auch sie selbst fühlte sich unwohl, weil sie insgeheim froh darüber gewesen war, dass sie verabschiedet werden sollte, und nun hatte es den Anschein, als würde alles von vorne beginnen – nur mit einer anderen Person, die die Fragen stellte.
»Hier steht: Familienstand ledig«, stellte Michaelis fest. »Wieso ledig?«
Nina zuckte zusammen. Warum nicht ledig, ging ihr durch den Kopf. Warum stellte dieser Mann solch eine seltsame Frage? Wurde bei LENOPHARM erwartet, dass eine Frau mit siebenundzwanzig Jahren schon verheiratet war?
Michaelis lächelte sie noch immer an. Es war offensichtlich, dass er auf eine Antwort wartete.
Nina schluckte. »Ich … wir sind erst zwei Jahre zusammen«, sagte sie schließlich. »Das ist noch nicht so lange.«
»So, so.« Michaelis legte die Hand auf sein Kinn und betrachtete sie eingehend. Nina zwang sich, ruhig sitzen zu bleiben, obgleich ihr innerster Wunsch war, den Raum sofort zu verlassen. Wie kam sie dazu, ihre Beziehung zu Lukas in dieser Form darlegen zu müssen?
»Wissen Sie«, begann Michaelis nun, ohne sein Lächeln zu verlieren. »Ich denke immer ziemlich absolut, wenn es um Gefühlsangelegenheiten geht. Entweder passt man zusammen, oder man tut es nicht. Manchmal merkt man das nicht gleich, zugegeben. Aber nach einiger Zeit sagt das Herz immer, was es will – auch, wenn der Verstand es vielleicht nicht wahrhaben mag. Das Herz lügt nie. Stimmen Sie mir da zu?«
Nina war völlig verwirrt. Sie fragte sich noch immer, was der Sinn dieser seltsamen Fragen war.
»Ich weiß nicht«, sagte sie unschlüssig.
»Es ist so«, meinte Michaelis. »Denken Sie darüber nach. – Was ist Ihre größte Schwäche?«
Eigentlich war sie auf diese Standardfrage vorbereitet. Sie wusste, was Unternehmen und Personalchefs erwarteten, und sie formulierte in Gedanken bereits ihre Standardantwort: »Ich bin zu ungeduldig und zu gründlich«, doch Michaelis hatte sie durch seinen Exkurs über die Liebe so irritiert, dass sie mit der Wahrheit herausplatzte.
»Trockene Arbeiten langweilen mich schnell.«
Ihr entging der amüsierte Blick nicht, den Brauer mit Jasna Milic austauschte. Doch Michaelis veranlasste ihre Antwort nur zu einer weiteren Frage. »Was meinen Sie damit?«
»Wenn etwas zu wenig kreativen Spielraum bietet. Und wenn keine Überraschungsmomente da sind.«
»Tja, dann dürften Sie in der Pharmaindustrie genau richtig sein«, kommentierte Michaelis trocken. »Bei uns gibt es keine Woche ohne Überraschungen: Rückholaktionen, neue Studien, die eines unserer Medikamente in Frage stellen, plötzlich entdeckte Nebenwirkungen … langweilig würde Ihnen da sicher nicht, und kreativ werden können Sie auch, wenn es darum geht, diese Unregelmäßigkeiten in verständlichen Worten der Presse zu erklären. – Und was ist Ihre größte Stärke?«
Nina konnte sich kaum vorstellen, dass dies die Art von Überraschungen war, die sie davor bewahrte, sich zu langweilen. Doch sie konnte dem Teilhaber eines Pharmaunternehmens schließlich nicht ins Gesicht sagen, dass sie Medikamente nur dann interessierten, wenn sie selbst krank war.
Statt dessen suchte sie nach der Standardantwort auf ihre größte Stärke, resignierte und sagte, was ihr spontan in den Sinn kam.
»Ich denke viel über Menschen nach.«
Brauers Lippen formten sich zu einem dünnen Lächeln. Ihr entging nicht, dass er mit ihrer Antwort nichts anfangen konnte.
Michaelis dagegen fragte weiter. »Wie meinen Sie das?«
Nina wäre am liebsten einfach davongestürzt. Es wurde ihr hier gerade ein Seelenstriptease abverlangt und daran trug sie selbst die Schuld. Es hatte an ihr gelegen, das Gespräch auf einer Sachebene zu steuern. Stattdessen gab sie Einblicke in Aspekte ihrer Persönlichkeit, von denen selbst die meisten ihrer Freunde nichts wussten. Doch Michaelis wartete auf eine Antwort, und sie hatte nicht den Mut, ihm zu sagen, dass ihr seine Fragen zu nahe gingen.
»Ich versuche, Menschen in ihrer Individualität zu begreifen. Ich mag Oberflächlichkeit nicht. Die meisten Menschen agieren ständig wie Besucher eines Maskenballs: Sie schlüpfen in Rollen und verdecken ihr Gesicht, um nicht in ihrer Seele erkannt zu werden. Sie haben für jeden Anlass eine passende Maske. Aber ihr wahres Ich zeigen sie selten. Ich will am liebsten hinter diese Masken zu blicken.«
Eine Weile sagte keiner etwas.
Sogar Brauer hatte aufgegeben, süffisant zu lächeln. Michaelis wirkte sehr nachdenklich, und Jasna Milic hing anscheinend ihren eigenen Gedanken nach. Überraschenderweise war sie es, die als erste die Stille durchbrach.
»Das ist ein interessanter Vergleich. Ich habe neulich für meinen Sohn ein Kinderbuch gekauft, das genau dieses Thema behandelte – natürlich sehr vereinfacht dargestellt. Es ging um einen Prinzen, der furchtbare Angst hatte, sich seiner Prinzessin in seiner wahren Gestalt zu zeigen, und mit Hilfe von Magie immer wieder in andere Gestalten schlüpft. Ich nehme nicht an, dass Sie das Buch kennen, Sie haben ja keine Kinder …«
Nina Herz begann freudig zu klopfen. Zum ersten Mal seit Beginn des Gesprächs fühlte sie sich in ihrem Element.
»Ich kenne es«, sagte sie. Ihre Augen leuchteten. »Sehr gut sogar. Ich habe es geschrieben!«
»Nein!« Jasna Milic hätte überraschter nicht sein können. »Sie sind diese Nina Blume von ›Prinz Wendolins Suche nach dem Glück‹? – Das gibt es doch nicht!«
»Eine Kinderbuchautorin«, stellte Brauer fest. Auch er klang überrascht. Nina fühlte, dass sie in seinem Ansehen erstmals seit Betreten dieses Raumes stieg.
»Mein Sohn liebt dieses Buch«, sagte Jasna. »Ich muss ihm jeden Abend vor dem Einschlafen vorlesen. – Ich kann immer noch nicht glauben, dass Sie die Autorin sind. Stammen die Zeichnungen auch aus Ihrer Feder?«
Nina unterdrückte ein Schmunzeln. Es amüsierte sie immer wieder, dass die meisten Leute ihren Namen auf der Buchklappe primär mit dem Text in Verbindung brachten. Für sie selbst standen stets die Zeichnungen im Vordergrund. Mit den Zeichnungen vor ihrem inneren Auge bildete sich die Geschichte und entstand das Buch. Der Text war für sie nur eine nebensächliche Notwendigkeit.
»Ja, Text und Graphik.«
»Und wie geht die Geschichte aus?«, schaltete sich nun Michaelis ein.
»Irgendwann versagt die Magie und Prinz Wendolin muss seiner Prinzessin in seiner wahren Gestalt gegenübertreten«, erzählte Nina. Ihre innere Anspannung war verschwunden. »Er hält sich für unvollkommen und hat Angst, die Liebe der Prinzessin zu verlieren, doch zu seinem Erstaunen fällt seiner Liebsten nicht einmal auf, dass er in anderer Gestalt erscheint. Denn sie sieht nur sein gutes Herz, nicht die äußere Hülle. Und der Prinz begreift, dass Maskerade nicht notwendig ist, um Menschen für sich zu begeistern.«
»Eine schöne Geschichte«, stellte Michaelis fest. Zu Brauer meinte er: »Warum sagen Sie mir nicht gleich, dass wir hier eine berühmte Kinderbuchautorin vor uns sitzen haben?«
»Das war nicht Thema unseres Gesprächs.« Brauer wirkte sichtlich unangenehm berührt.
»Sehen Sie – gut, dass ich noch dazu gestoßen bin.« Michaelis sandte Nina ein offenes Lächeln. »Es ist eben immer wichtig, bei Vorstellungsgesprächen die richtigen Fragen zu stellen. Was machen Sie sonst in Ihrer Freizeit, Frau Blume? Sind Sie sportlich?«
»Nicht besonders«, gab Nina zu. »Früher habe ich einige Jahre Jazzdance gemacht.«
»Und was ist mit Outdoor-Aktivitäten? Klettern, Rafting, Paragliding oder ähnliches?«
»Ich habe Höhenangst.«
»Gut. Das ist gut.« Michaelis wirkte zu Ninas Erstaunen regelrecht erleichtert. Er erhob sich nun. »Ich glaube, wir wissen, was wir wissen wollten. Herr Dr. Brauer wird sich bei Ihnen bis Ende dieser Woche wegen des Jobs melden.«
Als Nina den vierstöckigen Glaspalast verließ, der zwischen den Altbauten von Wien-Leopoldstadt am Donaukanal thronte, war sie noch immer verwirrt. Noch nie hatte sie so ein persönliches Vorstellungsgespräch erlebt. Mit ihrer Enttarnung als Kinderbuchautorin hatte sie sich wohl endgültig für den Job als Mitarbeiterin in einem Pharma-Pressebüro disqualifiziert. Zu einem Unternehmen wie LENOPHARM passte sie nun einmal nicht. Im Grunde war sie sich sicher, dass niemals irgendein Unternehmen wirklich zu ihr passen würde. In Wahrheit wollte sie nur eines: Kinderbücher gestalten – frei nach ihren eigenen Ideen. Doch davon konnte sie nicht leben. »Prinz Wendolins Suche nach dem Glück« war ihr bisher einziges Buch gewesen, das verlegt wurde. Es war im November vergangenen Jahres erschienen, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Geld hatte sie bisher noch keines gesehen.
Nina hatte sich in den Vertrag gefügt, weil es ihr als die einzige Chance erschien, jemals eines ihrer Bücher zu publizieren. Sie malte, seit sie fünfzehn war; es gab unzählige illustrierte Geschichten in ihrem Schrank. Sie hielt sie allesamt für zu schlecht für eine Einreichung bei Verlagen und hatte sich daher nie darum bemüht. »Prinz Wendolins Suche nach dem Glück« hatte sie nur deshalb eingeschickt, weil ihr Freund Lukas sie permanent dazu ermutigt hatte. Sie war ihm dankbar dafür, dass er an ihr Talent glaubte.
Um sich über Wasser zu halten, schrieb sie als freie Mitarbeiterin PR-Texte für Werbeagenturen. Sie schrieb über Waschmittel, Gesichtscremes, soziale Projekte, natürliche Schlankmacher und sogar über den praktischen Wert moderner Reinigungsanlagen für Gartenteiche, damit sie und Lukas zumindest etwas zu essen hatten. Zur Miete reichten ihre kärglichen Einkünfte, die stark von der Auftragslage abhängig waren, nicht immer. Das war auch der Grund, weshalb sie gerade wieder mit zwei Monatsmieten im Rückstand waren. Zum Glück war die Vermieterin, eine wohlhabende ältere Dame, bisher sehr nachsichtig gewesen. Doch auch diese Nachsicht würde ihre Grenzen haben.
Als sich Michael Brauer zwei Tage später bei ihr meldete und ihr mitteilte, sie hätte den Job, war sie mehr als nur überrascht. Sie hatte nach diesem merkwürdigen Vorstellungsgespräch wirklich nicht damit gerechnet, die Stelle zu bekommen. Sie hatte ein seltsames Gefühl, als sie den Vertrag unterzeichnete, doch im Angesicht ihrer finanziellen Lage sah sie sich nicht in der Lage, abzusagen.
Der Wecker klingelte um kurz nach sieben. Während Nina wie eine Feder aus dem Bett schnellte und im Halbdunkel nach der Stop-Taste suchte, rollte sich Lukas mit unwilligem Grunzen auf die andere Seite und verbarg seinen Kopf unter dem Kopfkissen.
Nina konnte ihn gut verstehen. Sie waren am Vorabend beide erst um halb zwei ins Bett gekommen. Einer von Lukas’ Kumpels aus der Musicalklasse hatte Geburtstag gefeiert. Es war ein rauschendes Fest gewesen. Sie hatten die Party als erste verlassen – sehr zum Unwillen ihres Freundes, der gerne noch weitergefeiert hätte.
Während sie sich in der Küche über dem Waschbecken die Zähne putzte, fragte sie sich, wie es ihr wohl erst in drei Monaten gehen würde. Sie machte den Job bei LENOPHARM erst seit drei Tagen und fühlte sich bereits reif für die Insel. Fünf Stunden Schlaf waren ihr auf Dauer einfach zu wenig. Aber es war schwierig, mit Lukas früher ins Bett zu kommen, selbst wenn es keine Party gab.
Sie waren beide Nachtmenschen und gewohnt, morgens lange zu schlafen. Lukas, dessen Unterricht gewöhnlich erst um frühestens elf Uhr begann, sah keinen Grund, sein Leben umzustellen. Da die Wohnung, abgesehen von der Küche, in der auch Dusche und Waschbecken untergebracht waren, nur aus einem Zimmer bestand, konnte Nina nicht einfach früher ins Bett gehen und schlafen. Nicht nur Lukas’ Lärmkulisse machte dies unmöglich, sondern auch die räumliche Enge. Sie schliefen auf einer ausziehbaren Couch. Wenn die Couch zum Bett wurde, beanspruchte die Lagerstatt knapp ein Drittel des Raumes. Für Lukas war dann kein Platz mehr da, um Tanzschritte zu üben.
Nina hoffte, dass sie sich mit der Zeit an das verringerte Schlafpensum gewöhnen würde. Vor dem Spiegel überschminkte sie ihre Augenringe. Zuvor war sie in den schwarzen Rock und die weiße Bluse geschlüpft, die sie sich schon am Vorabend zurechtgelegt hatte. Sie steckte ihr brünettes, welliges Haar zu einer losen Aufsteckfrisur zusammen und betrachtete sich prüfend im Spiegel.
Nur halbwegs perfekt, dachte sie mit einem unterdrückten Seufzer. Ich sehe aus wie eine Kellnerin.
Am ersten Arbeitstag bei LENOPHARM war sie in Jeans und einem tailliert geschnittenen schwarzen Shirt erschienen – und schämte sich innerlich in Grund und Boden, als sie sah, dass sogar die Sekretärinnen Jackett und Rock oder einen Hosenanzug trugen. Zum Glück hatte sie den Rock und eine dunkelblaue Hose in ihrem Kleiderschrank aufgestöbert und beschloss, beides abwechselnd zutragen, bis die erste Gehaltsüberweisung auf ihrem Konto einträfe. Dann würde sie wohl oder übel ihre Garderobe nach und nach dem für LENOPHARM angemessenen Level adaptieren.
Um kurz nach acht fuhr Nina bereits den Computer hoch. Sie teilte ihr Büro mit Jasna Milic, die allerdings erst gegen halb neun einzutreffen pflegte. Sie musste zuvor ihren Sohn Jonas zur Schule bringen. Dafür blieb sie abends gewöhnlich länger.
Nina entdeckte mit leichtem Schaudern, dass in der Zeit von gestern, 18.00 Uhr, bis heute, 8.10 Uhr, sage und schreibe zwanzig Mails in ihrer Mailbox eingelangt waren. Kein einziges davon war Spam, das man einfach löschen und vergessen konnte. Sie verband mit den Absendern der Mails kein konkretes Gesicht und konnte auch deren Anfragen und Wünsche nicht beantworten oder erfüllen. Einer fragte sie nach CI-Richtlinien für eine Produkt-Website, ein anderer schickte ihr einen Text zum »Gegencheck«, wie er schrieb, und wieder ein anderer bat sie, eine Pressemitteilung zum Thema »Richtige Verwendung von Antibiotika« unter dem Aspekt »Patientencompliance« zu entwerfen. Nina wusste von Antibiotika nur, dass sie ihr bei Einnahme Übelkeit verursachten, und was »Compliance« bedeutete, war ihr schleierhaft. Natürlich hätte sie sich via Internet darüber schlau gemacht, doch die siebzehn anderen Mails hatten ähnliche Inhalte, und so war sie noch immer mit deren Durchsicht beschäftigt, als Jasna Milic ins Büro kam und mit beschwingter Stimme einen wunderschönen guten Morgen wünschte.
Nina war froh, Jasna als Kollegin zu haben. Sie mochte ihre offene Art und die Fröhlichkeit, die sie ausstrahlte. Jasna wirkte auf Nina immer so, als käme sie frisch aus einem traumhaften Urlaub. Jasna war groß, wirkte etwas grobschlächtig und war nicht das, was auf den ersten Blick als Schönheit betrachtet wurde, doch für Nina zählte allein die positive Energie, die sie ausstrahlte.
Schon am ersten Tag hatte Nina einen Anflug von Panik verspürt, als sie sich erstmals tiefer mit LENOPHARM und seinen Produkten auseinandersetzen musste. Kontrazeptiva, Antiinfektiva, Antidepressiva – die Begriffe flogen ihr um die Ohren wie Sandkörner im Wirbelsturm. Und diese Wörter, für Nina im Augenblick nichts anderes als leere Begriffshülsen, waren identisch mit den Aufgabengebieten, die sie künftig durch PR-Arbeit unterstützen sollte.
Am ersten Tag hatte sie Jasna gefragt, was denn Kontrazeptiva seien.
Jasna hatte geschockt darauf reagiert. »Was, das weißt du nicht? Hast du noch nie die Gebrauchsinformation zu deiner Pille gelesen? Orale Kontrazeptiva, das ist im Grunde nichts anderes als orale Verhütung, also die Pille.«
»Ich vertrage die Pille nicht«, hatte Nina zugegeben. »Wir nehmen ein Kondom oder verhüten natürlich.«
Jasna hatte herzhaft gelacht und ihr erklärt, es handele sich hierbei um nichts anderes als um einen Oberbegriff für die verschiedenen Anti-Baby-Pillen am Markt.
Nina war froh, dass Jasna sich in allem gut auskannte, denn so konnte sie ihr zu all ihren Fragen unkompliziert und rasch die richtigen Antworten liefern und sie durch den steinigen Alltag bei LENOPHARM lenken. Jasna war seit fast zehn Jahren bei der Firma beschäftigt. Bis vor Kurzem hatte sie die Öffentlichkeitsarbeit für Ninas Bereiche zusätzlich zu ihren jetzigen PR-Agenten, die die OTC-Sparte von LENOPHARM betrafen, betreut. Doch das sei auf Dauer zu viel geworden, gab sie gegenüber Nina zu. Daher habe man die Aufgabengebiete getrennt und eine Unterstützung fürs Pressebüro ausgeschrieben.
»Wir haben schon drei Monate gesucht«, erzählte Jasna, »und über 200 Bewerbungen gesichtet.«
Nina fragte sich, warum bei 200 Bewerbern die Wahl ausgerechnet auf sie gefallen war, die nicht wusste, was Kontrazeptiva sind und die erst von Jasna erfuhr, dass OTC für »over the counter« stand und es sich dabei um Medikamente handelte, die in der Apotheke ohne ärztliches Rezept zu kaufen waren.
Auch heute erwies sich Jasna wieder als geduldige und einfühlsame Helferin. Noch ehe sie ihren eigenen Computer anschaltete, sah sie mit Nina den Maileingang durch. Und plötzlich lösten sich die Rätsel hinter den Mails: Die CI-Richtlinien für die Produkt-Website fanden sich in einem 80-seitigen Skript, das auf dem PC abgespeichert war. Den stilistischen »Gegencheck« des Textes, der als Advertorial in einem Fachmagazin platziert werden sollte, machten sie und Jasna gemeinsam, und Nina speicherte für sich ab, worauf es bei dieser Art von Text ankam.
Die Anfrage mit dem Text zum Thema »Antiinfektiva und Patientencompliance« wies Jasna ab mit den Worten: »Da soll er sich an seine Agentur wenden; das Marketing hat Geld genug. Texte für Fachmedien sind nicht unsere Aufgabe. Wir machen PR für Laienmedien.«
Mit Laienmedien meinte sie Tageszeitungen, Magazine, Illustrierte und den Rundfunk. Für Nina bekam der Job allmählich Kontur. Und trotzdem fragte sie sich zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit, weshalb unter 200 Bewerbungen ausgerechnet sie diese Stelle erhalten hatte. Es war die klassische Fehlbesetzung.
Ihre Verzweiflung stieg, als sie bis zehn Uhr gerade mal zwanzig Mailanfragen beantwortet hatte, während Jasna ihr nicht nur zur Hand gegangen war, sondern nebenbei auch noch zwei Pressetexte verfasst und einen davon auch schon verschickt hatte.
»Das wird schon«, meinte Jasna aufmunternd. »Aller Anfang ist schwer. – So, und jetzt machst du sowieso mal ein bisschen Pause, weil du nämlich jetzt deinen Vorstellungstermin bei Ellen McGill hast. Wird wirklich allerhöchste Zeit, dass ihr euch kennenlernt, schließlich wirst du mit ihr am engsten zusammenarbeiten.«
Ellen McGill – der Name war in ihrer Gegenwart schon öfter gefallen; Nina hatte auch gesehen, dass sie bei manchen Mails, die die verschiedenen Produktmanager an sie geschickt hatten, einkopiert war. Bisher hatte sie dieser Dame keine Beachtung geschenkt. Dass sie deren engste Mitarbeiterin sein würde, war ihr neu.
»Ellen ist die Marketing- und Vertriebsleiterin der Pharma-Abteilung«, erklärte Jasna hilfsbereit, als sie die Verwirrung in Ninas Gesicht bemerkte. »Und Pharma umfasst deine drei Aufgabengebiete: Antiinfektiva, Antidepressiva und Kontrazeptiva. Ellen ist also die Chefin von Peter Weidenreich, Eva Gutenberg und Kathrin Hanelka, den jeweiligen Abteilungsleitern, und den Produktmanagern, die unter ihnen arbeiten. Du kannst dich sicher an Peter und Kathrin erinnern – mit den beiden waren wir doch gestern in der Kantine.«
So viele Namen, so viele Strukturen … Nina verband mit sämtlichen Namen, die ihr genannt worden waren, im Moment kein Gesicht. Bei LENOPHARM in Wien arbeiteten derzeit 160 Mitarbeiter. Das konnte lustig werden.
Während sie auf dem Weg in das obere Stockwerk waren, beschäftige Nina bangen Herzens nur ein einziger Gedanke.
»Ist Ellen McGill Engländerin?«
»Nein, Amerikanerin.« Jasna ahnte nichts von den Ängsten, die ihre Begleiterin quälten. »Sie ist vor sieben Jahren zu LENOPHARM nach Österreich gekommen.«
»Spricht Sie Deutsch?«
»Sie spricht lieber Englisch, aber sie kann auch sehr gut Deutsch. – Hallo, Stephanie, hier sind wir …«
Jasna und sie hatten ein Büro betreten, das offensichtlich das Vorzimmer eines größeren Büros darstellte. Inmitten von zahlreichen Pflanzen saß eine kleine, mollige Frau mittleren Alters und schaute sie freundlich an.
»Das ist Stephanie Müller, Ellens Sekretärin und leidenschaftliche Hobby-Botanikerin, wie du siehst. – Stephanie, das ist Nina Blume. Sie hat jetzt einen Termin mit Ellen.«
Stephanie streckte Nina die Hand entgegen und begrüßte sie mit den Worten, dass sie gerne »du« sagen könne. Dann meine sie mit Bedauern: »Tut mir leid – Ellen ist noch nicht da; sie ist noch in einer Sitzung. Aber ihr könnt gerne einstweilen in ihrem Büro Platz nehmen; sie müsste jeden Augenblick kommen.«
Ellens Büro war größer als Ninas gesamte Wohnung. Die Büromöbel eindeutig Designerstücke, maßangefertigt, mit geschwungenen Glasplatten und kunstvoll gedrechselten Aluminiumstützen. Keinerlei Pflanzen. Statt eines Besprechungstisches eine Sofaecke aus weißem Leder und ein großer Beistelltisch aus schwarz lackiertem Holz. Über dem Schreibtisch hing ein aus kleinen Steinen zusammengesetzter Wandschmuck – Ying und Yang. Gut und Böse. Am Fensterbrett ragte eine schlanke Skulptur aus Stein und Holz auf.
Auf dem Schreibtisch befanden sich lediglich Laptop, Monitor und das Telefon. Es lagen keine Unterlagen herum, nichts verriet, dass hier gearbeitet wurde.
Dominiert wurde das Büro, das so hochwertig und sichtlich bewusst eingerichtet worden war, von einem überdimensionalen Gemälde an der Wand gegenüber dem Schreibtisch. Das Motiv zeigte unverkennbar eine stark vergrößerte Nachbildung von Edward Munchs berühmtem Gemälde »Der Schrei«. Der Unterschied war lediglich, dass es auf dieser Nachbildung eine gesichtslose nackte Frau war, die schrie.
»Was denkst du?« Jasna war Ninas Blick gefolgt.
Nina zögerte mit der Antwort, gab sich dann aber einen Ruck. »Es muss traurig machen, fortwährend auf so ein entsetzliches Bild zu starren. Immer diese Verzweiflung im Blick – ich könnte das nicht ertragen.«
»Ellen liebt dieses Bild«, erwiderte Jasna. »Ein Freund von ihr ist Künstler und hat das gemalt.«
Nina zuckte mit den Schultern. »Na ja … jedem das Seine.«
Stephanie servierte unaufgefordert Kaffee. Augenblicke später ging die Türe erneut auf, und Ellen McGill betrat das Zimmer.
»Sorry, sorry, sorry. I am too late, I know.« Sie legte die schwarze Mappe, die sie unter dem Arm getragen hatte, sorgfältig neben das Notebook auf den Schreibtisch. Über Telefon orderte sie bei Stephanie Tee. Dabei sah sie sich kein einziges Mal zu Nina und Jasna um.
Während des kurzen Telefonats hatte Nina Zeit, sie zu betrachten. Büroeinrichtung und Büroinhaberin ergaben ein stimmiges Bild: Sah man von der Munch-Nachbildung ab, bewies Ellen McGill nicht nur Stil bei ihrer Büroeinrichtung, sondern auch in Kleidungsfragen. Obgleich nur einen halben Kopf größer als Nina mit ihren kleinen ein Meter sechzig, war sie eine auffallende Erscheinung. Sie war sehr schlank. Gemessen an ihren Proportionen, wirkten ihre Beine lang. Sie hatte einen sehr hellen Teint; ihr Gesicht war dezent geschminkt, die Augenbrauen recht dünn und mit extravagantem Schwung gezupft. Im Einklang mit ihren sehr feminin geschnittenen, kurzen Haaren wirkte ihr Gesicht wie das einer Porzellanpuppe, fand Nina. Der tailliert geschnittene Anzug, den sie trug, untermalte den puppenhaften Eindruck. Auch wenn Nina sich für Kleidung wenig interessierte – dass dieser Anzug nicht von der Stange war, erkannte sogar sie. Noch nie hatte sie so einen extravaganten und doch zugleich eleganten Schnitt gesehen. Dazu trug Ellen McGill ebenfalls sehr ausgefallene Pumps mit einer dezent geschwungenen Schnalle aus Metall.
Das markanteste an Ellen war jedoch die Haarfarbe: Ihr Haar glänzte kupferrot. Das äußere Erscheinungsbild dieser Frau wirkte auf Nina einfach überwältigend.
Ihr erster positiver Eindruck sollte nicht lange währen. Denn nun drehte die neue Kollegin sich erstmals zu ihnen um. Nina fühlte mit Entsetzen, wie Ellen McGill innerlich erstarrte. Dabei blieb ihr Gesicht nahezu unbewegt. Doch ihre Augen blickten Nina eisig an.
»Wer hat Sie eingestellt?«
Hätte sie nicht dieser kalte Blick getroffen, wäre Nina darüber erleichtert gewesen, dass Ellen McGill Deutsch mit ihr sprach, wenngleich auch mit leichtem amerikanischen Akzent. Es war ihre größte Sorge gewesen, dass sie einem native speaker gegenüber saß und ihr unzulängliches Englisch auffiel. Nun aber merkte sie, dass ihr Magen sich zusammenkrampfte. Sie hatte schon immer gespürt, wenn jemand sie ablehnte – und so auch jetzt.
»Herr Dr. Brauer«, sagte Nina mit leiser Stimme. Sie sah an Ellen McGill vorbei auf den Boden, um deren eisigem Blick zu entkommen.
»Michaelis«, sagte Jasna zu ihrem Erstaunen. Ihr Instinkt hatte sie also nicht getrogen: Brauer war nicht so begeistert von ihrer Person gewesen, dass er ihr die Stelle hatte geben wollen. Aber warum setzte sich Michaelis, der Herr mit dem freundlichen Lächeln, der mit ihr über das Leben und die Liebe philosophiert hatte, für sie ein?
Ellen McGill nahm Jasnas Kommentar mit unbewegter Miene zur Kenntnis. Sie reichte Nina nun die Hand. Ihr Händedruck war flüchtig und schwach, sie sah ihr nicht in die Augen.
Dann nahm auch sie Platz.
»Sie haben Erfahrung mit Pharma-PR?«
Ihre Stimme klang jetzt sachlich, aber nicht einladend.
»Ich … ich habe schon für eine Agentur ein paar Texte geschrieben. Zu Vitaminpräparaten«, erklärte Nina und versuchte, das Zittern in ihrer Stimme zu verbergen. Ellen McGills Haltung verunsicherte sie.
»Das ist OTC«, bemerkte Ellen McGill ungerührt. »Also haben Sie keine Erfahrung mit Pharma-PR.«
Nina sank in sich zusammen. Das fing ja gut an. Und mit dieser Frau sollte sie zusammenarbeiten.
»Nina hat ein Kinderbuch gezeichnet und getextet, das auch veröffentlicht wurde«, sprang Jasna nun ein.
»Oh, wirklich.« Ellen McGills Kommentar hätte desinteressierter nicht klingen können. Stephanie kam herein, brachte ihr eine Kanne Tee und schenkte ihr ein. Als sie wieder verschwunden war, setzte sie hinzu: »Ich wollte jemanden mit Pharma-PR-Erfahrung.«
»Nina lernt sicher schnell«, sagte Jasna. »Und in dir hat sie auch jemanden, der ihr da sicherlich wertvolle Starthilfe gibt.«
»I don’t know much about PR«, erwiderte Ellen abweisend. Als sie nach ihrer Teetasse griff, bemerkte Nina, dass ihre Hände leicht zitterten.
Nina war froh, als sie das Büro und Ellen McGill wenig später wieder verließen. Ihr Magen war wie zugeschnürt. Das Zusammentreffen mit dieser Frau hatte sie komplett entmutigt. Jasna dagegen machte im Gang einen Scherz über eine dürre Pflanze, die im Gang herumstand und offenbar schon länger nicht mehr gegossen worden war, und schien Ellen McGills unnahbarer Haltung offensichtlich keinerlei Stellenwert beizumessen. Wieder zurück im gemeinsamen Büro, hielt es Nina nicht mehr aus. Sie nahm allen Mut zusammen und fragte vorsichtig: »Was ist mit dieser Frau?«
Jasna hob den Kopf und sah sie über die kleine Sichtbarriere zwischen ihren Schreibtischen hinweg erstaunt an.
»Mit Ellen? – Nichts, was soll mit ihr sein?«
Nina zweifelte im ersten Augenblick an sich selbst und ihrer Wahrnehmung. Hatte diese McGill nicht ganz klar zu verstehen gegeben, dass sie mit der Wahl, die Michaelis mit ihrer Einstellung getroffen hatte, nicht zufrieden war?
»Sie klang nicht so begeistert«, meinte Nina unschlüssig.
»Ach, nein«, beschwichtigte Jasna unbekümmert. »Das bildest du dir ein. Sie braucht nur ein bisschen Zeit, um sich an dich zu gewöhnen, das ist alles.«
Sie vertiefte sich wieder in ihre Arbeit und überließ Nina ihren Zweifeln, die sich nicht gelegt hatten.
Ein Schwall von amerikanischem Englisch, im Rekordtempo gesprochen, flitzte durch den Telefonhörer und traf Nina wie der Biss einer giftigen Schlange. Sie hatte keine Ahnung, was Ellen McGill von ihr wollte, und verstand nur wenig. Wörter wie »Pressrelease«, Pressemitteilung und »Stand-by Statement« flogen ihr um die Ohren, außerdem fiel immer wieder der Begriff »Reroxin«, mit dem Nina überhaupt nichts anfangen konnte. Ellen McGills schneidende Stimme lähmte ihre Reaktionszeit und ihren Verstand. Sie wusste nicht, was man von ihr wollte, und verstand keineswegs, weshalb diese penetrante Frau dermaßen aufgebracht war. Als die Tirade offenbar geendet hatte, hing bleierne Stille in der Leitung.
Zu spät realisierte Nina, dass ihr gerade eine Frage gestellt worden war.
» Would you answer my question, please!«
Das Please klang für Nina wie ein Befehl mit fünf Ausrufezeichen. Sie hatte die Frage nicht verstanden, wusste nicht, um was es überhaupt ging, war verwirrt und auch verletzt von dem Tonfall, in dem mit ihr gesprochen worden war, und sagte deshalb das einzige, was sie sagen konnte: »I don’t know.«
Schweigen am anderen Ende. Ellen McGills Tonfall klang sehr kühl, als sie schließlich auf Deutsch sagte: »Geben Sie mir bitte Jasna.«
Nina streckte den Telefonhörer mit zitternder Hand Jasna entgegen, die ihn mit fragendem Gesichtsausdruck an sich nahm.
»Hallo? – Nein. – Ach so? – Ich wusste davon nichts. – Nein, nein. Bisher nicht. – Natürlich. Sie wird gleich kommen.«
Sie legte auf und schob Nina, die mit kläglicher Miene auf ihrem Schreibtischstuhl saß, mit sanfter Gewalt von ihrem PC weg.
»Lass mich mal in deine Mails schauen.« Sie durchforstete mit prüfendem Blick Ninas geöffnete Mailbox und entdeckte schließlich, was sie gesucht hatte. »Da ist es. Das Mail von Ansgar Hüter von der Konzernzentrale.« Sie öffnete es. »Nina, da geht es um Reroxin, ein Antibiotikum von LENOPHARM. Es wird in THE LANCET eine Studie veröffentlicht werden, in der eine signifikant hohe Anzahl von Nierenschädigungen bei Patienten festgestellt wurden, die Reroxin länger als zehn Tage genommen haben. Dieser Artikel könnte ein Presseecho nach sich ziehen – auch bei den Laienmedien. Ansgar Hüter ist der Pharma-PR-Chef auf globaler Ebene. Er hat einiges Material vorbereitet, falls Medienanfragen kommen. Ein Stand-by-Statement, einen FAQ-Katalog mit den wahrscheinlichsten Fragen dazu, die von Journalistenseite kommen könnten. Er hat das gestern noch geschickt. Ellen hat bereits eine Krisensitzung einberufen. Es müssen ja auch die wichtigsten Ärzte und der Außendienst darüber informiert werden. Du solltest diese Unterlagen ausdrucken und zu Ellen ins Büro gehen. Sie sitzt da bereits mit den Kollegen aus der Medizinabteilung und dem Produktmanager zusammen.«
Verzweiflung machte sich in Nina breit. Nicht nur, dass sie im Moment noch nicht sah, welche Rolle genau sie in dieser Reroxin-Krise spielte – allein die Vorstellung, nach diesem Telefongespräch Ellen McGill persönlich gegenüberzutreten, machte ihr Bauchweh.
»Jasna – kannst nicht du gehen? Ich weiß nicht …«
Jasna unterbrach sie. »Nein, Nina. Ich habe jetzt dann einen Termin mit einer Journalistin, den ich wirklich nicht absagen kann. Und Pharma ist sowieso dein Aufgabenbereich. Ich schule dich gerne ein, aber arbeiten musst du schon selbst.«
Als ob es darum geht, dachte Nina bitter. Sie wagte einen neuerlichen Anlauf.
»Ellen McGill ist stocksauer auf mich.«
»Sie war vielleicht etwas ungehalten, weil du trotz Einladung nicht zu dieser Sitzung erschienen bist«, beschwichtigte Jasna. »Schau – hier oben, gleich das erste Mail von heute früh, das war die Einladung zur Sitzung. Das Mail ist sogar mit »dringend« versehen. Aber du hast es noch nicht mal geöffnet. Und das Mail mit den Unterlagen hattest du zwar geöffnet, aber nicht an sie weitergeleitet, wie ich sehe.« Sie sah Nina beschwörend an. »Du musst Mails, die du von der Konzernzentrale zu solchen Themen bekommst, sofort an Ellen weiterleiten – und an die Medizinabteilung und den zuständigen Produktmanager. Es ist außerordentlich wichtig, dass im Falle einer potentiellen Krise alle frühzeitig informiert sind. Und es ist auch wichtig, dass du dich in die Unterlagen, die dir geschickt werden, eingelesen hast, noch ehe ihr euch zu einer Besprechung trefft.«
»Woher soll ich denn wissen, was wichtig ist?«, verteidigte sich Nina kläglich.
»Ich weiß, dass es momentan noch schwierig für dich ist«, gab Jasna zu. »Aber du kannst mich ja fragen, wenn du dich nicht auskennst. Lieber fragst du einmal mehr als einmal zu wenig.«
»Als das Mail wegen Reroxin gestern kam, warst du in einer Sitzung … und dann haben wir uns nicht mehr gesehen«, warf Nina ein. »Ich hätte dich heute sowieso gefragt, aber dann kam schon der Anruf von Ellen.«
»Es hat keinen Sinn, Nina, wenn wir jetzt weiter darüber diskutieren«, entgegnete Jasna. »Du weißt, was ich meine. Pharma ist ein sensibler Themenbereich, und Verzögerungen können wir uns da nicht leisten. – Nimm jetzt diese Ausdrucke und geh zu Ellen, danach sehen wir weiter.«
Nina fühlte sich abgekanzelt wie ein unmündiges Schulkind. Sie kam sich wieder einmal völlig fehl am Platz vor. Mit einer Mischung aus Furcht, schlechtem Gewissen und dem Empfinden, zu allem unfähig zu sein, betrat sie wenige Minuten später Ellen McGills Büro. Fünf Leute saßen hier zusammen und diskutierten bereits heftig über nächste Schritte – dies in Englisch, wie Nina entsetzt feststellen musste. Von Ellen McGills Seite schlug ihr Eiseskälte entgegen. Sie bot ihr nicht einmal einen Sitzplatz an, sondern forderte sie gleich auf, über ihre geplanten PR-Maßnahmen zum aktuellen Thema zu berichten.
Nina fühlte sich an die Wand gedrückt. Unerwartete Hilfe kam von Georg Waldmeister, dem Leiter der Medizinabteilung, der über Informationsmaßnahmen für die Ärzte und Apotheken erzählte und hinzufügte, dass in diesem Fall hinsichtlich der Pressearbeit vorerst sowieso nur reaktiv – also auf Nachfrage – agiert werden sollte.
»Ich rechne nicht damit, dass Sie viele Journalistenanrufe zu diesem Thema bekommen werden, Frau Blume«, meinte er gelassen. »Dieses Nierenleiden, das hier erwähnt ist, kann auch in anderem Zusammenhang stehen. Wir kennen noch nicht den genauen Studienhintergrund. Solange wir nicht mehr Informationen haben als diesen verkürzten LANCET-Artikel, besteht aus meiner Sicht kein Grund zur Sorge.«
»Das Pressestatement muss es auf Deutsch geben«, bemerkte Ellen knapp. »Besorgen Sie sich das – für den Außendienst.«
Nina hatte wenig Ahnung, woher sie sich das Pressestatement auf Deutsch besorgen sollte und was der Außendienst damit zu tun hatte, doch sie schämte sich für ihre Unkenntnis so sehr, dass sie sich nicht nachzufragen traute.
Als sie zehn Minuten später Ellen McGills Büro verließ, fühlte sie sich noch niedergeschlagener und unfähiger als zuvor. Sie hatte fast nichts von dem verstanden, was in der Folge besprochen wurde. Von einem »Dear Doctor Letter« war die Rede, von einer Behörde namens AGES, die verständigt werden musste, von so genannten KOLs, die nach Einschätzung von Waldmeister diese oder jene Meinung zu dem Thema »Reroxin« vertreten würden und nach Meinung von Ellen McGill eine andere. Obgleich beide heftig miteinander diskutierten, fiel Nina durchaus auf, dass Ellen mit Waldmeister wesentlich respektvoller umging als mit ihr.
Als sie in ihrem Büro ankam, stellte sie fest, dass Jasna bereits gegangen war. Das kam ihr gerade recht, denn so konnte sie ihren Tränen freien Lauf lassen.
Lukas lag auf der Couch und hörte lautstark einen Ausschnitt aus »Cats«. Nina, die sich nach diesem Tag regelrecht erschlagen fühlte, wünschte sich beim Entreten nichts mehr, als dass jemand von den Nachbarn Beschwerde gegen die permanente musikalische Berieselung zu späterer Stunde und in dieser Lautstärke einlegen würde. Gleichzeitig wusste sie, dass dieser Wunsch nicht erfüllt werden würde – die alte Dame, die nebenan wohnte, war nahezu taub, und unter ihnen befand sich eine Studenten-WG, deren Bewohner entweder unterwegs waren oder selbst lärmende Partys feierten. Über ihnen war nur noch der Dachboden.
Während Nina den Mantel am Garderobenständer aufhängte, fiel ihr Blick auf das schmutzige Geschirr, das sich im Spülbecken stapelte. Ärger keimte in ihr auf. Auf dem Herd stand eine Pfanne, in der trockene Reisreste klebten. Konnte Lukas nicht ein Mal abwaschen? Schließlich war er es, der hier tagtäglich Geschirr benutzte. Seit sie bei LENOPHARM arbeitete, frühstückte sie im Büro und nahm ihr Mittagessen in der Kantine ein. Abends aß sie meist nur ein Stück Brot oder Obst.
Heute hatte sie nicht einmal darauf Lust. Sie fühlte sich erschöpft, ausgezehrt und deprimiert.
Sie hatte Stunden damit verbracht, das Stand-by-Pressestatement mit Hilfe eines Fachwörterbuches ins Deutsche zu übersetzen. Als sie endlich damit fertig gewesen war, hatte sie es an Ellen McGill geschickt, die sich prompt nicht vorstellen konnte, dass die Formulierung in dieser Art korrekt war und von der Medizinabteilung so freigegeben würde. Was sie wortwörtlich sagte, blieb Nina unerschlossen, da die Pharma-Marketingleiterin sich nicht die geringste Mühe gab, wenigstens am Telefon langsamer und deutlicher Englisch zu reden.
Entmutigt versuchte sich Nina in Folge an Korrekturen. Mit der zweiten Lösung war auch sie selbst zufriedener. Da sie nicht erneut eine Rüge einstecken wollte, ging sie mit dem übersetzten Statement gleich zu Georg Waldmeister und bat ihn um die Freigabe des Textes. Dieser tauschte rasch ein paar Worte gegen andere, weniger absolut klingende Phrasen aus und fügte einige Fachausdrücke ein, die Nina noch nie in ihrem Leben gehört hatte.
Nina schickte das Endergebnis wiederum an Ellen McGill und bekam sofort eine Lesebestätigung, aber keine Antwort. Nach zwei Stunden fasste sie sich ein Herz und fragte telefonisch nach, ob das Statement nun so okay war.
»Pressestatement?«, wiederholte Ellen mit kühler Stimme. »Ach – das. Ich habe es schon seit Stunden in Deutsch.«
Nina konnte nicht glauben, was sie da hörte.
»Aber … wieso? Woher?«, stammelte sie verwirrt.
»Woher nur? Natürlich vom Konzern«, ätzte Ellen Mc-Gill herablassend. »Ich habe es angefordert. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich kann nicht Stunden warten. Ich brauche das sofort. Und mir ist Qualität wichtig.«
Sie legte grußlos auf.
Nina hatte verdattert den Telefonhörer in der Hand gehalten und sich wiederholt gefragt, was hier eigentlich falsch lief. Auch jetzt, wo sie zu Hause im Wohnzimmer stand, kämpfte sie erneut mit den Tränen. Sie wollte nichts anderes, als von Lukas getröstet werden.
Als Lukas ihr Gesicht sah, sprang er sofort auf und drehte die Musik leiser. Besorgt kam er auf sie zu und nahm sie in den Arm.
»Nina-Schatz, was ist denn los?«
Unter Tränen erzählte sie von ihrem schrecklichen Tag und Ellen McGill. Dann teilte sie Lukas mit, was sie sich im Laufe des restlichen Nachmittags überlegt hatte.
»Ich halte den Job nicht aus, Lukas. Ich bin nicht gut genug dafür qualifiziert, ich habe keine Ahnung von Medizin und Arzneimitteln. Weiß der Himmel, warum ich überhaupt eingestellt worden bin. – Noch bin ich in der Probezeit. Ich kann einfach gehen. Und genau das will ich tun. Ich werde Brauner morgen sagen, dass ich den Job hinschmeiße.«
Lukas ließ sie los.
»Ja, aber, was willst du denn dann tun?« Er sah sie mit leichtem Entsetzen im Blick an. »Du brauchst doch einen Job. Wir haben noch immer Schulden.«
Nina seufzte. Es war nicht nötig, dass er sie daran erinnerte – sie wusste es auch selbst nur zu gut.
»Wir sind nur noch eine Monatsmiete im Rückstand«, sagte sie. »Und das Konto ist seit meiner ersten Gehaltsüberweisung sogar leicht im Plus. Wir schaffen das schon irgendwie, Lukas. Ich kann ja wieder PR-Texte für Agenturen schreiben. Und mir vielleicht einen Job in einem Fast-Food-Laden suchen.«
Lukas schien wenig begeistert.
»Ach, Nina … das mit den PR-Texten hat doch vorher auch nicht zum Leben gereicht. Die zahlen ja so wenig, und du hast keine regelmäßigen Aufträge bekommen. Und dir wird allein vom Geruch von Fastfood schon übel. Wie willst du da den ganzen Tag in so einem Schuppen aushalten?«
Nina zuckte hilflos mit den Schultern. Im Augenblick schien ihr alles besser als der Job bei LENOPHARM.
»Ich werde mich bemühen, mehr Aufträge an Land zu ziehen«, meinte sie unschlüssig.
Lukas schüttelte den Kopf.
»Nina, Nina … wie willst du das denn anstellen? Du hast hier in Wien keine guten Kontakte, und sind wir doch ehrlich: Selbstmarketing ist absolut nicht deine Stärke.« Er überlegte kurz. »Ich kann natürlich mal im Theater an der Wien nachfragen, ich habe da neulich jemanden kennen gelernt, der dort Regieassistenz macht. Vielleicht kann der dich über seine Beziehungen unterbringen. Und ich müsste wirklich meine Beziehungen spielen lassen. Das würde ich nur ungern machen, wenn ich nicht sicher sein kann, dass du den Job dann nicht auch gleich wieder sausen lässt.«
Ninas Augen füllten sich erneut mit Tränen. Sie fühlte sich im Augenblick ziemlich missverstanden. Warum begriff Lukas nicht, wie schlimm ihr Arbeitsalltag war?
»Ich habe mir gedacht … ich meine, ich weiß, du hast viel um die Ohren mit der Ausbildung«, begann sie zögernd. »Aber vielleicht wäre es möglich, dass du abends oder am Sonntag doch einen kleinen Job annimmst? Dann würde nicht alles an mir hängen.«
Lukas sah sie an, als hätte sie ihm vorgeschlagen, ab morgen auf dem Mond zu wohnen, »Nina, wie soll das denn gehen? Du weißt doch, dass ich abends nicht zu fixen Zeiten mit dem Tanztraining fertig werde, und dass ich mir sonntags freihalten muss, falls ich bei ›Rebecca‹ als Hintergrundtänzer einspringen kann. Das wär so eine supergroße Chance für mich! Du willst doch nicht, dass ich meine ganze Karriere riskiere, nur, weil du jetzt gerade mal einen Durchhänger hast?«
Nein, natürlich wollte sie nicht Lukas’ Karriere riskieren. Sie wusste ja, wie viel ihm die Musicalausbildung bedeutete.
Trotzdem ging sie an diesem Tag mit einem unglücklichen Gefühl im Herzen zu Bett und fand stundenlang keinen Schlaf. Die Aussicht auf den nächsten Tag lastete wie ein zentnerschwerer Stein auf ihrer Seele.
Es war Samstag, und Nina war mehr als nur froh, dass die Woche um war. Sie hatte den Freitag ohne Zwischenfälle überstanden. Sie hatte das Pressestatement der Zentrale auf ihrem PC abgespeichert und einer weiteren Sitzung zum Thema Reroxin beigewohnt, in der sich alle an der Medikamenten-Krise Beteiligten gegenseitig über die bereits getroffenen Maßnahmen informierten. Der Brieftext an die so genannten KOLs, die Key Opinion Leader und führenden Ärzte Österreichs, wie Nina inzwischen in Erfahrung gebracht hatte, war fertiggestellt. Montag früh sollte der Brief gedruckt, kuvertiert und verschickt werden.
»Bei dem Seltenheitswert, den diese Nebenwirkungen haben, wird das sowieso kein großes Thema werden«, meinte Georg Waldmeister, der Leiter der Medizin-Abteilung, gleichmütig. »Ich denke, für die Medien ist das kein Thema. Zumal die Hintergründe dieser Studie aus meiner Sicht sehr strittig sind. Es handelt sich ja nicht einmal um eine randomisierte doppelblinde Studie, sondern eigentlich um eine Anwendungsbeobachtung.«
»Ich bin sicher, dass das vom Mitbewerb inszeniert ist«, äußerte sich Max Weidenreich, Leiter der Sparte Antiinfektiva. »Die wollen Reroxin aus dem Weg räumen, um mit ihrem Konkurrenzprodukt Faroxin kräftig abzusahnen.«
Nina hatte mit »randomisiert« und »doppelblind« nichts verbunden, Faroxin sagte ihr überhaupt nichts, aber Waldmeisters Aussage, dass es für die Medien kein Thema war, beruhigte sie ungemein.
»Wir sprechen über ein Antibiotikum – über ein Medikament, das viele Menschen kennen«, hatte Ellen eingewandt. »Das sollten wir nicht vergessen. Journalisten schweigen nicht. Das kann wirklich ein Thema sein.«
»Ellen, mal nicht wieder den Teufel an die Wand«, hatte Waldmeister jovial empfohlen. Für Nina war es eine Genugtuung gewesen, dass es jemanden gab, der Ellen McGill widersprach. Noch amüsanter fand sie, dass Ellen dieses Sprichwort weder verstand noch nach Erläuterung metaphorisch umsetzen konnte.
»Ich nehme das ernst«, beharrte sie mit steinerner Miene.
Heute, am Samstag, hatte Nina endlich wieder einmal ausschlafen können. Sie kuschelte mit Lukas bis mittags im Bett, dann trafen sie sich mit Freunden von der Musicalschule zum Brunchen in einem Lokal in Wien-Josefstadt. Nina war im Grunde von der Idee nicht begeistert gewesen, der Preis von 16,80 Euro pro Person schreckte sie gewaltig ab. Doch Lukas hatte sie damit überredet, dass es ja schließlich ein Buffet sei und sie für das Abendessen gleich würden mitessen können. Sicher sei es auch kein Problem, für das Frühstück am nächsten Tag Semmeln und abgepackte Marmeladen mitgehen zu lassen. Als sie schließlich vor einem Teller mit Rührei und köstlich duftenden, frischen Croissants saß, war sie froh über die Entscheidung, dem Brunch zugestimmt zu haben. Zum ersten Mal in dieser Woche fühlte sie sich entspannt.
Sie war die einzige in der Runde, die nicht im künstlerischen Bereich tätig war. Mark und Kevin, ein schwules Pärchen, die Slowakin Marga und Sonja, mit nur einundzwanzig die Jüngste in der Runde, besuchten mit Lukas die Musicalklasse. Sonjas Freund Antonio, ein Italiener aus Neapel, war Tenorsänger im Chor der Wiener Staatsoper, und Margas neuer Freund Duncan, ein Ire, spielte Schlagzeug in einer Jazz-Band.
Nina setzte sich absichtlich weit weg von Duncan, schon weil sie von englischer Sprache derzeit genug hatte. Antonio war ihr mit seinem südlichen Charme sowieso sympathischer als der etwas kühl wirkende Ire.
»Und, malst du an ein neue Buch?«, wollte Marga mit ihrem harten osteuropäischen Akzent wissen.
»Ich komme im Moment nicht dazu«, gab Nina zu. »Wenn ich abends nach Hause komme, bin ich todmüde, und die Wochenenden sind einfach zu kurz.«
»Du ziehst das jetzt also wirklich durch, bei diesem Pharmakonzern?«, fragte Sonja ungläubig.
»Nun ja …« Nina warf einen hilflosen Blick auf Lukas, doch der war im Moment ausschließlich auf sein Schokoladencroissant konzentriert. »Ich werde es wohl durchziehen müssen.«
»Also, ich verstä-hä nicht, wieso du dir das antust!«, trompete Marga nun in einer Lautstärke, die sogar die Leute vom Nebentisch dazu bewog, ihnen kurzfristig ihre Aufmerksamkeit zu schenken. »Das ist ein Pharmakon-zärn. Das ist ein stinklangweiliges Unternäh-män. Das ist total kapitalistisch! Hast du diesen Film gesäh-än, mit den illegale Arzneimittelteste in die Entwicklungslän-där? Das war entsetzlich! – Also, ich könnte das wirklich nicht, wirklich gar nicht, so eine kapitalistische Sys-täm unterstützen!«
Nina war auf einmal klar, weshalb sie Marga nicht mochte. Sie hasste Leute, die derart mit ihrem Weltbild um sich keulten.
»Das war nur ein Film«, verteidigte sie sich lahm. »Soviel ich weiß, gibt es für Arzneimittelstudien genaue Auflagen.«
Seltsamerweise fielen ihr genau in diesem Moment die für sie mysteriösen Begriffe »randomisiert« und »doppelblind« ein.
»Das ist doch alles wie Mafia«, belehrte Marga. »Die Auflagen sind ja total kapitalistisch und mit Korruption, das weiß doch jä-där!«
Nina kam nicht dazu, etwas darauf zu erwidern. Denn im selben Augenblick läutete ihr Handy. Hektisch durchwühlte sie die Tiefen ihrer Umhängetasche. Als sie es schließlich fand, hatte das Klingeln bereits aufgehört.
»Oh, du hast ein neues Handy?« bemerkte Mark interessiert und griff danach. Er legte sich damit quer über den ganzen Tisch. »Seht mal her, was Nina für ein stylisches Teil hat. Metallicblau, mit Kamera, eines der neuesten Nokia-Modelle! Das muss ja ein Vermögen gekostet haben.«
»Das ist ein Firmenhandy«, klärte Lukas mit vollen Backen auf. »Nina ist doch jetzt wichtig.«
»Ich habe es ja gesagt: Das ist total kapitalistisch!« krähte Marga triumphierend.
Mark gab Nina das Handy zurück. Mit mulmigem Gefühl schaute sie auf die Anrufliste – und erstarrte. Ellen McGills Name leuchtete ihr wie ein Warnsignal entgegen.
Was wollte die Frau an einem Samstag von ihr?
Sie beschloss, den Anruf zu ignorieren. Missmutig legte sie das Handy zurück in die Tasche und versuchte es zu vergessen, doch ihr Milchkaffee wollte ihr nun nicht mehr recht schmecken. Als gleich darauf auch noch ein SMS kam mit der Nachricht, es sei eine Nachricht auf ihrer Mobilbox eingelangt, ließ sie ihr schlechtes Gewissen sie nicht mehr los. Sie stand auf und ging in Richtung Toilette, um die Nachricht abzuhören. Ellens Message auf der Mobilbox war kurz und eindeutig.
»Rufen Sie mich an. Sofort.«
Mit zittrigen Händen drückte sie Ellens Nummer. Ellen McGill hob sofort ab – so, als hätte sie auf Ninas Rückruf gewartet. Es gab kein Wort der Begrüßung.
»Where are you?«
»Ich … äh … in einem Lokal«, stotterte Nina und fühlte, wie sich ihr Puls sofort beschleunigte.
»Didn’t you read your e-mails?«
Nina war sich keiner Schuld bewusst. Natürlich hatte sie am Freitag um 18 Uhr, als sie LENOPHARM verlassen hatte, noch ihre Mails gecheckt. Kein einziges hatte eine Dringlichkeit, die einen Samstagsanruf rechtfertigte.
Sie versuchte Ellen McGill dies zu erklären und war sich ihres stümperhaften Englischs dabei völlig bewusst.
Ellen McGill antwortete auf Deutsch. »Ich meine nicht das Mail vom Freitag. Es ist heute gekommen, in der Früh. Checken Sie Ihre Mails nicht regelmäßig?«
»Am Samstag? Da bin ich doch gar nicht im Büro«, erwiderte Nina fassungslos. War diese Frau von Sinnen?
»Haben Sie kein home-office?« Das Entsetzen der gesamten Welt lag in Ellen McGills Stimme.
»Nein.«
»Ändern Sie das. Und kommen Sie jetzt ins Büro. Sofort. «
Noch vor einer Woche hätte Nina es für einen schlechten Scherz gehalten, am Samstag im Büro erscheinen zu müssen. Doch McGills Stimme klang alles andere als scherzhaft.
»Ich … äh … habe keine Zugangsberechtigung für Wochenenden.« Das waren Brauners Worte gewesen, als er ihr den Eintrittschip für den Haupteingang nach Vertragsunterzeichnung überreicht hatte. »Ich komme heute nicht rein.«
»Natürlich kommen Sie herein«, erklärte Ellen kurz angebunden. »Ich werde Ihnen die Türe öffnen. – Ich erwarte Sie in spätestens einer halben Stunde.«
Wie im Trance ging Nina zurück an den Tisch.
»Ich muss weg.«
Die Köpfe flogen nach oben. Erstaunte Blicke.
»Wohin denn?«, fragte Lukas erstaunt.
»Ins Büro.«
Nina begann ihren Mantel anzuziehen und ihre Tasche unter dem Stuhl herauszufischen. Sie warf einen letzten Blick auf das angebissene Croissant auf ihrem Teller. Freilich hätte sie es einpacken können, doch der Appetit war ihr vergangen.
»Was, jetzt am Samstag?«, fragte Sonja irritiert. »Das kann doch nicht wahr sein. Zahlen die dir dann wenigstens, wenn du jetzt kommst?«
»Ich bin pauschaliert«, erwiderte Nina lahm. Sie erwartete nicht, dass ihre Freunde sie verstanden. Sie verstand sich ja selbst nicht. Warum versuchte sie nicht einmal, gegenüber dieser Frau Widerstand zu leisten?
»Ich habe es doch gewusst!,« krähte Marga triumphierend. »Das ist ein total kapitalistische Sys-täääm, diese Pharmakon-zärn!«
Sie zog einen gewagten Vergleich zum Dasein der Feldsklaven in den amerikanischen Südstaaten zu Beginn des 19. Jahrhunderts, doch Nina war mit einem kurzen Abschiedsgruß bereits verschwunden.
Stolze fünfundzwanzig Minuten später stand sie vor dem Firmengebäude. Ellen McGill wartete bereits in der Eingangshalle. Sie telefonierte auf dem Handy, als sie Nina einließ. Während sie mit dem Lift ins obere Stockwerk fuhren, erläuterte McGill einem unbekannten Anrufer auf Deutsch die Vorzüge von Reroxin und die Schwachstellen der in THE LANCET publizierten Studie. Sie tat dies sehr professionell und wirkte am Telefon so freundlich, wie sie Nina noch nie zuvor erlebt hatte.
Nina musterte Ellen verstohlen. Sie trug einen jener extravagant geschnittenen Anzüge, die Nina an ihr bei jedem Zusammentreffen auf das Neue bewunderte, und sah aus wie an einem ganz gewöhnlichen Bürotag. In ihr keimte der Verdacht auf, dass Ellen McGill den Samstag möglicherweise als ganz normalen Bürotag betrachtete.
In ihrem Büro angekommen, hatte Ellen den Anrufer verabschiedet und fiel in jenen wenig freundlichen Tonfall zurück, an den Nina sich nie gewöhnen wollte.
Auf Englisch informierte sie Nina: Dorina Eisenfuss, eine Größe der Wiener Kabarettszene, war in der Nacht von Freitag auf Samstag einem Nierenleiden erlegen. Ungünstigerweise war sie zuvor mit Reroxin behandelt worden, was ihr behandelnder Hausarzt gegenüber der Presse in einem Nebensatz geäußert hatte. Unter dem Eindruck der eben publizierten Studie war dies ein Köder, den die Medien mit Begeisterung aufgegriffen hatten.
»Seit acht Uhr morgens beantworte ich Journalistenanrufe«, sagte Ellen McGill. »Das ist nicht meine Aufgabe. Aber von Ihrer Seite kam keine Reaktion.«
»Ent…entschuldigung«, stammelte Nina. »Ich wusste das nicht.«
»Es ist aus meiner Sicht die Aufgabe der PR-Abteilung, Radio und Fernsehen täglich zu verfolgen. Es wurde bereits um sieben Uhr früh gesendet, dass Dorina Eisenfuss tot ist.«
Nina schwieg betreten. Sie wagte nicht zuzugeben, dass Lukas und sie nicht einmal einen Fernseher besaßen.
Die nächsten Stunden verbrachte sie damit, das Pressestatement möglichst auswendig zu lernen und den Fragen- und-Antworten-Katalog zu studieren. Außerdem schickte ihr Ellen McGill alle zehn Minuten weitere Materialien über die Wirkweise von Antibiotika sowie bereits früher veröffentlichte, positiv ausgefallene Studien zu Reroxin. Nina blätterte darin, verstand aber mangels Hintergrundwissen weniger, als Ellen McGill von ihr zu erwarten schien.
Es riefen noch weitere drei Journalisten an, die alle von Ellen mit Informationen versorgt wurden. Nina war froh darum. Sie traute sich nicht zu, irgendwelche Fragen zu Antibiotika im Allgemeinen und Reroxin im Besonderen zu beantworten.
Der vierte und letzte Anruf traf um zehn vor sechs Uhr abends ein. Ellen McGill befand sich gerade in Ninas Büro. Sie hatte ihr einen Stapel mit Kopien auf den Tisch gelegt – weitere Studien zu Reroxin, die Nina lesen sollte. Ellen McGill warf einen kurzen Blick auf das Display ihres Handys.
»Das ist die Nummer der größten Yellow-Press-Zeitung in diesem Land«, informierte sie Nina. »Listen and learn!«
Sie nahm den Anruf entgegen und schaltete den Lautsprecher ein. Nina hörte mit wachsendem Entsetzen die provokativen Fragen des Journalisten, die ganz klar darauf abzielten, LENOPHARM die Schuld am Tod von Dorina Eisenfuss in die Schuhe zu schieben, und sie verfolgte Ellen McGills sachliche und geschickte Antworten auf diese Frage. Jasna Milics Satz kam ihr in Erinnerung: In dir hat Nina sicher jemanden, der ihr Starthilfe gibt. – Und Ellen McGills Erwiderung darauf: I don’t know much about PR.
Ellen McGill trat soeben den Gegenbeweis zu ihrer eigenen Aussage an. Trotz aller Furcht, die sie vor ihr empfand, konnte Nina eine leichte Bewunderung für sie nicht verhehlen. Dieses Gefühl verflog jedoch rasch, als Ellen schließlich geendet hatte und sie mit strengem Blick fixierte. »Tomorrow, that is your job! I won’t call any journalists.«
Nina wurde blass. Sie sollte morgen selbst mit Journalisten telefonieren und über Reroxin sprechen? Und wieso morgen? War da nicht Sonntag? Sie hatte doch geplant, mit Lukas in die Nachmittagsvorstellung dieses Tanzfilms zu gehen, den er unbedingt sehen wollte!
Doch Ellen McGill machte eine Miene, die keinerlei Einwände duldete.
Am Donnerstag wurde bekannt, dass Dorina Eisenfuss’ Ableben in keinem Zusammenhang mit ihrer Reroxin-Behandlung stand. Die Ergebnisse der Gerichtsmedizin, die aufgrund des Mediendrucks eine Obduktion zur Klärung der Todesumstände vornahm, ließen daran keinen Zweifel. Unterstützt von einer Gruppe Forscher und Antibiotika-Experten der LENOPHARM-Konzernzentrale, konnte am selben Tag noch eine Pressemitteilung verschickt werden, die die Mängel der in THE LANCET veröffentlichten Ergebnisse schonungslos aufdeckte und die Publikation massiv angriff. Man werde sich in den nächsten Monaten dennoch weiter mit der Studie auseinandersetzen, so lautete der letzte Satz der Pressemitteilung, denn die Patientensicherheit stehe für LENOPHARM schließlich an erster Stelle.
Nina fühlte sich zu diesem Zeitpunkt bereits wie eine wandelnde Leiche: Sie wusste nicht mehr, mit wie vielen Journalisten sie inzwischen telefoniert hatte, wie sie jemals wieder durchschlafen sollte, ohne nachts von Alpträumen aus dem Schlaf gerissen zu werden, und ob ihr Nachname wirklich noch »Blume« und nicht »Reroxin« lautete. Während sie glaubte, im Reroxin-Strudel nach unten gerissen zu werden und zu ertrinken, schien diese Causa die normale Geschäftstätigkeit ihrer Kollegen nicht sonderlich zu beeinträchtigen. Besonders Ellen McGill wirkte jeden Tag wie aus dem Ei gepellt, ausgeschlafen und professionell wie eh und je, und Georg Waldmeister von der Medizin-Abteilung bemerkte trocken: »Irgendwann geht auch das vorbei.«
Nina dagegen musste vor der Geschäftsführung boulevardeske Schlagzeilen wie »Hat LENOPHARM die Todeskapseln?« und »Reroxin macht alle hin« rechtfertigen. Der Inhalt der Artikel war gar nicht so negativ, wie die Schlagzeile vermuten ließ, aber der Geschäftsführer interessierte sich nur für die Überschrift, nicht für den Rest.
Nach dem ersten Auftritt in seinem Büro war Nina vor Jasna Milic in Tränen ausgebrochen. Sie wusste nicht mehr, wer schlimmer war: der arrogante Geschäftsführer oder Ellen McGill. Jasna hatte sie getröstet und lapidar hinzugefügt: »Du musst dir um deinen Job keine Sorgen machen. Der jetzige Geschäftsführer ist sowieso nur eine Gallionsfigur. Die Entscheidungen trifft nach wie vor Michaelis.«
Normalerweise hätte Nina nachgefragt, was genau sie damit meine, doch die Reroxin-Krise nahm sie zu stark in Anspruch, um sofort nachzuhaken.
Punkt Mitternacht hatten sie das Licht gelöscht; ein paar Minuten später streckte Lukas die Hand nach Nina aus und zog sie an sich. Nina spürte sein Begehren, doch sie selbst fühlte sich nur müde und abgeschlagen. Sie ließ es zu, dass er ihren Busen streichelte, öffnete automatisch den Mund, als er sie küsste, und leistete erst schwachen Widerstand, als er sich schließlich auf sie legte.
»Lukas – nein. Ich bin heute so müde.«
»Aber Nina-Maus, schon wieder? Gestern wolltest du auch nicht. Es ist fast zwei Wochen her, dass wir das letzte Mal …«
»Es tut mir leid«, unterbrach sie ihn leise und fühlte sich sofort schuldig. »Es ist nur so: Ich bin wirklich völlig erschöpft.«
»Du wirst dort wirklich ausgenutzt, mein süßer Schatz«, bemerkte Lukas und begann Ninas T-Shirt nach oben zu schieben und ihre nackte Haut mit Küssen zu bedecken. »Das darfst du dir nicht gefallen lassen. Du musst dich wehren.« Er rutschte an ihr nach oben und begann, an ihrem Ohrläppchen zu knabbern. Nebenbei ließ er seine Hand zu ihren Brüsten gleiten.
»Lukas … bitte … ich will das nicht mehr«, brach es aus Nina hervor.
Lukas rutschte abrupt von ihr weg und starrte sie schockiert an. »Du willst nicht mehr mit mir schlafen?«
Nina setzte sich auf und knipste die Stehlampe neben der Ausziehcouch an. »Nein, das meinte ich nicht«, beeilte sie sich zu sagen, obgleich sie in diesem Moment nicht sicher war, ob sie es nicht doch meinte. Sie hatte sich in letzter Zeit zunehmend lustlos gefühlt. Je erschöpfter sie wurde, desto weniger hatte ihr der Sex mit Lukas gefallen. »Ich will den Job nicht mehr! Ich halte das nicht länger aus. Ich ertrage weder die Arbeit noch diese McGill.«
»Mensch, Nina, darüber haben wir doch schon tausendmal gesprochen«, erwiderte Lukas. Seine Stimme klang genervt. »Wir brauchen das Geld.«
»Lukas, ich kann nicht mehr, ehrlich. Die letzte Woche war ein absoluter Horror für mich. Wir schaffen das schon finanziell. Ich werde mich anstrengen und wirklich versuchen, Aufträge zu bekommen. Ich werde mich bei allen möglichen Agenturen bewerben. Vielleicht kann ich ja auch für eine Zeitung schreiben.«
»Nina, bitte, das hast du noch nie gemacht – für eine Zeitung schreiben. – Wo willst du dich denn bewerben? Bei der KRONE? Oder beim STANDARD?«
»Ich weiß nicht. Irgendwo halt.« Nina fühlte sich komplett hilflos. »Vielleicht … kannst du nicht doch sehen, ob du einen Job findest? Vielleicht gibt es ja irgendetwas, wo du flexibel sein kannst. Oder von zu Hause aus arbeiten.«
»Aber Nina! Die Diskussion hatten wir doch auch schon.« Lukas schob schmollend seine Unterlippe nach vorne. »Glaubst du wirklich, dass ich noch Zeit finde, irgendeinen Job zu machen – zusätzlich zu meiner Ausbildung? Nina, ich bin wirklich voll erledigt, wenn ich nach Hause komme. Ich weiß nicht, wie du dir meinen Alltag vorstellst, aber Tanz- und Gesangsunterricht sind nicht immer ein irres Vergnügen.«
»LENOPHARM und Ellen McGill sind auch kein Vergnügen«, erwiderte Nina leise. Sie sah ihn flehend an. »Bitte, Lukas, verstehe mich doch. Lass uns eine Lösung finden. Morgen läuft meine einmonatige Probezeit aus; es ist die letzte Möglichkeit für mich, fristlos zu kündigen.«
Lukas blickte sie verständnislos an. »Und dann willst du jetzt auf die Schnelle irgendeine unsinnige Entscheidung treffen, die du sicherlich bald bereust? Kündigen kannst du doch immer noch. Dann gibt es wenigstens während der Kündigungsfrist auch noch Kohle. – Nina, wir können uns echt nicht leisten, dass du deinen Job aufgibst! Wie sollen wir sonst die Wohnung halten?«
»Bevor ich nach Wien kam, ging es doch auch. Da hast du zweimal die Woche bei Starbucks gearbeitet!«
»Aber damals habe ich in der WG gewohnt, wenn du dich erinnerst. Da hat das monatliche Geld meiner Eltern auch gereicht. Du wolltest ja eine eigene Wohnung.«
Was er sagte, war richtig: Nina hatte wirklich nicht vorgehabt, längerfristig mit Marga und zwei anderen Freunden aus der Musicalklasse in einer Wohnung in Wien-Meidling zu wohnen, in der sich das Altpapier von fünf Jahren im Vorraum türmte und in der man einen Slalom um leergetrunkene Weinflaschen machen musste, um über den engen Gang in die verschiedenen Zimmer zu gelangen. Lukas’ Zimmer war zudem klein und dunkel gewesen. Sie hatten dort zwei Monate gemeinsam gewohnt, dann hatte Nina es nicht mehr ausgehalten. Margas lange Haare in der Dusche, Tims Angewohnheit, beinahe jede Nacht ein anderes Mädchen in die Wohnung zu schleppen, und Lucillas notorische Weigerung, ab und zu auch einmal den Müll zu entleeren, hatten ihr das WG-Leben gründlich vermiest.
»Ich wollte das auch«, bestätigte Nina. »Aber ich bin schon davon ausgegangen, dass auch du weiter arbeitest und wir die Sache gemeinsam finanzieren. Ich kann das nicht alleine tragen.«
»Nein, Nina: Du willst es nicht alleine tragen.« Lukas schnitt ein beleidigtes Gesicht. »Dass du es kannst, hat sich ja nun gezeigt. Wenn dein nächstes Gehalt kommt, sind wir endlich schuldenfrei, stimmt’s?«
Sie nickte, fühlte sich aber verletzt und betrogen. Irgendetwas lief hier ziemlich falsch, das war ihr klar, doch ihr fehlten die Worte und der Mut, es zu benennen. Vor allem liebte sie Lukas. Sie wollte keinen Streit.
»Na, siehst du. Und diesen tollen Job willst du aufgeben, nur weil es dir im Moment ein bisschen zu stressig ist? – Also das kann ich wirklich nicht kapieren! Wie willst du ein Leben mit mir aufbauen, wenn du bei den kleinsten Problemen die Flinte ins Korn wirfst?«
Nina schluckte trocken.
»Schon gut«, meinte er und klang nun wieder versöhnlicher. »Aber das mit dem Stress wird sicher besser. Und am Wochenende kannst du dich mal richtig erholen. Wenn du willst, können wir ja zum Neusiedler See fahren. Er ist zwar nicht mehr gefroren, aber wir könnten uns dort einen netten Tag machen. Willst du?«
»Am Wochenende geht es nicht«, seufzte sie. »Ich habe ein Wochenendseminar für Einsteiger in die Pharma-Branche. Ich bin fix angemeldet.«
»Schon wieder am Wochenende?« Lukas runzelte unwillig die Stirn. »Wie kann denn das sein?«
»Ich weiß es nicht«, gab Nina zu. »Anscheinend ist das Standard in der Branche. Brauer, der Personalchef, hat mich angemeldet. Aber Ellen McGill hat mir das eingebrockt. Brauer hat mir nämlich erzählt, sie hätte ihm von meinen Pharma-Wissenslücken berichtet. Reizend, nicht wahr?«
»Die Frau spinnt voll«, stellte Lukas nüchtern fest. »Aber sieh es mal so: Wenigstens wirst du eingewiesen. Du hast ja wirklich keine Ahnung vom Gesundheitswesen und von dem ganzen Kram in Pharmaunternehmen. – Ich werde dann halt ohne dich mitfahren.«
»Mitfahren?«, wiederholte Nina irritiert. Das Bild von Lukas und ihr, Arm in Arm am See, verlor schlagartig an Kontur.
»Na ja, Marga, Duncan und Sonja fahren auch«, gab Lukas Auskunft. Er überlegte kurz. »Das wäre auch ziemlich eng geworden. Das Auto, das Sonja von ihrem Bruder leihen kann, ist ein alter Mini.«
»Hast du die Pressemitteilung zur Innovationsinitiative schon verschickt?« Jasna lehnte sich über die Sichtbarriere zwischen den Schreibtischen.
Nina, die gerade damit beschäftigt war, ein Mail von Ansgar Hüter über neue Konzern-Richtlinien bei der Produktkommunikation zu studieren, fuhr hoch. »Nein, sorry, noch nicht. Aber ich mache das jetzt gleich.«
Jasna wirkte ungeduldig. »Na ja, Nina, es ist jetzt fast 17 Uhr. Morgen ist die 125-Jahre-Feier! Wir müssen noch gemeinsam die Präsentation für den Geschäftsführer fertigstellen. Wann sollen wir das tun? Heute Abend um acht? Weißt du, irgendwann möchte ich auch nach Hause gehen. Jonas wartet.«
Das würde ich auch gerne, ging es Nina durch den Kopf. Auch wenn auf mich wahrscheinlich heute Abend niemand wartet, weil Lukas seinen speziellen Tanzworkshop macht.
Laut sagte sie: »Tut mir leid, Jasna. Ich dachte, die Präsentation war schon fertig? – Wir haben doch gestern die Endfassung vom Geschäftsführer absegnen lassen.«
Jasna seufzte. »Ja, aber dummerweise hat er jetzt doch noch einige Ergänzungen – und zwar im Pharma-Teil.« Sie presste ärgerlich die Lippen zusammen und fügte nach einer kleinen Pause sarkastisch hinzu: »Ich kann mir schon vorstellen, wie das gelaufen ist. Für ihn war es okay, aber dann hat er die Präsentation Ellen zur Kenntnisnahme geschickt, und sie hatte noch mindestens hundertdrei Anmerkungen.«
Nina hob erstaunt den Kopf. Sie hatte noch nie erlebt, dass sich Jasna über Kollegen negativ äußerte. Besonders Ellen hatte sie bisher immer in Schutz genommen, wenn Nina zaghaft andeutete, dass die Zusammenarbeit für sie eine einzige Katastrophe war. In den Wochen, in denen sie nun hier arbeitete, hatte sich wenig an ihrem Verhältnis zu Ellen McGill geändert. Wenn sie von ihr zu Besprechungen bestellt wurde, hatte sie noch immer ein ungutes Gefühl im Magen, und wenn deren Name am Display ihres Telefons erschien, zuckte sie unweigerlich zusammen. Sie hatte noch nie erlebt, dass von Ellens Seite etwas Positives kam.
»Willkommen in meiner Welt«, erwiderte Nina trocken. »Was glaubst du, warum ich noch immer an der Pressemitteilung zu ›Verhütung über dreißig‹ schreibe? – Ellen hat mir den Text seit gestern vier Mal umgeworfen.«
Jetzt, da sich Nina derart äußerte, machte Jasna sofort einen Rückzieher. »Sie ist halt sehr perfektionistisch«, meinte sie beschwichtigend. »Schließlich geht es in diesem Präsentationsteil auch um ihren Bereich, das ist ja klar, dass sie da ein Wörtchen mitreden will.«
»Perfektionistisch und aktionistisch«, sagte Nina frei heraus. »Am Montag will sie dies, am Dienstag jenes, am Mittwoch wieder etwas anderes … es hagelt Anordnungen. Das geht die ganze Woche in diesem Stil, und am Wochenende ruft sie dann spätestens am Sonntag an und zitiert mich ins Büro, weil irgendetwas dringend am Montagmorgen an die Medien gehen muss. So ist das!«
Nina war erstaunt über sich selbst. Sie hatte bisher nie gewagt, so offen über Ellen McGill zu sprechen.
»Wie, sie lässt dich am Sonntag hereinkommen?« Das Erstaunen lag nun auf Jasnas Seite. Ihre Augen wurden schmal. In ihrem Kopf schien es zu arbeiten.
»Nicht immer«, sagte Nina. »Aber oft.«
»Na ja … manchmal ist Wochenendarbeit nötig, besonders in der Pharma-PR«, meinte Jasna. »Ich habe es da mit meinen Aufgabengebieten freilich leichter. Aber, Nina: Du musst Ellen auch Grenzen setzen, wirklich. Ellen ist ein Workaholic. Sie hat kein Gefühl dafür, dass andere ihre Freizeit zu schätzen wissen.«
Grenzen setzen – wie stellte sich Jasna das denn vor? Nina fühlte sich Ellen McGill stets komplett ausgeliefert. Sie sah sich nicht in der Lage, ihr stichhaltig darzulegen, weshalb diese oder jene Presseinformation auch getrost bis Dienstag oder Mittwoch warten konnte. Bei Ellen gab es nur ein Wort, und das lautete: Sofort.
»Als du noch meinen Job gemacht hast, konntest du ihr da Grenzen setzen? Was hast du gesagt, wenn sie dich am Sonntag hereingebeten hat?«
Insgeheim hoffte Nina, Jasna könne ihr ein Patentrezept liefern. Sie wusste, dass mangelnde Durchsetzungskraft eine ihrer Schwächen war.
Seltsamerweise wurde die selbstbewusste Jasna nun etwas verlegen. »Also … wir hatten nie größere Probleme miteinander, Ellen und ich. Natürlich war ich mal am Sonntag im Büro, aber das kam wirklich nicht oft vor.« Sie nahm ihren Arbeitsstuhl und schob ihn um die Schreibtische herum zu Nina. »Aber wir sollten nicht so lange über andere reden. Machen wir nun lieber die Präsentation fertig. Es wäre ja peinlich, wenn unser Geschäftsführer ausgerechnet morgen ohne perfekte Charts auftreten müsste.«
Während Nina gemeinsam mit Jasna die erforderlichen Änderungen in die Power-Point-Folien einpflegte, fragte sie sich zum wiederholten Male seit ihrer ersten Begegnung mit Ellen McGill, was diese Frau denn nur gegen sie hatte.
Der Veranstaltungssaal füllte sich mit Leuten. Ärzte, Apotheker, Geschäftspartner und Größen aus Politik und Wirtschaft strömten in die festlich geschmückte Räumlichkeit.
Im Eingangsbereich teilten die Hostessen Namenskärtchen aus, die Nina gemeinsam mit Jasna angefertigt hatte. Jetzt dirigierte Jasna die Leute vom Catering, und Nina versuchte Hans von der EDV-Abteilung zu erklären, wann genau er während der Präsentation des Geschäftsführers die musikalischen Einlagen einzuspielen hatte. Das war nicht einfach, denn Hans hatte diese Aufgabe erst sehr kurzfristig von einem erkrankten Kollegen übernommen. Nina fühlte sich zunehmend verzweifelt. Bis zum offiziellen Beginn der Veranstaltung blieben nur noch vierzig Minuten.
Sie fragte sich in diesem Moment wieder einmal, was eigentlich alles an Kuriositäten in ihren Aufgabenbereich als PR-Verantwortliche für die Pharma-Sparte fiel. Gestern noch hatte sie Jasna dieselbe Frage gestellt, doch die hatte nur sarkastisch gelacht: »Ach, Nina, das frage ich mich schon lange nicht mehr. Bei uns in der PR-Stelle landen seit Jahren alle Aufgaben, von denen niemand weiß, wem er sie sonst zuordnen soll – auch die Organisation von externen Veranstaltungen. Und du weißt ja: Andere Unternehmen übergeben so eine Großveranstaltung an eine Agentur. Aber bei LENOPHARM wird ständig gespart.«
Ein Blick auf das Buffet, das vom Catering-Service am Ende des Saals angerichtet worden war, schien das Gegenteil zu bestätigen: Nina hatte Platten mit Sushi, Sashimi und sogar mit Hummer entdeckt; auch die mit Kaviar gefüllten Eier und die marinierten Trüffelspießchen im Vorspeisen-Bereich sahen nicht nach einem Sparmenü aus. Nina lief das Wasser buchstäblich im Munde zusammen. Wenigstens etwas Gutes brachte dieser Abend mit sich. Es war ewig her, dass sie sich Meeresfrüchte oder Sushi gegönnt hatte.
»Na, Nina und Hans, alles klar?« Jasna beugte sich geschäftig über das Mischpult. »Weiß Hans jetzt, wo die Musik eingespielt werden soll?«
»Ich kenn mich nicht aus«, bestätigte Hans lakonisch, was Nina vermutet hatte.
Jasna seufzte. »Das gibt’s doch nicht! Das kann ja nicht so schwer sein!« Dann fiel ihr etwas ein. »Nina – auf meinem Schreibtisch liegt noch eine Version der Rede, in der ich die Musikeinspielungen mit kleinen Kreuzen vermerkt habe! Am besten, du machst davon bitte eine Kopie und bringst sie nach unten. Damit dürfte sich Hans dann leichter tun.«
Nina nickte. Sie wollte sich gerade in Bewegung setzen, als Jasna trotz aller Hektik, die sie umgab, noch ein paar nette Worte für sie fand: »Du siehst heute übrigens wirklich gut aus. Dein neues Kleid steht dir ausgezeichnet.« Sie beugte sich zu Nina hinüber und flüsterte ihr – für Hans unhörbar – ins Ohr: »Ein bisschen tief dekolletiert vielleicht für ein konservatives Unternehmen wie LENOPHARM, aber ich bin sicher, viele Männerherzen werden bei deinem Anblick heute höher schlagen.«
Nina bedankte sich artig für Jasnas Kompliment, doch auf dem Weg ins Büro wuchs ihre Verunsicherung, was ihr Outfit betraf. Sie hatte sich das Kleid extra für diesen Event gekauft. Schließlich konnte sie weder in Jeans noch in ihrem schwarzen Alltagsrock erscheinen. Das Kleid war dunkelrot, am Busen gerafft, und betonte ihre schlanke Figur sehr vorteilhaft. Es war in der Tat recht tief dekolletiert, und noch an der Kasse hatte Nina Zweifel gehabt, ob es seriös genug für diesen Abend war. Lukas hatte sie jedoch ermutigt: »Zeig es diesen Pillenspießern mal richtig. Es muss ja nicht jede herumlaufen wie ihre eigene Oma.«
Nina fand die drei losen Blätter auf Jasnas Schreibtisch und ging zum Kopierraum. Schon als sie die Türe aufstieß, leuchtete ihr ein Din A4-Blatt entgegen, das jemand am Kopierer befestigt hatte: – DEFEKT –.
Nina seufzte. Auch das noch.
Die Hausdruckerei im Parterre war verschlossen, also fuhr sie in den vierten Stock und steuerte den Kopierraum an. Zu ihrer Überraschung war die Türe verschlossen.
Erst jetzt fiel es ihr wieder ein, dass der Raum über Nacht verschlossen gehalten werden sollte. So hatte es vor kurzem in einem Rundmail geheißen; auf dem Fax-Gerät im vierten Stock, der zugleich die Geschäftsführungsebene war, erfolge der Eingang vertraulicher Faxe.
Wie sie unschlüssig im Gang stand und sich fragte, was Putzfrauen wohl mit Papieren zu Arzneimittelzulassungen oder Vertriebsvereinbarungen anfangen sollten, fiel ihr ein Lichtschein auf, der durch das Sichtfenster zum Gang aus Ellen McGills Büro drang. Sie schluckte.
Sollte sie fragen, oder sollte sie nicht? Mach dich nicht lächerlich, schalt sie sich selbst. Sie wird dich nicht fressen.
Trotzdem fühlte sie wieder jenes inzwischen schon zu vertraute Magendrücken, als sie zögernd Stephanies Vorzimmer durchquerte und an Ellens halb angelehnte Türe klopfte.
»Come in.« Ellen verstaute gerade ihren Laptop in der Transporttasche. Sie war offensichtlich dabei, ihren Bürotag zu beenden.
»Ich muss … ich … ich wollte eine Kopie machen«, begann Nina und ärgerte sich selbst darüber, dass sie ganze drei Anläufe brauchte, um diesen harmlosen Satz gegenüber Ellen McGill über die Lippen zu bringen. »Könnte ich kurz den Schlüssel zum Kopierraum bekommen?«
Ellen sah auf.
Einen Moment lang schien sich so etwas wie Erstaunen in ihren Gesichtszügen widerzuspiegeln, als sie Nina in ihrem festlichen Aufzug gewahr wurde. Doch Sekunden später war ihr Gesicht wieder zu einer undurchdringlichen Maske geworden. Sie öffnete eine kleine silberne Box, die wie ein kunstvolles Accessoire auf ihrem Schreibtisch platziert war. Mit dem Schlüssel in der Hand trat sie dicht an Nina heran – so dicht, dass Nina unwillkürlich zurückweichen wollte, doch seltsamerweise gehorchten ihr die Beine nicht. Es war, als würden ihre Füße am Boden kleben.
Ellen hielt ihr den Schlüssel vor die Nase.
Unsicher sah Nina auf. Ihre Augen trafen sich.
Was für hübsche Augen sie hat. Katzenaugen. So geheimnisvoll und tief, dachte Nina verwirrt.
»Take it«, sagte Ellen nun, und es klang wie ein Befehl.
Schnell ergriff Nina den Schlüssel und ging.