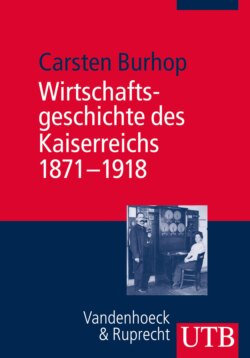Читать книгу Wirtschaftsgeschichte des Kaiserreichs 1871-1918 - Carsten Burhop - Страница 11
Оглавление|►17|
II. Politik, Gesellschaft und Verfassung
Wirtschaftliche Handlungen werden in einem durch gesellschaftliche und politische Strukturen, Verfassungen und außerökonomische Ereignisse begrenzten Rahmen vollzogen. Entsprechend setzt die Beschreibung und Analyse ökonomischer Gegebenheiten und Entwicklungen Grundkenntnisse der zentralen gesellschaftlichen Strukturen, verfassungsrechtlicher Normen und politischer Ereignisse voraus.
Die gesellschaftliche Struktur lässt sich anhand des Bevölkerungsaufbaus beschreiben, wobei im Deutschen Kaiserreich zwei Entwicklungen herausstechen: Bevölkerungswachstum und Urbanisierung. Zwischen 1871 und 1913 wuchs die Reichsbevölkerung von rund 40 auf circa 67 Millionen Menschen, also um rund 1,2 Prozent jährlich. Auch die Lebenserwartung stieg deutlich an. Im ersten Jahrzehnt des Kaiserreichs hatte ein männlicher Neugeborener eine Lebenserwartung von 35 Jahren, kurz vor Kriegsausbruch hingegen bereits von mehr als 47 Jahren. Für diese deutliche Veränderung kann man vor allem den signifikanten Rückgang der Säuglings- und Kleinkindsterblichkeit verantwortlich machen. Die deutsche Bevölkerung wurde zwischen 1871 und 1913 somit größer und älter. Das natürliche Bevölkerungswachstum aufgrund der Differenz zwischen Geburten- und Sterbeziffern wurde aber durch Migration insgesamt gebremst. Einerseits wanderten zwar 1,1 Millionen Ausländer, vor allem aus Osteuropa, in das Reich ein, andererseits aber verließen drei Millionen Deutsche ihre Heimat dauerhaft, vornehmlich Richtung Nordamerika.9 Von größerer Bedeutung als die internationale Wanderung war jedoch die Binnenmigration, insbesondere von den ostelbischen Agrargebieten ins Rheinland, nach Westfalen und in den Großraum Berlin. Zudem konzentrierte sich die Bevölkerung zunehmend in größeren Städten. Der Anteil der Menschen, die in Gemeinden mit weniger als 2.000 Einwohnern lebten, ging zwischen 1871 und 1910 von 64 auf 40 Prozent zurück. Gleichzeitig erhöhte sich der Bevölkerungsanteil, der in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern zu Hause war von 4,8 Prozent auf 21,3 Prozent. Die einzige Millionenstadt blieb jedoch Berlin, deren Einwohnerzahl zwischen 1880 und 1910 von 1,1 auf 3,7 Millionen Menschen anstieg. Kurz vor Kriegsausbruch näherte sich auch Hamburg der Millionenmarke. München, Leipzig, Dresden, Köln und Breslau hatten jeweils 500.000 bis 600.000 Einwohner. 10
|17◄ ►18|
Die nackten demographischen Ziffern sagen nichts über die ausgeprägte Klassenstruktur des Kaiserreichs. Zunächst einmal bestanden zur Zeit der Reichsgründung erhebliche Einkommens- und Vermögensunterschiede, die trotz des deutlichen Wachstums des Pro-Kopf-Einkommens bis 1918 nicht ausgeglichen werden konnten. Selbst 1914 mussten noch 60 bis 70 Prozent der Lohnempfänger ein Auskommen mit einem Einkommen unterhalb der Einkommensteuergrenze haben.11 Die Gesellschaft des Kaiserreichs kann anhand zahlreicher Gegensätze stratifiziert werden: Arm und Reich, Stadt- und Landbevölkerung, Evangelisch und Katholisch, abhängig Beschäftigter und Selbstständiger, Arbeiter und Angestellter, Bürgerlicher und Adliger, Akademiker und Analphabet. Sozialer Aufstieg war kaum möglich und zog sich, wenn er denn stattfand, oft über mehrere Generationen hin. Beispielsweise fanden sich an Gymnasien und Universitäten kaum Kinder aus Arbeiterhaushalten – ihr Anteil an den Universitätsabsolventen lag unter einem Prozent. Ein sozialer Aufstieg vollzog sich somit eher innerhalb einer Klasse, beispielsweise vom ungelernten Arbeiter zum Facharbeiter, vom kleinen Beamten zum Bildungsbürger.12
An der Spitze der deutschen Klassengesellschaft stand der Adel, dessen ökonomische Bedeutung zwar langsam schwand, der aber gleichwohl erhebliche politische Macht besaß und zentrale Funktionen in Militär und Verwaltung innehatte. Kurz vor Kriegsausbruch stand an der Verwaltungsspitze fast aller preußischen Provinzen und der Mehrheit der Regierungsbezirke ein Adliger, zwei Drittel der Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes waren Adlige und die Hälfte der höheren Offiziere stammte ebenfalls aus dem Adel. Zudem gelang es dem Adel, Aufsteiger aus dem Bürgertum durch Nobilitierung zu integrieren.13
Das Bürgertum selbst ist eine höchst amorphe Kategorie und lässt sich am ehesten anhand von Normen, Mentalitäten und Lebensweisen charakterisieren. Grenzt man das Bürgertum anhand der von Bürgern ausgeübten Berufe ein, dann zählten Unternehmer, Rentiers, Direktoren, Ärzte, Anwälte, Professoren, Pfarrer, Richter und höhere Verwaltungsbeamte dazu. Dieses Wirtschafts- und Bildungsbürgertum umfasste vor dem Weltkrieg dreieinhalb bis vier Millionen Menschen, also rund sechs Prozent der Reichsbevölkerung. Rechnet man kleinbürgerliche Schichten und den neuen Mittelstand hinzu – also Handwerker, Händler, Gastwirte, einfache Angestellte und Beamte – dann gehörten ihm fast zehn Millionen Menschen an.14 Im Kaiserreich kam es zu einer zunehmenden Differenzierung innerhalb des Bürgertums, vor allem weil sich die Durchschnittseinkommen des Wirtschaftsbürgertums und des Bildungsbürgertums deutlich auseinanderentwickelten. Die Bildungsbürger versuchten ihren ökonomischen |18◄ ►19| Statusverlust durch gesellschaftlichen Statusgewinn auszugleichen, beispielsweise mit einer Karriere als Reserveoffizier und der damit einhergehenden Annäherung an den Adel.15
Den dritten Stand im Staate bildete die Arbeiterschaft, zu der am Anfang des 20. Jahrhunderts rund zehn Millionen Beschäftigte zu zählen sind. In sich war die Arbeiterschaft wiederum weit differenziert, etwa hinsichtlich des Alters und der Qualifikation. Der ungelernte, von Altersarmut betroffene Arbeiter im fünften Lebensjahrzehnt hatte wenig mit dem jungen Facharbeiter gemein. Zudem spielte die Religion in der Arbeiterschaft eine relativ große Rolle, bot sie doch Halt in einem Leben, das durch Binnenmigration und Abtrennung von der früheren Lebensgemeinschaft in der kleinen eigenen Welt auf dem Land gekennzeichnet war. Andererseits schweißten abhängige Lohnarbeit, lange Arbeitstage und monotone Tätigkeit die Arbeiterschaft zusammen, sodass zunehmend gemeinsame Interessen in festgefügten Organisationen vertreten und die karge Freizeit gemeinsam verlebt wurden. Gewerkschaften und Wirtshäuser blühten in den Arbeitersiedlungen auf.16
Der Stand der Bauern und Landarbeiter schrumpfte, ihre Anzahl ging absolut, vor allem aber relativ zurück. Die Bewohner der bäuerlich-ländlichen Lebenswelt unterschieden sich anhand ihres Landbesitzes: Großgrundbesitzer, Großbauern, Mittelbauern, Kleinbauern, Parzellisten und landlose Landarbeiter lebten unterschiedlich. Im Reich gab es rund neun Millionen Männer auf dem Land. Davon waren allein dreieinhalb Millionen Landarbeiter und weitere viereinhalb Millionen besaßen weniger als fünf Hektar – nicht genug, um davon zu leben. Somit gab es lediglich eine Million Bauern, die von ihrem Besitz leben konnten. Aber auch innerhalb dieser Gruppe der Besitzbauern gab es große Unterschiede zwischen den rund 20.000 Großgrundbesitzern mit mehr als 100 Hektar und den rund eine Million mittelgroßen Betrieben, die zwischen fünf und 20 Hektar bewirtschafteten. Bemerkenswert sind auch die erheblichen regionalen Unterschiede der Besitzstruktur. In Ostelbien gab es eine steile Hierarchie mit wenigen Großgrundbesitzern und vielen Landarbeitern. In Süddeutschland hingegen wurden landwirtschaftliche Betriebe im Erbfall real geteilt, d. h. auf die Erben verteilt. Dies führte dazu, dass es dort überwiegend Kleinbetriebe gab. Nordwestdeutschland rangierte dazwischen, da das dort übliche Anerbenrecht den Hof in einer Hand, in der Regel in der Hand des erstgeborenen Sohns, beließ.17
Ihre politischen Rechte übte die Bevölkerung durch Wahlen aus, dem einzigen in der Verfassung garantierten Grundrecht. Der grundsätzliche Rahmen politischer |19◄ ►20| Handlungen wurde in der Reichsverfassung vom 16. April 1871, die in wesentlichen Zügen auf die preußische Verfassung und die Verfassung des Norddeutschen Bundes zurückgeht, festgezurrt und bis zum Ende des Kaiserreichs am 9. November 1918 quasi nicht mehr verändert. Das Kaiserreich war zugleich absolutistisch und monarchisch, parlamentarisch und repräsentativ, demokratisch und plebiszitär sowie föderalistisch.18 Der deutsche Kaiser, der zugleich König von Preußen war, nahm in vielerlei Hinsicht die zentrale Rolle in der Verfassung ein:19 Er bestimmte die Außenpolitik, entschied über Krieg und Frieden, führte die Streitkräfte, ernannte und entließ den Reichskanzler, die Staatssekretäre und höheren Reichsbeamten – und er erließ Gesetze, denen jedoch sowohl der Reichstag als auch der Bundesrat zustimmen mussten. Da der Kaiser den Reichstag jederzeit mit Zustimmung des Bundesrates auflösen konnte und da er als preußischer König zugleich eine starke Position im Bundesrat besaß, verfügte er gegenüber den beiden anderen Verfassungsorganen über erhebliche Druckmittel. 20 Tatsächlich dürften die beiden wichtigen Kaiser die ihnen zugewiesene Rolle sehr unterschiedlich ausgefüllt haben. Während Wilhelm I. dem Rat seines Kanzlers Bismarck folgte, scheint Wilhelm II. eine aktivere politische Rolle gespielt zu haben.21
Für eine gestaltende Politik in denjenigen Bereichen, die durch die Verfassung dem Reich zugewiesen worden waren, war die Zustimmung von Bundesrat und Reichstag notwendig. Das Reich war unter anderem für Zoll- und Handelswesen, Münz- und Bankwesen, Patent- und Eisenbahnwesen, Post und Telegraphie zuständig. Andere wirtschaftlich wichtige Bereiche, beispielsweise die Erhebung direkter Steuern, blieben Aufgaben der Bundesstaaten.22 Der Bundesrat setzte sich aus 58 Gesandten der 25 Bundesstaaten zusammen. In diesem Gremium hatte Preußen 17 Stimmen, Bayern sechs, Sachsen und Württemberg je vier, Baden und Hessen je drei, Mecklenburg-Schwerin und Braunschweig je zwei, die anderen 17 Staaten je eine Stimme.23 Da eine Verfassungsänderung im Bundesrat mit einer Sperrminorität von 14 Stimmen abgelehnt werden konnte, war eine Verfassungsreform gegen den Willen Preußens unmöglich.24 Der Bundesrat |20◄ ►21| beschloss mit einfacher Mehrheit über die dem Reichstag vorzulegenden Gesetze sowie über die Ausführungsbestimmungen zu von beiden Kammern beschlossenen Gesetzen.25 Damit nahm er eine zentrale Stellung im Gesetzgebungsprozess ein, denn der Reichskanzler legte Gesetze zunächst dem Bundesrat vor. Dort wurde ein für alle Bundesstaaten akzeptabler Gesetzesentwurf erarbeitet und erst dieser bereits von vielen Konflikten entlasteter Entwurf wurde dem Reichstag vorgelegt. Otto von Bismarck, der erste Kanzler des Deutschen Reichs, versuchte freilich die Macht der Fürstenvertreter im Bundesrat zu brechen, indem er das Reich und Preußen eng miteinander verzahnte. So wurden viele Staatssekretäre des Reiches zugleich preußische Minister im selben Geschäftsbereich. Die dem Bundesrat zugeleiteten Gesetzesvorlagen wurden somit zwar formal von den Staatssekretären des Reichs ausgearbeitet, faktisch unterstützten sie aber preußische Interessen. Diese Dominanz des preußischen Informationsmonopols führte freilich regelmäßig zu Konflikten mit den anderen Bundesstaaten.26
Da die Gesetzgebung von Bundesrat und Reichstag gemeinsam ausgeübt wurde, mussten beide Verfassungsorgane Gesetzentwürfen mehrheitlich zustimmen. 27 Im Gegensatz zum Bundesrat bestand der Reichstag nicht aus Gesandten der Bundesstaaten, sondern aus 397 in allgemeiner, direkter und geheimer Wahl bestimmten Abgeordneten. Im Abstand von drei, ab 1888 fünf Jahren, wurden alle männlichen Staatsbürger, die das 25. Lebensjahr vollendet hatten, an die Urnen gerufen. Da Gesetze, insbesondere das jährlich zu verabschiedende Reichshaushaltsgesetz, nur in Kraft treten konnten, wenn der Reichstag zustimmte, die Gesetzesvorlagen aber von einer Regierung kamen, die vom Kaiser ernannt und nicht vom Reichstag gewählt wurde, musste die Regierung für jedes Gesetzesvorhaben neue Mehrheiten im Reichstag – wie auch im Bundesrat – beschaffen. Daher war es hilfreich, wenn es gelang, durch geschickte Wahlmanipulation regierungsfreundliche Mehrheiten zu beschaffen. Der Wahlkampfdemagogie war somit im Kaiserreich Tür und Tor geöffnet – insbesondere auch, da die Parteien keine Regierungsverantwortung übernahmen.28
Parteien kamen in der Reichsverfassung nicht vor. Es bestand das Prinzip der Persönlichkeitswahl und bei Parlamentsabstimmungen unterlagen die Abgeordneten einzig ihrem Gewissen und keinem Fraktions- oder Parteizwang.29 Daher waren viele Abgeordnete anfangs nur schwach in parteiähnlichen Organisationen zusammengeschlossen. Bald sahen aber liberale wie konservative Politiker, dass sowohl die Sozialdemokraten wie auch das katholische Zentrum mit ihrer |21◄ ►22| strafferen Organisation große Erfolge bei den Wahlen erzielten, woraufhin sich auch die Liberalen und die Konservativen enger zusammenschlossen.30
Abbildung A1: Anteile der Parteien / Parteigruppen an den Reichstagsmandaten, 1871–1912. Linksliberale, Nationalliberale und Liberale sind unter »Liberale« zusammengefasst. Freikonservative und Deutsch-Konservative sind unter »Konservative« zusammengefasst. Splittergruppen und Minderheiten sind in der Abbildung nicht berücksichtigt. Eigene Berechnungen nach Berghahn, Kaiserreich, S. 312– 313.
Die großen Tendenzen der Reichstagsmehrheiten illustriert Abbildung A1, die die Anteile der politischen Gruppierungen an den Parlamentssitzen zeigt. Drei große Entwicklungen werden sichtbar: Erstens gab es seit der Reichsgründung einen Niedergang der Liberalen, die wiederum in mehrere, in sich instabile Gruppierungen zerfielen, zweitens setzte seit den späten 1880er Jahren ein signifikanter Aufstieg der Sozialdemokraten ein, drittens stellten Zentrum und Konservative während der gesamten Existenz des Kaiserreichs jeweils ein Fünftel bis ein Viertel der Abgeordneten.
Anzumerken ist, dass die Verteilung der Reichstagsmandate nicht der Verteilung der Wählerstimmen entsprach, da die Wahlkreiszuschnitte während des Kaiserreichs nicht verändert wurden, aber immer mehr Wahlberechtigte in die wachsenden industriellen Ballungszentren migrierten. Diese demographische Entwicklung beeinträchtigte vor allem die SPD, deren Wähler hauptsächlich aus |22◄ ►23| der Industriearbeiterschaft stammten. Demgegenüber profitierten davon konservative Kandidaten, die mit relativ wenigen Stimmen Mandate in den zunehmend dünnbesiedelten Wahlkreisen Ostelbiens erlangen konnten. Bei den Reichstagswahlen im Jahre 1912 beispielsweise benötigte die SPD durchschnittlich fast 39.000 Wählerstimmen, um ein Mandat zu erlangen, während die konservativen Abgeordneten im Durchschnitt nur 26.000 Stimmen benötigten. Selbst bei den Reichstagswahlen, bei denen jeder Wähler das gleiche Stimmengewicht hatte, bildete die Mandatsverteilung die Stimmenverteilung zunehmend schlechter ab.
Verstärkt wurde die Entfremdung von Volkswillen und Parlament durch die Struktur des Bundesrates. Dort saßen Vertreter der jeweiligen Landesregierungen, die ihrerseits oftmals nach einem ungleichen Wahlrecht gewählt worden waren. Am bekanntesten ist in dieser Hinsicht das preußische Dreiklassenwahlrecht, das die Wähler nach ihrem Einkommensteueraufkommen in drei Klassen gruppierte. Die Bürger mit den höchsten Steuerzahlungen wurden so lange einer Klasse zugewiesen, bis die Klassenmitglieder ein Drittel der Steuererträge des Urwahlbezirks repräsentierten. Die dann folgenden Bürger wurden der zweiten Klasse zugewiesen, bis auch in dieser ein Drittel der Steuersumme vereinigt war. Die restlichen Steuer zahlenden Bürger bildeten die dritte Klasse. Dabei blieb ein Zehntel der eigentlich qualifizierten Personen – Männer, die das 24. Lebensjahr vollendet hatten – von der Wahl ausgeschlossen, da sie die Steuerqualifikation nicht erfüllten. Jede Klasse wählte nun ein Drittel der Wahlmänner und die Wahlmänner wiederum kürten den Abgeordneten. Faktisch bedeutete dies, dass die Wahlmänner der beiden oberen Klassen, die rund 15 Prozent der Wähler repräsentierten, den Abgeordneten bestimmten. Der preußische Landtag war daher ein Hort konservativer Politiker. Bei den Landtagswahlen von 1908 beispielsweise entfielen 48 Prozent der Sitze, aber nur 17 Prozent der Stimmen auf konservative Abgeordnete.31 Über den Bundesrat und die preußische Regierung gewannen die konservativen Kräfte erheblichen Einfluss auf die Reichspolitik. Volksvertretung und Volkswille entkoppelten sich zusehends.
Die wichtigen politischen Ziele, die in diesem Rahmen erreicht werden mussten, betrafen die sogenannte erste und zweite innere Reichsgründung. Bismarck musste eine kleindeutsche politische Mehrheit hinter dem neuen Reich versammeln. Die neue Mehrheit bestand für den Kanzler zunächst aus den national-liberalen Kräften der süddeutschen Bundesstaaten wie auch Preußens. Seit der gescheiterten Revolution von 1848 forderten die nationalliberalen Kräfte ein geeintes Deutschland, sodass diese Parteien – und nicht die den Partikularismus verteidigenden Konservativen, – das junge Reich enthusiastisch unterstützten. Bei den ersten Reichstagswahlen im März 1871 erreichten die Nationalliberalen |23◄ ►24| zwei Fünftel der Sitze und waren damit die mit Abstand stärkste Partei. In einigen Bundesstaaten, beispielsweise in Bayern, Württemberg und Baden, entfielen auf die liberalen Parteien mehr als die Hälfte der Stimmen. Das Deutsche Reich stützte sich also zunächst auf süddeutsche Mehrheiten, während in Preußen der einzelstaatliche Patriotismus eine starke Kraft blieb.32
Bismarck musste das junge Reich nicht nur von den Einzelstaaten, sondern auch von Österreich abgrenzen. Der beschrittene Weg war durch die Religion bestimmt. Im Gegensatz zum von den katholischen Habsburgern dominierten, bis 1804 bestehenden, alten Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen wurde nun das »Heilige evangelische Reich deutscher Nationen« unter Führung der Hohenzollern proklamiert.33 Diese protestantische Herausforderung war ein Grund dafür, dass katholische Wähler nur bei der ersten Reichstagswahl hinter den liberalen Parteien standen und sich danach der katholischen Zentrumspartei zuwandten.34 Der Kulturkampf war ein anderer Grund für diese Bewegung. Bei diesem Kampf ging es einerseits um die Rolle von Staat und Kirche im neuen Reich sowie andererseits um den Widerspruch zwischen päpstlicher Unfehlbarkeit und bürgerlich-liberaler Rationalität. Ein weiterer Faktor dürfte der Verlust staatlicher Souveränität des Vatikans gewesen sein, denn erst nachdem Napoleon III., Schutzpatron des Heiligen Stuhls, von Deutschland besiegt worden war, marschierten italienische Truppen in den Vatikan ein. Bismarck hatte Italien dafür zuvor freie Hand gegeben. Innerhalb Deutschlands drängten das Reich und einige Bundesstaaten mit einer Reihe von Gesetzen den kirchlichen Einfluss zurück. Beispielsweise wurde es Pfarrern ab Ende 1871 strafrechtlich untersagt, staatliche Angelegenheiten auf den Kanzeln in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise zu behandeln. 1872 und 1873 folgten preußische Gesetze, die die geistlichen Schulinspektoren durch staatliche ersetzten und den Zugang zum Priesteramt vom Abitur abhängig machten. 1875 eskalierte der Konflikt weiter, denn in diesem Jahr wurde die – bis heute notwendige – obligatorische Zivilehe eingeführt und es wurden alle staatlichen Geldzuweisungen an die katholische Kirche untersagt.35 Erst nachdem das Reich sich gefestigt hatte und im Vatikan ein neuer Papst gewählt worden war, wurden zwischen 1880 und 1887 die meisten Repressionsgesetze nach und nach wieder abgeschafft und damit der Zentrumspartei die Stützung der Regierung erleichtert.36
Auf die nationalliberale erste Reichsgründung folgte 1878 die konservative zweite Reichsgründung. Die Banken-, Börsen- und Wirtschaftskrise von 1873 sowie der weltweite Verfall der Agrarpreise ab Mitte der 1870er Jahre diskreditierte |24◄ ►25| die einen wirtschaftlichen Liberalismus unterstützenden Parteien und stärkte den Wunsch krisengeschüttelter Branchen nach Zollprotektion. Die Allianz von Eisen und Roggen entstand in diesen Jahren. Vorboten des bevorstehenden Politikwechsels waren 1876 der Rücktritt des wirtschaftsliberalen Chefs des Reichskanzleramtes, Rudolf von Delbrück, und die straffere Organisation der konservativen politischen Kräfte in der Deutschkonservativen Partei im selben Jahr. Obwohl die Reichstagswahl von 1877 den Nationalliberalen leichte Verluste brachte, bot Bismarck ihrem Parteiführer, Rudolf von Bennigsen, den Eintritt in die Regierung an. Dieser forderte jedoch, dass zwei links stehende Liberale ebenfalls in die Regierung aufgenommen werden müssten. Dies war für Bismarck nicht akzeptabel und bot ihm einen Grund, das Bündnis mit den Nationalliberalen aufzukündigen. Die Scheidungsrede hielt Bismarck am 22. Februar 1878, als er im Reichstag ein staatliches Tabakmonopol und Schutzzölle forderte, zwei für die Nationalliberalen unannehmbare Forderungen. Andererseits unterstützten Konservative und Zentrum Bismarcks auch fiskalpolitisch motivierte Schutzzollpolitik. Ein Attentat auf Kaiser Wilhelm I. im Mai 1878 verschaffte Bismarck die Möglichkeit, mit Liberalismus und Sozialismus abzurechnen, denn der Attentäter wurde sozialdemokratischen Kreisen zugerechnet. Der Aktionsradius dieser Partei sollte durch das sogenannte Sozialistengesetz eingeschränkt werden. Die liberalen Parteien lehnten dieses Vorgehen ab, doch ein zweites Attentat auf den Kaiser verschaffte Bismarck einen Anlass zur Auflösung des Reichstags im Juni 1878. Aus den folgenden Reichstagswahlen gingen Konservative und Freikonservative als Gewinner, Nationalliberale, Fortschrittspartei und Sozialdemokraten als Verlierer hervor. Nun schwenkten die Nationalliberalen auf die Regierungslinie ein und der neue Reichstag verabschiedete das Soziallistengesetz, das bis 1890 in Kraft bleiben sollte.37 Die neue Mehrheit hinter Bismarck verabschiedete darüber hinaus im Juli 1879 mit den Stimmen von Frei- und Deutschkonservativen sowie Zentrum und Nationalliberalen die Schutzzollgesetze, die die Abkehr Deutschlands vom Wirtschaftsliberalismus markierten.38 Diese Kehrtwende der Nationalliberalen führte zur Spaltung der Partei und zum Übertritt zahlreicher Abgeordneter zu linksliberalen Gruppierungen. 39 Die Nationalliberalen, die nach den Reichstagswahlen von 1871, 1874, 1877 und 1878 jeweils die stärkste Fraktion stellten, verloren diese Position bei den Wahlen von 1881: Ihre Mandatszahl brach von 109 auf 47 ein. Gleichzeitig erhöhten die Linksliberalen ihre Mandatszahl von 29 auf 115. Eine stabile parlamentarische Mehrheit hatte Bismarck nun nicht mehr, denn die beiden konservativen Parteien stellten gemeinsam nur ein Drittel der Abgeordneten, und |25◄ ►26| der Reichskanzler benötige dementsprechend für jede Abstimmung die Unterstützung anderer Parteien.40
Gleichwohl konnten zwei wegweisende politische Entscheidungen Mitte der 1880er Jahre gefällt werden: Der Beginn der deutschen Kolonialpolitik und der Aufbau eines Sozialversicherungssystems.41 Erst die vorgezogenen Reichstagswahlen von 1887 verschafften Bismarck wieder eine stabile Parlamentsmehrheit. Grund für die vorzeitige Auflösung des Reichstags war der Militäretat, der erneut für sieben Jahre bewilligt werden sollte. Da die Militärausgaben den Löwenanteil der Reichsausgaben umfassten, bedeutete die Verabschiedung eines mehrjährigen Militäretats faktisch die Aushebelung des Budgetrechts des Reichstags. Nachdem der Militäretat abgelehnt worden war, löste Bismarck den Reichstag auf und führte gemeinsam mit den rechten Parteien mit Hinweis auf die Revanchegelüste Frankreichs einen Militärwahlkampf. Tatsächlich ergaben die Reichstagswahlen von 1887 eine regierungsfreundliche Mehrheit aus Nationalliberalen, Deutschkonservativen und Freikonservativen.42
Bevor auch dieser Reichstag 1890 vorzeitig aufgelöst wurde, weil die Nationalliberalen der von Bismarck geforderten Verlängerung des Sozialistengesetzes nicht zustimmen wollten, kam es 1888 zum Dreikaiserjahr. Am 9. März 1888 starb der 91-jährige Kaiser Wilhelm I. Sein Nachfolger, der liberale Kaiser Friedrich III., saß nur 99 Tage auf dem Thron und verstarb am 15. Juni 1888 an Kehlkopfkrebs. Auf ihn folgte der dritte und letzte deutsche Kaiser, der erst 29-jährige Wilhelm II.43 Schnell ergaben sich Konflikte zwischen dem jungen Kaiser, der aktiv in die Politik eingreifen wollte, und dem alten Kanzler, der sich an die zurückhaltende Politik von Wilhelm I. gewöhnt hatte. Auf dem Höhepunkt des Konflikts zwischen Kanzler und Kaiser untersagte der Kanzler sogar den preußischen Ministern ohne seine Einwilligung beim Monarchen Immediatvorträge zu halten. Auf der inhaltlichen Ebene vertraten Monarch und Regierungschef vor allem im Bereich der Sozialpolitik unterschiedliche Ziele. Der Kaiser wünschte den Ausbau der Arbeitsschutzgesetzgebung, der Kanzler jedoch die unbefristete Verlängerung des Sozialistengesetzes. Zu bedenken ist dabei, dass der Kanzler keine parlamentarische Mehrheit für seinen Gesetzesentwurf hatte, denn die Nationalliberalen lehnten ihn ab. Der Kaiser seinerseits trug dem Kanzler seine Vorstellungen für die neue Arbeitsschutzgesetzgebung vor und bat um ein milderes Sozialistengesetz. Bismarck lehnte Letzteres ab, bot seinen Rücktritt an und arbeitete Erlasse zur Arbeiterschutzfrage aus. Der Graben zwischen Bismarck und Kaiser Wilhelm II. war jedoch zu tief, um überwunden zu werden. |26◄ ►27| Bismarck reichte sein Rücktrittsgesuch ein und wurde am 20. März 1890 entlassen. 44
Das persönliche Regiment des jungen Kaisers begann nach der Entlassung Bismarcks. Sein erster Pfeiler wurde das militärisch geprägte engere Umfeld des Kaisers am Hof, d. h. seine Flügeladjutanten und Ordonanzen. Hier konnte die Armee direkt Einfluss auf den höchsten Mann im Staate nehmen. Den zweiten Pfeiler bildeten die Chefs der drei Geheimen Kabinette, die für Militär-, Marine-und Zivilangelegenheiten zuständig waren und das Bindeglied zwischen Hof und Staat bildeten. Insbesondere berieten sie Wilhelm II. bei der Auswahl von Ministern, Staatssekretären und Botschaftern. Diese wählte Wilhelm II., anders als sein Großvater, persönlich aus. Das Armee- und Marinekabinett war zudem für alle Beförderungen und Versetzungen im preußischen Heer und in der Reichsmarine zuständig. Den dritten Pfeiler bildeten schließlich die persönlichen Freunde des Kaisers, die einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf seine politischen Entscheidungen nahmen.45 Die auf Bismarck folgenden Reichskanzler sahen sich somit einem neuen Machtzirkel rund um den Kaiser gegenüber. Ihr politischer Handlungsspielraum war deutlich geringer als derjenige des Eisernen Kanzlers.
Zwischen März 1890 und Oktober 1894 war der ehemalige General Graf Leo von Caprivi Reichskanzler und läutete einen neuen Kurs in der Wirtschafts- und Sozialpolitik ein. Anders als Bismarck wollte er dabei mit allen im Reichstag vertretenen Parteien mit Ausnahme der Sozialdemokraten zusammenarbeiten. Zu Beginn seiner Kanzlerschaft leitete Caprivi das vorläufige Ende der Schutzzollpolitik ein, indem 1891 Handelsverträge mit Österreich-Ungarn, Italien, Belgien und Schweiz geschlossen wurden. 1893/94 folgten weitere Verträge mit Spanien, Serbien, Rumänien und Russland. All diese Verträge folgten einem einfachen Prinzip: Deutschland baute Zollbarrieren für Agrarprodukte ab und erhielt dafür leichteren Zugang für seine Industrieprodukte auf den Auslandsmärkten. Freilich ließ die Unterstützung des Kanzlers durch die konservativen Parteien nach, denn diese befürworteten Schutzzölle für die Landwirtschaft und fürchteten den Import billigen Getreides aus Rumänien und Russland. Sozialpolitische Zugeständnisse sollten die Arbeiterschaft stärker an den Staat binden. Daher beinhaltete der neue Kurs das Verbot von Sonntags- und Kinderarbeit, die Begrenzung der täglichen Arbeitszeit für Frauen und Jugendliche, die Einrichtung von Gewerbegerichten unter Beteiligung der Arbeitnehmer sowie die Reform der preußischen Einkommensteuer. Caprivi führte somit eine Reihe sozialpolitischer Reformen durch und hoffte dadurch die Unterstützung der Arbeiterschaft zu gewinnen.
|27◄ ►28|
Zu einer Regierungskrise kam es jedoch nicht auf dem Feld der Wirtschafts-und Sozialpolitik, sondern auf dem der Schulpolitik. Caprivi, der zunächst auch preußischer Ministerpräsident war, legte gegen den Widerstand der Freisinnigen ein kirchenfreundliches Schulgesetz vor, zog dieses dann gegen den Widerstand des Zentrums zurück und trat nach dieser Niederlage im März 1892 als preußischer Ministerpräsident zurück. Die Verärgerung der beiden Parteien führte dazu, dass sie im Mai 1893 der Caprivi’schen Heeresvorlage nicht geschlossen zustimmten, sodass diese scheiterte. Anschließend löste der Kanzler den Reichstag auf. Bei den Reichstagswahlen gewannen die Nationalliberalen und die Freikonservativen, während Zentrum und Linksliberale Sitze verloren. Das Wahlvolk unterstützte tendenziell den Reichskanzler, dessen Heeresvorlage vom neuen Reichstag auch angenommen wurde. Allerdings wanderten trotz der neuen Sozialpolitik immer mehr Wähler zur Sozialdemokratie, sodass sich Wilhelm II. und seine Berater von weiteren Sozialreformen abwandten. Die Kanzlerschaft Caprivis endete schließlich im Kampf gegen die Sozialdemokratie: Der preußische Ministerpräsident Graf Botho zu Eulenburg forderte 1894 ein neues Ausnahmegesetz gegen die Sozialdemokraten, der Kanzler lehnte dies ab. Wilhelm II. beendete den Konflikt, indem er beide Kontrahenten entließ.46
Zum neuen Reichskanzler wurde der frühere bayerische Ministerpräsident und Statthalter von Elsass-Lothringen, Fürst Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst ernannt, der sechs Jahre in diesem Amt bleiben sollte. Er hatte sich nicht nach dem Amt gedrängt und sogar Gründe gegen seine Ernennung vorgebracht. Unter seiner Ägide wurde vor allem der Kampf gegen die Sozialdemokratie fortgesetzt. Dieser Kampf basierte allerdings nicht auf Repressionsgesetzen, sondern auf einer Sammlung aller Kräfte, die die bestehende Gesellschaftsordnung befürworteten. Dafür war Hohenlohe gegenüber vielen politischen Gruppierungen zu Konzessionen bereit. Beispielsweise sollten Handwerk, Industrie und Landwirtschaft durch eine neue Gewerbe- und Zollpolitik hinter der Regierung versammelt werden. Dies gelang jedoch nur eingeschränkt, sodass die Flottenpolitik als neues Sammlungsinstrument erfolgreich genutzt wurde. Gegner der Flottenrüstung waren die konservativen Parteien, denn ihnen galt die Schlachtflotte als Konkurrenz zum preußischen Heer. Der ersten Flottenvorlage stimmten sie 1898 zwar noch zu – sie wollten nicht gemeinsam mit den Sozialdemokraten gegen die Flotte stimmen –, aber die zweite Flottenvorlage von 1900 unterstützten sie erst, nachdem ihnen der Kanzler ein neues Zolltarifgesetz in Aussicht gestellt hatte.47
|28◄ ►29|
Dieses neue Zolltarifgesetz wurde im Dezember 1902 von Hohenlohes Nachfolger, Fürst Bernhard von Bülow, einem Karrierediplomaten, der zwischen Oktober 1900 und Juli 1909 Reichskanzler war, im Reichstag durchgesetzt.48 Dabei konnte er sich, wie schon sein Vorgänger Hohenlohe, bis 1906 auf die Unterstützung des Zentrums verlassen. Das Zentrum trug einerseits die Weltpolitik von Kaiser und Kanzler mit und handelte dafür andererseits Wohltaten für katholische Arbeiter und Kleinbürger aus. Der Ausbau der Unfall- und Krankenversicherung, das Verbot von Kinderarbeit in der Heimindustrie und die Förderung des Arbeiterwohnungsbaus fallen in diese Periode.49 Des Weiteren unterstützten nach wie vor die Deutschkonservativen, die Freikonservativen und die Nationalliberalen den Kanzler. Der Lohn der beiden konservativen Parteien bestand sowohl in den 1902 eingeführten höheren Agrarzöllen als auch im Baustopp des Mittellandkanals im Jahre 1905. Das Teilstück des Kanals zwischen Elbe und Hannover wurde nicht gebaut, sodass die Transportkosten für überseeisches Getreide in den Raum östlich von Hannover hoch blieben, wodurch die ostelbischen Großagrarier geschützt wurden.
Die große Koalition der staatstragenden Kräfte zerbrach, als kolonialpolitische Konflikte überhandnahmen. Das Zentrum konnte und wollte 1906 die brutale Militärintervention in Südwestafrika nicht unterstützen. Bei den nun folgenden sogenannten Hottentottenwahlen konnte das Zentrum zwar an Sitzen zulegen, eine kolonialfreundliche neue Mehrheit aber nicht verhindern. Bülow regierte fortan mit Unterstützung von konservativen Parteien, Nationalliberalen und Linksliberalen.50 Gescheitert ist Bülow schließlich sowohl an einem außenpolitischen Thema, der Daily Telegraph-Affäre, als auch an einem innenpolitischen Thema, der Reichsfinanzreform von 1909. Kernstück dieser Reform war ein Reichserbschaftsteuergesetz, das der Deutschkonservativen Partei zu eigentums-, der Zentrumspartei zu familienfeindlich war. Dieser Kernbestandteil der Reichsfinanzreform scheiterte. Bülow wurde daraufhin im Juli 1909 aus seinem Amt entlassen.51
Der letzte Friedens- und erste Kriegskanzler des Deutschen Reichs war der Verwaltungsbeamte Theobald von Bethmann-Hollweg, der bis Juli 1917 im Amt bleiben sollte. Unter seiner Kanzlerschaft spitze sich die innen- wie außenpolitische Lage des Reichs zu. Außerdem sah er sich ab 1912 einem Reichstag gegenüber, der jedes Regieren praktisch unmöglich machte, denn mit den Wahlen im Januar 1912 waren die Sozialdemokraten zur stärksten Reichstagsfraktion geworden. Rechnerisch war eine staatstragende Mehrheit nur noch möglich, wenn |29◄ ►30| Freikonservative, Deutschkonservative, Nationalliberale sowie Linksliberale und Zentrum einer Regierungsvorlage zustimmten.52 Dies war praktisch unmöglich, sodass nur noch eine große innenpolitische Entscheidung vor dem Krieg fiel: Im April 1913 stimmte der Reichstag einer Heeresvorlage zu, in deren Folge stufenweise die Friedenspräsenzstärke des Heeres vermehrt werden konnte. Indirekt unterstützten sogar die Sozialdemokraten diese Politik. Sie lehnten zwar die Heeresvorlage ab, hatten aber zuvor die zur Finanzierung notwendigen Steuergesetze angenommen.53
Während des Krieges galt in Deutschland der so bezeichnete Burgfriede –d. h., alle im Reichstag vertretenen Parteien, die Gewerkschaften und die Unternehmerverbände sollten ihre politischen Divergenzen während des Krieges aussetzen. Bereits am 2. August 1914 verzichteten die Gewerkschaften auf Streiks während des Krieges und stellten alle schwebenden Lohnkämpfe ein. Einen Tag später beschloss die Reichstagsfraktion der Sozialdemokraten mit überwältigender Mehrheit, den beantragten Kriegskrediten zuzustimmen, und nahm dabei die Spaltung der Partei in Kauf. Dafür erwarteten die (Mehrheits-)Sozialdemokraten und Gewerkschaften für die Zeit nach dem Krieg die Anerkennung als staatstragende Partei. Diese Rolle wollte ihnen die herrschende Elite nicht zugestehen. Die Entscheidung wurde freilich auf die Zeit nach Kriegsende vertagt. Bis zu seinem Sturz im Juli 1917 konnte Bethmann-Hollweg den innenpolitischen Stillstand mehr oder weniger aufrechterhalten. Erst die vom Reichstag verabschiedete Friedensresolution führte zu einem entscheidenden Konflikt zwischen Reichstag, Reichskanzler und Oberster Heeresleitung. Diese drängte auf die Entlassung Bethmann-Hollwegs und ersetzte ihn durch eine Reihe von blassen Kanzlern: Georg Michaelis (Juli bis November 1917), Graf Georg von Hertling (November 1917 bis September 1918) und schließlich Prinz Max von Baden (Oktober und November 1918). Die tatsächliche Regierungsgewalt verlagerte sich zunehmend zur Obersten Heeresleitung, insbesondere nachdem im August 1916 Paul von Hindenburg an ihre Spitze rückte.54 Das Kaiserreich war von einer konstitutionellen Monarchie zu einer Militärmonarchie geworden.
|30◄|