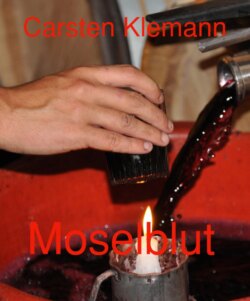Читать книгу Moselblut - Carsten Klemann - Страница 4
Unterwegs
ОглавлениеDas Angebot kam überraschend und ausgerechnet am Tag von Bert Gernsheims Beerdigung. Christine hatte sich den Vormittag frei genommen, um an dem Begräbnis teilzunehmen zu können. Bert wurde auf dem Friedhof eines Hamburger Vororts beerdigt, er wusste seit Jahrzehnten, dass sein Körper einmal in das dortige Familiengrab kommen würde. Außer seiner Schwester und deren Familie nahm etwa ein Dutzend Personen an der Feier teil. Sie fand klassisch mit pastoraler Ansprache und Orgelmusik statt. Erik umfasste Christines Hand, als die Tränen über ihre Wangen liefen.
Der große Sarg aus dunklem Holz mit goldenen Beschlägen besaß etwas Standesgemäßes, das zu Bert passte. Die sechs vom Beerdigungsunternehmer mit altertümlichen Kostümen ausgestatteten Sargträger wirkten hingegen operettenhaft, und Bert wäre dazu bestimmt ein bissiger Spruch eingefallen. Christine warf eine Rose auf seinen Sarg, an die ein kleiner Rebzweig gebunden war. Als kleiner Dank für alles, was er mit ihr geteilt hatte, die Gespräche, die sich fast immer um Wein und fremde Länder gedreht hatten.
Sie hatte Gernsheims Schwester gesagt, dass sie nicht zum Leichenschmaus bleiben würde. Sie wollte nicht mit dieser ihr unbekannten Familie das Wechselbad aus Trübsal und befreiendem Gelächter erleben, wie sie es von Totenfeiern aus ihrem Verwandtenkreis kannte. Erik blieb. Er kannte die Schwester schon länger flüchtig, nun sollte er ihr bei der Auflösung der Warenbestände helfen.
Zurück in der Redaktion, war Christine froh, die geschäftigen Kollegen um sich zu haben. Allerdings würde sie keine einzige Zeile an diesem Tag schreiben können. Vielleicht ein paar Mails beantworten, Unterlagen sichten, nach neuen Themen suchen ...
Als Christine ihr Büro aufschließen wollte, tauchte am anderen Ende des Ganges Gesine Myersbergers schlanker, hoch aufgeschossener Körper auf. Sie winkte Christine mit lässig über dem Kopf ausgestrecktem Arm zu sich.
Gesine Myersberger machte oft ein fröhliches, geradezu kindlich argloses Gesicht. Doch es konnte sich im nächsten Moment übergangslos verändern und dann fordernd und kompromisslos erscheinen. Auf dem Besuchersofa in ihrem Büro saß ein kleiner Teddy, der angeblich ihr erster war. Während die meisten Chefbüros von futuristischen Lichtaufhängern beleuchtet wurden, stand auf ihrem Schreibtisch eine verschnörkelte Jugendstil-Lampe. Gegenüber hingen getrocknete rote Rosen in einem großformatigen Rahmen hinter Glas. «Von einem Verehrer», sagte Gesine Myersberger, wenn sie nach dem Künstler gefragt wurde. Manchmal war Christine anwesend, wenn Leute von Marktforschungsinstituten oder PR-Abteilungen das Zimmer betraten. Deren staunende Blicke schienen zu sagen: Ja, in einer solchen Umgebung arbeitet die Chefredakteurin einer erfolgreichen Frauenzeitschrift. Gesine Myersberger war kinderlos, seit zwölf Jahren geschieden, und man munkelte, sie sei glücklich verliebt.
Als Christine den langen Flur hinter sich gebracht und das Chefsekretariat erreicht hatte, saß Gesine Myersberger wieder an ihrem Schreibtisch. Versunken starrte sie auf ihren Computer und tippte plötzlich wie entfesselt Buchstaben ein. Christine mochte wetten, dass sie nicht an einem Artikel, sondern an einer E-Mail schrieb.
«Ah, Christine.» Gesine Myersberger stand auf, als sie ihre Mitarbeiterin bemerkte, lief um sie herum und schloss die Tür. Ein deutliches Zeichen, dass es um ernste Entscheidungen ging. Sie schien vergessen zu haben, warum Christine an diesem Vormittag der Redaktion ferngeblieben war, obwohl’ sie bei ihr persönlich um Erlaubnis gebeten hatte. Wahrscheinlich wusste die Chefin nicht einmal mehr, dass Christine überhaupt fort gewesen war.
Gesine Myersberger nahm wieder Platz, ohne Christine einen anzubieten. «Ich fand deine Idee auf der letzten Redaktionskonferenz großartig. Ich konnte das dort nicht weiter mit dir besprechen, du weißt.» Ihre Augen rollten genervt. «Was du erzählt hast, genau so was brauchen wir. Nach draußen gehen, sich selbst ein Bild machen, Vorreiter sein. Selbst wenn sich nur ein Bruchteil der Leser wirklich dafür interessiert oder die Texte liest. Für das Image von Convention ist es unbezahlbar, und es soll Leute geben, die behaupten, Convention sei nichts als Image.» Christine Myersberger lachte vergnügt und schob sich mitsamt ihrem Stuhl näher an den Tisch heran. «Lass uns eine Abmachung treffen, mit der wir beide glücklich sind. Setz dich doch!»
Christine brach an einem Freitagnachmittag, zwei Wochen nach dem Gespräch mit Gesine Myersberger, in Richtung
Mosel auf. Die Chefin hatte es plötzlich eilig gehabt, den Plan zu verwirklichen. Nur Christine sah sich bis zu ihrer Abreise täglich vor einem neuen Hindernis stehen. Sie musste für die Zeit ihrer Abwesenheit eine Menge vorarbeiten und organisieren, ihr Konzept planen, obwohl sie sich noch gar nicht bereit fühlte für das Projekt, das sie selbst vorgeschlagen hatte. Sie war davon ausgegangen, frühestens in einem halben Jahr loszufahren — auf alle Fälle erst, wenn sich ihr Alltag beruhigt hatte.
Sie legten nicht fest, wie lange Christine an der Mosel bleiben sollte. «Sieh dich um, schick uns Texte, und dann schätzen wir die Lage ab», hatte Gesine Myersberger gemeint. Eine Volontärin, die bald ihre Ausbildung abschloss, sollte Christines Alltagsgeschäfte in der Redaktion übernehmen. Dass sie sich dafür in ihrem Büro einrichtete und persönliche Fotos aufstellte, erstaunte Christine. Aber egal, die Dinge sollten ihren Lauf nehmen, so oder so ...
Die Hamburger Straßen boten das übliche Bild. Christine fuhr im Schritttempo durch eine von Marktfahrzeugen verstopfte Straße, sie sah die großen Ankündigungstafeln eines Kinos, vor dem heute Abend die Leute Schlange stehen würden. Bald kam die Einfahrt zu einem riesigen Weingeschäft, in dem Christine oft einkaufte, wenn sie abends Gäste hatte. All diese Dinge schienen plötzlich unendlich fern zu sein.
Sie fuhr bereits 3o Kilometer auf der Autobahn, als es ihr einfiel: Sie hatte vergessen, den vermeintlichen Drohbrief bei der Polizei abzugeben. Sofort nahm sie den Fuß vom Gas, während sich in ihrem Kopf finstere Vorstellungen jagten, welche Folgen ihre Unterlassung haben könnte. Immer noch konnte sie umkehren, doch bei dem Gedanken graute es ihr. Bei der nächsten Abfahrt entschied sie sich im letzten Moment dagegen, rechts zu blinken. Sie konnte den Brief ja auch per Post schicken. Er musste nach wie vor in einem Seitenfach ihrer Handtasche stecken. Wahrscheinlich beruhte er sowieso auf nichts Ernstem, geschweige denn, dass er mit dem Mord an Bert Gernsheim zu tun hatte. Ihr schlechtes Gewissen konnte Christine trotzdem nicht ganz vertreiben.
Da sie keine Lust hatte, über 700 Kilometer an einem Stück zu fahren und erst am späten Abend an der Mosel anzukommen, hatte sich Christine einen Ort im Münsterland als Zwischenstation ausgesucht. Kurz nach Münster fuhr sie von der Autobahn ab. Das plötzliche Grün der Umgebung, die weiten landwirtschaftlichen Flächen, die Gehöfte und Baumgruppen entspannten ihre Augen. Dann verfuhr sie sich auf der Suche nach ihrem Hotel, plötzlich befand sie sich auf einer schmalen Straße inmitten welliger Weideflächen. Diese Landschaft unterschied sich von den Wäldern und Wiesen der norddeutschen Tiefebene, in der Christine aufgewachsen war. Es schien, als ob das Grün der Bäume hier mehr Schattierungen besaß und die Ebenen nie ganz plan waren.
Christine wusste genau: Sie hätte in der Redaktionskonferenz niemals die Mosel als erstes Ziel für ihre Weinreports genannt, wenn Bert Gernsheim noch leben würde. Nur wegen seiner Begeisterung für die Region und wegen der Flasche, die er ihr hinterlassen hatte, war ihr das Anbaugebiet so wichtig geworden. Gut möglich, dass es sich hier nicht nur um irgendeinen Wein zum Probieren handelte; aber was steckte dann dahinter?
Endlich fand sie das Hotel, einen ehemaligen Gutshof mit mächtigen, beschlagenen Türen und Holzbalken in der Fassade. Christine fuhr auf den leeren Parkplatz, nahm ihre Reisetasche und trat durch den Eingang. Ein langer Teppichläufer führte über Dielenbretter an alten Stichen und Gemälden vorbei zu einem Tresen. Ein junges Mädchen schien nur auf Christine gewartet zu haben. Sie übergab ihr einen schweren Schlüssel.
Ihr Zimmer war groß, mit Blick auf einen Hinterhof zwischen malerischer Fachwerkarchitektur. Christine packte nur die Sachen aus, die sie am nächsten Tag anziehen wollte. Im Bad wusch sie ihr Gesicht und richtete sich die vom Autogebläse verunstalteten Haare. Alles, was nun geschah, hing nur von ihr allein ab. Ein aufregendes Gefühl.
In der Dämmerung verließ sie das Hotel. Eine Fremde allein auf den Straßen einer Kleinstadt, dachte sie lächelnd. Es waren nur wenige Menschen unterwegs, graue, kissenartige Wolken bedeckten den Himmel. Trutzige, aus dunklem Backstein gebaute Häuschen säumten die Gehwege, und wer jetzt an seinem Fenster hinter einer der weißen Gardinen hinausspähte, mochte seiner Phantasie über Christine freien Lauf lassen. Die neue Lehrerin der Grundschule, die sich zum ersten Mal umsah? Die Geliebte eines Familienvaters, angereist aus der Stadt?
Im Ortskern gab es eine hübsche Kirche und einige uralte Gebäude, einstige Gesindehäuser, Reste von Gutshöfen. Hungrig betrat sie die Ratsschänke, ein imposantes Backsteingebäude mit Erkern und großen halbrunden Fenstern. Sie gelangte in einen Saal mit Palmengewächsen und Lichtorgeln in den Ecken. Gegenüber dem Tresen stand ein Großbildschirm, auf dem eine Fernsehshow flackerte. Am Tresen lehnten Leute in Freizeitkleidung. Die Tische waren alle frei.
Christine nahm neben einer monströsen Holzsäule Platz und studierte die Speisekarte mit Imbisskost. Eine junge, blasse Frau kam mit herzlichem Lächeln an Christines Tisch. Sie bestellte eine Pizza und einen namenlosen Sauvignon Blanc aus Frankreich. Eigentlich hatte sie sich den ersten Abend ihrer Reise anders vorgestellt, aber sie fühlte sich wohl. Und war gespannt, wie genießbar das Bestellte sein würde. Wie viele Reisende waren nicht immer wieder darauf angewiesen, die nächstbeste Gelegenheit zum Sattwerden zu nutzen? Leider las man selten über die Qualität von Imbissbuden und gutbürgerlichen Gaststätten, für die man weder reservierte noch einen längeren Anfahrtsweg in Kauf nahm.
Wo Christine morgen essen oder schlafen würde, wusste sie nicht. Es gab genug Möglichkeiten an der Mosel. Sie wollte so bald wie möglich Schlossweingut Meckling besuchen. Laut den Weinführern produzierte es keine Rotweine, das Zeichen WM bedeutete möglicherweise etwas ganz anderes. Doch Christine hatte sich die alten E-Mails von Bert noch einmal angesehen, und in einer schwärmte er über die Aussicht, die ein Weinberg des Gutes bot: «Moselabwärts von Traben-Trarbach, eine Stichpiste hinauf. Es gibt steilere und berühmtere Landschaften, aber ich mag die Gegend am liebsten.» Er hatte die Lage genau beschrieben, und Christine wollte sie auf alle Fälle sehen.
Die Pizza war in Ordnung. Auch der Wein — ein richtig trockener Sauvignon, glasklar und ohne Holznoten. An der Mosel würde niemand auf die Idee kommen, ihn als Hauswein auszuschenken. Das Münsterland war keine Anbauregion, Wein war hier ein beliebiges Getränk unter vielen.
Bei ihrer Rückkehr ins Hotel wurde der menschenleere Empfangssaal schwach von Leuchtstoffröhren unter der Decke erhellt. Christine hatte das Gefühl, ganz allein im Haus zu sein. Als sie ins Bett stieg, fühlten sich die Laken bügelstraff an und rochen so intensiv nach frischer Sauberkeit, dass sie ein Gefühl der Kälte auslösten. Christine schaltete den Fernseher ein, doch noch während die Spätnachrichten liefen, fielen ihr die Augen zu.
Am Morgen schien die Sonne über den Hinterhof ins Zimmer. Ein Blick auf die Uhr zeigte, dass Christine zehn Stunden geschlafen hatte. Der Himmel vor dem Fenster wölbte sich wie ein hellblauer, straffgespannter Baldachin. Christine sprang aus dem Bett. Sie war in die Welt gefahren! Beschwingt wie heute hatte sie sich nach dem Aufstehen lange nicht gefühlt.
Während des Frühstücks in einer großen Wirtsstube mit Holztischen und alten Jagdwaffen an den Wänden bekam sie nur zwei Hotelangestellte zu Gesicht. Das üppige Buffet konnte nicht nur wegen ihr hier stehen. Jetzt erst bemerkte Christine noch einen Tisch, der mit Frühstücksgeschirr gedeckt war. Es gab also mindestens einen weiteren Gast, und sogar einen, der noch später frühstückte als sie. Da es bereits kurz vor zehn war, würde er sich beeilen müssen.
Als Christine kurz darauf an der Rezeption ihre Rechnung bezahlte, hörte sie hinter ihrem Rücken, wie jemand mit schnellen Schritten die Treppe herunterkam und an ihr vorbeiging.
Sie verstaute das Gepäck im Kofferraum, setzte sich in den Wagen und schaltete ihr Handy ein. Tatjana hatte sich auf ihrer Mailbox gemeldet: «... also gestern war dann Uwe da, und ich habe doch nicht ganz so exotisch gekocht. Er brachte einen tollen Bordeaux mit, er ist Fachmann auf dem Gebiet, und da haben wir den erst mal getrunken. Aber dann später zum Käse den Riesling probiert. Das hat Spaß gemacht, vielen Dank nochmal für deine Hilfe, aber irgendwie bin ich doch froh, den Wein nicht zur warmen Mahlzeit serviert zu haben, vielleicht ein anderes Mal ...»
Christine fuhr grinsend los, tankte den Wagen voll und fädelte sich in den Blechstrom auf der Autobahn ein. Im Radio ließ sie ein politisches Magazin laufen, es folgten Nachrichten, sie schaltete auf einen Sender mit Popmusik um, wieder Nachrichten. Irgendwo hinter Bonn schien die Straße in eine gigantische Bühne hineinzuführen. Eine weit ausgedehnte, hügelige Landschaft mit schlanken, elegant zugespitzten
Baumkronen und lieblichen Farbtönen erstreckte sich bis zum Horizont. Auf einem Foto hätte Christine die Toskana vermutet, wären da nicht die seltsamen beckenförmigen Gebilde gewesen, bei denen es sich wohl um Überbleibsel von Vulkanen handelte ... Begann hier vielleicht schon das Land, wo die Zitronen blühen? Goethe hatte Moselwein und Rom geliebt, und die Römer hatten den Anbau des Getränks an diesem Fluss eingeführt. Die Keltereien, Brunnen und Villen, die sie zurückgelassen hatten, wollte Christine sich unbedingt ansehen.
Ihre erste Station sollte Winningen sein, doch bis dahin waren es noch 150 Kilometer. Vor fünf Jahren hatte ein Journalistenkollege dort von einem Erbteil einen kleinen Weinberg gekauft und seinen Traum vom Winzerleben wahr gemacht. Christine hatte lange keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt, doch letzte Woche hatte sie mit Harald Lod telefoniert und ein Treffen vereinbart. Wenn danach noch Zeit war, wollte sie das berühmteste Weingut der Untermosel besuchen. Es befand sich seit Jahrhunderten in Familienbesitz, gelangte aber erst zu seinem Ansehen, nachdem die Zwillingsschwestern Sarah und Dagmar Gordon vor zehn Jahren die Leitung von ihrem Vater übernommen hatten.
Auf einem Straßenschild tauchte zum ersten Mal «Winningen» auf. Christine spürte Ehrfurcht, als ob sie das Etikett eines berühmten, sehr alten Weines betrachtete. Nach der Abfahrt folgte eine schmale, von großen Bäumen überwachsene Straße, die eher wie eine Verbindung zwischen zwei Dörfern aussah. Plötzlich öffnete sich das waldige Dickicht, und das Moseltal trat hervor. Zuerst seine schroffen, bewaldeten Hänge. Die Bäume streckten ihre Laubkronen dicht an dicht und unübersehbar der Mittagssonne entgegen, doch keine einzige Rebe war zu sehen.
Christine folgte den Wegweisern in Richtung Ortsmitte, da sie für ihren Besuch bei Harald Lod noch über eine Stunde Zeit hatte. Er war Österreicher, und sie hatte ihn einst in Wien kennengelernt, wo sie nach ihrem abgebrochenen Studium zwei Jahre als freie Journalistin arbeitete. Als Ressortleiter eines Stadtmagazins sprach er über die Clubs und Weinbars, als handelte es sich um wichtige kulturhistorische Sehenswürdigkeiten. Es machte Spaß, bis zum Morgengrauen mit ihm durch die Bezirke zu streifen. An die Küsse unterm Herbstlaub des Stadtparks oder in der Straßenbahn, wenn die Männerstimme vom Band mit ihrem warmen Wiener Akzent die nächste Haltestelle ankündigte, erinnerte sich Christine gern. Es war aber nur eine kurze Verliebtheit gewesen. Mittlerweile war er verheiratet und hatte zwei kleine Kinder.
Sie konnte direkt am Marktplatz parken, stieg aus und spürte die vom Fahren angespannten Beine. Die Sonne knallte in ihr Gesicht, die sommerlich frische Luft fühlte sich angenehm auf der Haut an. Sie legte eine Hand auf das Dach ihres Autos und blickte sich um. Es herrschte eine ruhige Atmosphäre, als hätte sie nicht eine touristisch begehrte Winzermetropole, sondern ein abgelegenes Bergdorf erreicht.
Sie spazierte über kleine Straßen zum Fluss hinunter. Fachwerkhäuser mit spitzen Giebeln, gedrechselten Fenster-Vorsprüngen und blumengeschmückten Veranden standen neben glatten, funktional aussehenden Fassaden. Wenige Schritte weiter kam sie an Jugendstilvillen und Gebäuden vorbei, die an englische Cottages erinnerten. Gutbürgerliche Schenken warben mit regionalen Gerichten wie Gebaaken Mösselfösch. Es schien aber mindestens genauso viele Ris-torantes und Döner-Buden zu geben. Der Fluss floss schwer und breit vorbei und spiegelte das Blau und Grün von Himmel und Bäumen. Er schien wie gemacht für die Kulisse eines deutschen Märchens. Langsam schlenderte sie zurück zu ihrem Wagen, nun mit Blick auf die Rebenhänge, die zwischen den Häuserzeilen auftauchten. Der Winninger Domgarten wies in großen weißen Lettern wie ein Bahnsteigschild auf sich hin. Auch seine strenggeordnete Rebfläche, die von nüchternen Treppenaufgängen zerschnitten wurde, strahlte die Romantik einer Gleisanlage aus. Christine setzte sich hinters Steuer und studierte die Karte, welche Harald ihr letzte Woche gefaxt hatte. Sie musste wieder ein Stück hinauffahren, um zu seinem Haus zu gelangen.
Sie traf auf ein schmuckloses, alleinstehendes Wohnhaus. Eine zweiflügelige, schräg in die Fassade eingelassene Kellertür zeigte, dass hier schon früher Winzer gelebt hatten. Christine parkte ihren Wagen an der Straße und hörte Kindergeschrei. Als sie den Hof betrat, kam ein großer schwarzer Hund mit glattem Fell bellend um die Ecke geschossen. Sie blieb stehen. Das Tier ebenfalls, während es unentwegt weiterbellte. Ein Pfiff ertönte, und Harald Lod tauchte hinter einer Scheune auf.
Er war nicht besonders groß, sein Körper war jedoch athletisch und hager wie bei einem Langstreckenläufer. Trotz des warmen Wetters trug er einen langärmeligen Pullover. Das streng geschnittene, knochige Gesicht wirkte griesgrämig. Seine kurzgeschorenen Haare überraschten Christine.
Ein Lächeln trat auf seine Lippen, als er sie erkannte. Er befahl dem Hund, sich zu setzen, und kam ihr mit ausgestreckten Armen entgegen.
«Wie schön, dass du da bist. Wie geht es dir?»
Zwischen Schuppen, Flaschencontainern und einem Traktor stand ein Tisch mit Stühlen. Nach hinten wurde der Hof von einem überwucherten, steil ansteigenden Hang begrenzt, in der Ferne waren die Moselhänge zu sehen. Harald streckte seinen Zeigefinger zu einem ungewissen, weit entfernten Ort aus: «Da — man kann meine Lage von hier aus sehen.»
Wieder ertönte Kindergeschrei, vermischt mit Befehlen einer Frau, die nicht zu sehen war. «Edda, meine Frau.» Wieder ein Lächeln auf seinem Gesicht. «Edda! Edda!», rief er.
Sie kam mit langen, schweren Schritten über den Hof, als würde sie durch Schnee stapfen. Edda hielt ihren Kopf gesenkt, als wüsste sie nicht, dass Besuch gekommen war. Doch dann drückte sie Christine mit einem herzlichen Blick die Hand. Eine hübsche, schlanke Frau mit halblangem, dunklem Haar, die Christine sich gut in einer Hamburger Redaktion oder in einem Szenelokal hätte vorstellen können. Doch es lag ein verdrossener Zug auf ihrem Gesicht, und ihre Kleidung wirkte vernachlässigt.
«Christine, eine alte Bekannte von mir», stellte Harald sie vor. «Ich habe dir von ihr erzählt.»
«Guten Tag, herzlich willkommen», sagte Edda. «Machen Sie es sich doch bequem. Ihr habt euch sicher viel zu erzählen.» Sie wies in die Richtung, aus der sie gekommen war, und machte eine vage Kreisbewegung mit dem Zeigefinger, um zu bedeuten, dass sie dort etwas zu tun hatte. Harald Lod sah seiner Frau nach, bis sie erneut den gesamten Hofplatz überquert hatte.
«Kommst du mit in die Küche?», fragte er Christine.
In der Diele des Hauses roch es muffig, und die Tapete erweckte den Anschein, als ob bereits mehrere Generationen von Bewohnern mit ihr gelebt hatten. Kisten, Werkzeuge und dreckige Stiefel lagen herum. Auf dem Küchentisch stand ein Laptop, daneben stapelten sich Zeitungen und ausgedruckte Texte. Es roch nach Kartoffeln und Grünzeug. Christine hatte nicht den Eindruck, dass hier aufwändige Gerichte zubereitet wurden. Als Harald den Kühlschrank öffnete, wirkte dieser sauber, aufgeräumt und fast leer. Er holte eine Schüssel mit einer quarkartigen Masse heraus. «Hier in der Küche kann ich am besten den Schreibkram erledigen.»
Christine spürte wieder ihre Füße und ihre Knie. Sie griff automatisch nach einem Stuhl und setzte sich. «Dir geht es gut?», fragte sie.
Harald stellte die Schüssel hin und setzte sich ebenfalls. «Na ja. Eher nicht.»
«Verkaufst du zu wenig?»
Er lachte auf. «Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, an wen ich verkaufe!»
«Ich verstehe nicht.»
«Na ja, der Gastwirt um die Ecke würde gerne ein paar Flaschen von mir anbieten, wenn ich ihm einen Rabatt von 40 Prozent gebe. Ich könnte auch einen Discounter anschreiben und bitten, mir die Weine unter Selbstkostenpreis abzunehmen.» Er sprach mit gedämpfter Stimme, als wollte er niemanden aufwecken. «Die Arbeit in den Steillagen, wenn man sie richtig macht, müsste allein wegen des körperlichen Aufwands erheblich mehr Geld einbringen. Wenn ich dann an die Qualität meiner Weine und die von einigen anderen denke und dazuzähle, dass nur durch unseren Einsatz die Kulturlandschaft der Mosel gerettet werden kann, komme ich zu astronomischen Preisen. Gerechtfertigte Preise, nicht künstlich hochgeschraubte wie im Bordelais. Aber ich will sie gar nicht. Ich will, dass die Leute bezahlbare Weine trinken können. Das Einzige, worum ich bitte, ist, dass ich und meine Familie von unserer Arbeit leben können.»
«Andere schaffen es doch, zu überleben», sagte Christine. «Manche sogar sehr gut.»
Er stand wieder auf.
«Weil sie gut im Marketing sind. Reden schwingen beherrschen einige Moselwinzer anscheinend am besten. Und wenn man dann die entsprechenden Kontakte hat ...»
«Du bist doch vom Fach, ausgerechnet dir fällt PR schwer?»
«Das habe ich nicht gesagt.» Harald holte einen Brotlaib aus einem Schrank und schnitt Scheiben ab. «Aber ich habe nicht den Beruf gewechselt, um Worte zu drechseln oder Zirkusveranstaltungen durchzuführen.»
Christine konnte sich ausmalen, dass Haralds Hang, es bloß niemandem recht machen zu wollen, seine Geschäfte erschwerte.
«Machen die Gordon-Schwestern auch nur Marketing?» Die Zwillinge gehörten zu den Winzern, die Haralds Probleme nicht hatten. Gesine Myersberger hatte Christine kürzlich sogar gefragt, warum sie denn noch keinen Bericht über die beiden gebracht hätte.
«Die Gordons sind nicht die Schlimmsten.» Harald säbelte sorgfältig und langsam an dem Brot herum. Drei Scheiben hatte er bislang geschafft.
«Ich glaube sogar, dass sie den Terroir-Begriff verstanden haben. Einen Weinberg lieben, seine Natur, die Tiere, die auf ihm leben, und die Sonne, die ihn bescheint. Begreifen, wie der Berg wurde, was er ist: durch einfühlsame Menschenhände, durch den Respekt vor der Natur und das Herauslocken ihrer Möglichkeiten. In Jahren, in Jahrhunderten. Dieses Werk fortführen und im Keller, im Fass, in der Flasche einen Wein hervorbringen, der all das in sich trägt. Im Glas dieses Kunstwerk schmecken, an dem Mensch und Natur über Generationen gearbeitet haben und immer weiterarbeiten. Die Gordons sind noch weit entfernt davon, einen solchen Wein in die Flasche zu bringen. Immerhin, die Idee, die haben sie so ungefähr verstanden. Und damit haben sie den meisten meiner Kollegen einiges voraus.»
Der Hund bellte wieder. Harald sprang auf und blickte aus dem Küchenfenster. Ein blauer Kombi fuhr auf den Hof. Edda rief den Hund zurück. Aus dem Wagen stieg ein Ehepaar, etwa Mitte fünfzig. Er mit grauer Ponyfrisur, Jeans und Sweatshirt, sie mit Kurzhaarschnitt, halblanger Hose und bunter Bluse.
«Entschuldige», sagte Harald und lief aus der Küche. Kurz darauf konnte Christine beobachten, wie er mit lebhaften Gesten und gutgelaunter Miene auf die beiden einredete. Es schienen wichtige Leute zu sein. Plötzlich liefen Harald und seine Frau hektisch aus Christines Blickfeld. Das Paar stand eine Weile unschlüssig da, dann aber lächelten sie wie befreit. Harald und Edda begannen, Stühle, Weinflaschen und Gläser heranzutragen. Harald verschwand im Haus und stand kurz darauf wieder vor Christine in der Küche.
«Sorry. Kundschaft. Komm doch mit raus!» Er nahm das Tablett mit dem Brot in die eine Hand, die Quarkschüssel in die andere und verschwand wieder.
Das Paar nahm am Tisch Platz, und auch Harald und seine Frau setzten sich. Edda stand mehrmals wieder auf, und Christine beobachtete, wie sie zu ihren Kindern lief, die jetzt im Innenhof spielten. Zwei Söhne im Vorschulalter. Christine ging hinaus.
Am Tisch wurde Wein eingeschenkt. Harald hatte verschiedene Sorten nebeneinander aufgereiht und sagte: «Sehen Sie sich die Etiketten auf den Flaschen ganz genau an.» Pflichteifrig schob das Paar die Köpfe vor und zog sie wieder zurück, als Christine eintraf. Beide nickten ihr zu, sichtlich erleichtert darüber, dass sie nicht allein mit den Winzern probieren mussten.
Harald füllte auch für Christine ein Glas zu einem Viertel. «Also» — er streckte den Zeigefinger aus —, «wie Sie sehen, ist es ein Kabinett.» Er nahm sein eigenes Glas und hielt es an die Nase. Christine und das Paar taten es ihm gleich. Haralds Frau hatte ihren Stuhl etwas vom Tisch weggerückt und befand sich in einem rufenden Austausch mit ihren Kindern.
«Der Kabinett ist ein Wein, der in Deutschland große Tradition hat. Gehaltvoller als ein einfacher Qualitätswein, besitzt er doch etwas Spielerisches und hält sich gern in einer Sphäre zwischen Himmel und Erde auf. Er muss sich nicht entscheiden, zu welchem Element er wirklich gehört. Vielleicht ist er auch ein Tänzer, der von der einen zur anderen Schönheit wechselt, aber jede ehrlich bewundert.»
Gedämpftes Gelächter ertönte. Sollte das ein kleiner Lehrgang werden?, fragte sich Christine. Oder worauf wollte Harald hinaus?
«Laut Gesetz darf sich ein Wein nur ab einem bestimmten Mostgewicht Kabinett nennen. Der Most, das ist ganz einfach der ausgepresste Traubensaft, noch nicht zu Alkohol vergoren.»
Eines war klar: Weinkennern würde er diese Details nicht erzählen. Wahrscheinlich kannte er das Paar überhaupt nicht und behandelte jeden wie einen König, der zufällig seinen Hof betrat. Sein Wein schmeckte nicht schlecht, vielleicht war er noch etwas zu unreif und säuerlich.
«Also, den Kabinett», fuhr Harald fort, «den würden manche Weinfunktionäre und Winzer am liebsten abschaffen. Genau wie die Spätlese und die Auslese. Können Sie das verstehen?» Er blickte in die Runde, doch niemand reagierte, weil alle wussten, dass es sich um eine rhetorische Frage handelte. «Nun, der nächste Wein ist in seiner Mineralik tiefgründiger und schwerer zu verstehen als der vorige. Probieren Sie!»
Sie kosteten diesen und noch einen weiteren, bevor der Mann mit dem Pony sagte: «Kabinette haben doch so etwas Beschwingtes. Warum abschaffen?»
Harald lächelte finster. «Weil die Geschäftemacher es wollen! Die Qualität der Weine, ihre Kultur, interessiert sie nicht. Sie wollen aus allen Modegesöffe machen.»
«Aber Harald«, mischte Christine sich ein. Sie hätte lieber geschwiegen, doch konnte das Gerede nicht länger mitanhören. «Noch sind wir weit davon entfernt, die Prädikate abzuschaffen. Und Winzer, die ohne sie auskommen, haben bestimmt nicht nur Mode im Sinn.»
«Ahhhhh«, rief Harald gedehnt. «Madame fühlt sich dem Kartell bereits zugehörig. Ja, die Herrschaften glauben, wir sollten Weine so produzieren, wie die Bordeaux-Mafia es tut. Auf deren Flaschen steht bestenfalls drauf, aus welcher Gegend ein Wein kommt. Und der Markenname, der ist am wichtigsten. Wie bei Coca Cola, Milky Way oder McDonald’s. Wissen Sie, von welchen Gütern ich spreche?» Dieses Mal beugte er sich über den Tisch und fixierte qualvoll lange das Ehepaar.
Die beiden schauten einander an: «Weißt du es?», fragte sie. Er schüttelte den Kopf.
Er lehnte sich wieder zurück. «Chateau Margaux, Chateau Mouton, Lafite und Co. Ich will nicht bestreiten, dass einige dieser Bordeaux-Güter Weltklasse-Weine produzieren können. Aber wer kauft diese Flaschen? Würden Sie eine Flasche Mouton Rothschild — ich spreche von einer einzigen Flasche — für 40o Euro kaufen?»
«Das ist doch der Wahnsinn», sagte die Frau.
«Sie würden es nicht tun, weil Sie Liebhaber sind. Solche Weine sind für Millionäre gemacht, die sich nach Etiketten orientieren. Französische Winzer aber, die bezahlbare Weine produzieren, müssen einer nach dem anderen aufgeben. Ist das richtig, Christine?»
«Vielen geht es nicht gut», sagte sie gequält.
«Warum sollten wir also das französische System kopieren?»
Haralds Frau hatte inzwischen den Tisch verlassen. Sie kniete auf dem Rasen und half einem ihrer Söhne, Spielzeug in eine Plastikwanne zu legen.
«Meine Freundin hier» — er machte eine galante Handbewegung in Christines Richtung — «hat das schöne Wort Prädikat in den Mund genommen.» Haralds Gesicht zeigte rote Flecken, und Christine hatte den Eindruck, dass ihm der Alkohol zu Kopf gestiegen war, obwohl er kaum getrunken hatte.
«Die Prädikatsweine schützen uns davor, dass irgendwann alle Weine gleich schmecken. Der Winzer nimmt andere Trauben für den Kabinett als für die Spätlese oder die Auslese. Er verarbeitet sie auch ganz unterschiedlich und lässt jeden Wein reifen, wie es zu ihm passt. Sein Feingefühl entscheidet darüber. Und Erfahrungen über Generationen hinweg. Das wollen wir uns rauben?»
Man konnte über Haralds Thesen diskutieren. Doch wegen seiner demagogischen Art wollte Christine sich am liebsten verabschieden.
Er nahm die nächste Flasche, hielt inne und betrachtete das Etikett. «Falscher Jahrgang. Wir sind erst bei 01! Hat jemand Lust, in den Keller mitzukommen?» Das Paar warf sich einen versonnenen Blick zu. Es hatte sicher schon viele Keller besichtigt.
Harald stand auf, und alle außer seiner Frau folgten ihm. Es ging zu einem Vorbau neben dem Wohnhaus und dann ein paar Stufen hinab. Harald zog ein schweres Holztor auf. Der schwarze Hund schlüpfte vor seinen Füßen treppabwärts in ein dunkles Gewölbe.
Glühbirnen flammten auf. Christine spürte angenehme Kühle auf der Haut. Es roch sauber, der Geruch von Schimmel wie in vielen anderen Kellern fehlte. Das Metall moderner Gärtanks blitzte. Junge, helle Eichenholzfässer standen in der Nähe von uralten, die Färbungen angenommen hatten, welche an die Felle wilder Tiere erinnerten. Harald bemerkte Christines Blick und deutete auf eines: «Habe ich vom Winzer übernommen, dem ich den Laden abkaufte. Er war seit 8o Jahren in Familienbesitz.» Sie erreichten einen Raum, in dem sich fast bis zur Decke Flaschen in Regalen stapelten. Harald ging zielstrebig darauf zu und zog eine heraus. Er trug sie, indem er den Flaschenhals nur mit Daumen und Zeigefinger umschloss. Wohl, weil er die Temperatur des Weines so wenig wie möglich beeinträchtigen wollte.
Christine und das Ehepaar folgten ihm zurück zur Treppe, sie ließ die beiden vorgehen. Nach einigen Schritten aufwärts kam die kleine Kolonne plötzlich zum Stehen. Christine blinzelte ins Sonnenlicht und konnte den Grund dafür nicht erkennen. Hundegebell schallte herab und dann Haralds laute, scharf klingende Stimme. Es war nicht zu verstehen, was er rief, aber oben schien sich etwas Bedrohliches abzuspielen.
Christine drängte sich an dem Ehepaar vorbei die Stufen hinauf. Harald stand im Licht der weitgeöffneten Kellertür und hielt den bellenden Hund am Halsband. Er beugte seinen Oberkörper nach vorne und rief mit wütender Stimme: «Was tun Sie hier?»
Es folgte eine Pause, dann rief er erneut: «Was tun Sie hier?»
Christine starrte über seine Schulter hinweg und erblickte einen korpulenten Mann im hinteren Teil des Hofes. Er wich langsam zurück, während er Harald und den Hund fast die ganze Zeit über im Auge behielt. In seiner Richtung gab es nur den Hang mit hohem Gras und lauter Büschen.
«Was ist mit ihm?», fragte Christine. «Vielleicht will er auch Wein probieren?»
«Der nicht. Er kam von dahinten, wo meine Spritzmittel lagern.»
Der Unbekannte breitete die Arme aus. «Ich bin gewandert und habe mich verlaufen. Ich will zurück zur Straße.»
Harald antwortete nicht, sondern ging mit dem Hund langsam auf ihn zu. Als er am Tisch vorbeikam, an dem sie die Weine probiert hatten, nahm er einen Flaschenkorken auf und warf ihn in die Richtung des Fremden. Der Mann trug einen Anzug ohne Krawatte und bewegte sich weiter in Richtung des Hangs. Wie ein Wanderer sah er nicht aus.
Edda und die Kinder waren nirgendwo zu sehen.
Harald wandte sich zu Christine um. «Sie spionieren mich aus. Sie sabotieren meine Arbeit, verunreinigen meine Hefen, verschmutzen die Fässer. Es passiert nicht zum ersten Mal.»
Christine wollte ihn nicht alleine lassen und folgte ihm quer über den Hof. Das Ehepaar war vor dem Weinkeller stehen geblieben und beobachtete gespannt, was passierte.
Der Mann lief mit großen Schritten an Haralds Trecker vorbei, ließ Stellagen für leere Flaschen, eine Garage und einen weiteren Schuppen hinter sich. Nach wie vor vermied er es, Harald vollständig den Rücken zuzukehren.
«Ich Ein-Mann-Betrieb mache ihnen Angst«, sagte Harald. Seine Schritte wurden schneller. «Kannst du dir das vorstellen, Christine?»
«Lass ihn doch einfach. Warum solltest du jemandem Angst machen?»
«Weil ich besseren Wein mache. Deshalb wollen sie sich meine Lagen einverleiben.»
«Wer denn? Das klingt, als steigerst du dich da in etwas hinein.»
Er drehte sich kurz zu ihr um, um sein aufgebrachtes Gesicht zu zeigen.
Der Fremde hatte den Hang erreicht und begann, sich mit einer Hand immer wieder am Boden abstützend, hinaufzuklettern. Der Hund bellte ohrenbetäubend. Harald blieb stehen, bückte sich und warf einen Stein in hohem Bogen durch die Luft. Er prallte in der Nähe des Flüchtenden auf dem Boden auf. Der Mann sah sich um, seine Gesichtszüge waren angespannt, aber nicht ängstlich. Harald bückte sich abermals, griff nach dem nächsten Stein. Christine hielt seinen Arm fest. «Hör auf damit, bist du wahnsinnig?»
Harald blickte sie scheinbar ruhig mit seinen hellen, wässrigen Augen an. Im nächsten Moment ließ er den Hund frei, und das Tier schoss los. Seine Vorderbeine arbeiteten sich schwungvoll durch das Gestrüpp des Hanges, und schnell erreichte er steileres Gelände.
Der Mann drehte sich jetzt vollständig um in Richtung des Angreifers, griff rechts in sein Jackett und schrie: «Rufen Sie den Hund zurück!» Dann streckte er die Arme aus, wobei seine Hände etwas Schwarzes umfassten. Es glänzte metallisch in der Sonne.
In der nächsten Sekunde gellte Haralds lauter Pfiff durch die Luft. Ein Ruck ging durch den Körper des Hundes, als sei er in ein straffgespanntes Seil gelaufen. Er blieb stehen, zornig weiterbellend.
«Varus, komm! Komm sofort, Varus!» Der Hund gehorchte, während er sich immer wieder nach dem Mann oben auf dem Hang umblickte. Der war, als der Hund unten bei ihnen ankam, verschwunden.