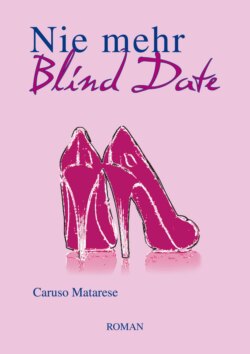Читать книгу Nie mehr Blind Date - Caruso Matarese - Страница 4
3. Trip in die Vergangenheit
ОглавлениеGestern machte ich einen Abstecher zu dem Internat, in welchem ich als Kind für ein Jahr verweilen durfte. Bemerkenswert deswegen, weil es ein Tag vor meinem vierzigsten Geburtstag war und ich über die Jahre ca. eine Milliarde Mal daran vorbei gefahren bin, ohne das Verlangen, dort anzuhalten. Dieses eine Jahr – ich war elf Jahre alt, erstes Jahr Gymnasium – war das traurigste in meinem Leben und ich frage mich, wie man so etwas seinem Kind antun kann? Daher wurde es wohl höchste Zeit für mich, dieses Kapitel meiner jämmerlichen Kindheit aufzuarbeiten. Wie aus dem Nichts und Dank wundersamer Fügung traf ich eine Lehrerin – es sind ja immer noch Sommerferien – die sich freundlicherweise und zu meiner Überraschung die Zeit nahm, mich durch die Flure der Erinnerung zu führen. Wie sich herausstellte, begann Frau Ruland vor (ca. dreißig Jahren) just in den Tagen als ich dort einsitzen durfte, ihre Lehrertätigkeit an meiner Schule. Sehr vieles war in den letzten Jahrzehnten umgebaut und verändert worden. Ich benötigte eine ganze Weile, um mich zu orientieren und zu erinnern. Dank der Anwesenheit von Frau Ruland, konnte ich in jedes Zimmer, in jeden Gang reinschauen. Wie ein routinierter und geübter Fremdenführer erörterte sie mit mir, wie es früher war. Es war noch alles da – abgespeichert. Die Namen der Lehrer und Betreuer, geliebt und gehasst, der Geruch in den Zimmern und Gängen, Namen von Mitschülern – ebenfalls geliebt und gehasst – sportliche Events die ich meistens gewonnen hatte – sportlich hat mir keiner was vormachen können – der Vorfall als ich mich übergeben musste, da ich noch nicht wusste, dass ich an einer angeborenen Laktoseintoleranz litt. Die einmalige und gescheiterte, versuchte Verführung spät nachts, durch einen Jungen namens Michael O., sowie die vielen endlosen Stunden der Einsamkeit.
Für ein Kind wie mich, war es die Hölle auf Erden.
Da war der Herr Niedermüller, ein kleiner Sadist, der uns Jüngeren in der Unterstufe zu oft Ohrfeigen verabreicht hat und gerne mit seinem Hobby, der Jagd prahlte. Bereits verstorben. Unser Betreuer, Herr Schmidt, ein Hüne von Mann, mit Händen so groß wie Teller, mit viel Humor und daher liebenswert. Ebenfalls verstorben. Frau Aufermann, die Englischlehrerin, gutherzig und unterhaltsam, aber mit einem üblen Mundgeruch. Sie beugte sich meistens so weit zu uns herunter, um unsere Mitschrift zu verfolgen, dass mir regelmäßig schlecht wurde. Leider auch schon verstorben. Unsere Mathematik und Physiklehrerin, Frau Römig, füllig wie eine Frau die wahrscheinlich mehrere Kinder zur Welt gebracht hat oder einfach nur gerne isst. Aber verständnisvoll uns Kindern gegenüber. Vor allem gegenüber derer, die sich – wie Millionen von Schülern – mit Mathe und Physik schwer taten, zu denen ich selbstverständlich auch gehörte. Wir mochten sie sehr und ihr gelang das Kunststück, dass wir uns sogar auf ihre Unterrichtsstunden freuten. Sie war die einzige Mathelehrerin, bei der ich nicht bereits das große Zittern bekam, wenn ich sie auch nur von weitem sah. Ich hatte sie wirklich sehr gerne. Und wenn ich mal jemanden in mein kleines Herz geschlossen habe, erfüllen mich die Erinnerungen an ihn, mit Freude. Ob sie noch lebt, habe ich vergessen zu fragen. Wahrscheinlich habe ich befürchtet, sie könnte auch schon verstorben sein. Ich bemerke, wie mir magentechnisch spürbar unwohl wird. Mein Gott, ich hatte ja keine Ahnung, dass mir diese Phase meines Lebens, nach fast dreißig Jahren immer noch so zusetzt! Da war noch diese Telefonzelle. Es gab nur diese Eine. Unmittelbar an der Straße, bevor man den kurzen Weg zum Internat hinter sich gebracht hatte. Symbolisch, die letzte Verbindung zur Außenwelt, die im Eingangsbereich des Internats schließlich endete. Diese Telefonzelle – heute lediglich ein modernes offenes Design, in welchem man vor lauter Lärm nichts versteht – damals das geschlossene gelbe Telefonhäuschen, wo man Stunden um Stunden hätte verbringen können, wenn es nicht so schmuddelig gewesen wäre. Diese Telefonzelle – exakt an dem Ort wie vor knapp dreißig Jahren – entpuppte sich als der Mittelpunkt meiner Erinnerungen. Denn das für mich so einsame Jahr 1979, in diesem muffigen Internat, reduzierte sich zu jenen fünf Minuten, an diesem einen Tag in dieser einen Telefonzelle, als ich verzweifelt und verloren meinen Vater anrief. Weinend flehte ich ihn an: „Hol` mich bitte,bitte hier weg! Ich bin krank.“ Tatsächlich war ich krank, Blindarmalarm. Ob er nur eingebildet war oder ich wirklich starke Schmerzen hatte, weiß ich nicht mehr. Tendiere jedoch zu der Erkenntnis, dass es simuliert war. Der letzte Hilferuf eines extrem unglücklichen Kindes. Eines Kindes, das wie Millionen anderer auch, sich zu tiefst im Stich gelassen fühlte. Und dass diese Wunde, wie ein brennendes und tief in der Seele quälendes Stigmata, mich ein Leben lang begleiten würde. Das Wunderbarste auf Erden, Tonnen der Erleichterung, Freudentränen von biblischem Ausmaß, unzählige Tage der Einöde (kurze Wochenenden ausgenommen) und Einsamkeit lösten sich in Nichts auf, denn mein Dad' kam so schnell mich abholen, als hätte er nur auf meinen Anruf gewartet und befreite mich somit aus diesem Kindergefängnis. Er war Sergeant in der U.S. Army und fuhr einen roten Amischlitten. Ich sah ihn schon von weitem. Ich liebte ihn von ganzem Herzen und beschloss, ihm hierfür ewig dankbar zu sein. Da stand ich nun mit meinen fast vierzig Jahren und war dermaßen in der Vergangenheit versunken, wie in einer Art Zeitmaschine. Es war ein herrlicher heißer Sommertag an diesem neunzehnten August 2009. Wie bizarr hat dieser Mann (Ich!) wohl ausgesehen, der so traurig und leer vor sich hin starrte? Die Straße vor dieser Telefonzelle war einsam und verlassen. Ich kam mir vor, wie in dem Kinofilm „Vanilla Sky“ mit Tom Cruise und Penelope Cruze, als für eine Szene eigens der Times Square in New York total gesperrt wurde und Tom Cruise dann ganz verloren inmitten dieses großen Platzes stand. Es war eine moderne Variante der „Ohnmacht“, also „ohne Macht“. Ich befand mich zwar nicht auf dem „Times Square“ in New York City, dafür aber an einer Telefonzelle vor (m)einem dämlichen (Ex) Internat. Meine „Ohnmacht“ war dieselbe.
Mein Dad’:
Eric Hendricksen, geboren am 27. September 1941 in New York City, USA. Gegangen ist er an einem eiskalten 6. Januar 2008. Er wurde nur sechsundsechzig Jahre alt. Das Kind von Einwanderern. Sohn eines Dänen, Benny Hendricksen, und einer Italienerin namens Lucia Matarese. Jüngerer Bruder, Richard. Aufgewachsen in Harlem, Stadtteil „Washington Heights“, 171ste Straße. Damals eine verruchte Gegend, wo man bei Dunkelheit besser nicht hinausgehen oder U-Bahn fahren sollte. Heute eine begehrte Wohngegend, die kaum mehr zu bezahlen ist. Dad war unbeschreiblich humorvoll und hatte Temperament. Ein Italiener halt. Er lebte seine Persönlichkeit. Er war authentisch. Ich musste ihn als Kind nur anschauen und konnte abschätzen, woran ich war. Auf diese Weise entging ich seinen gelegentlichen Wutausbrüchen, da ich den benötigten Sicherheitsabstand millimetergenau einhielt. Ein Temperament, dass ich volle Kanne von ihm geerbt habe. Ein besseres Wort für „Temperament“ ist „Extrovertiertheit“. Auch die habe ich von ihm geerbt.
Eintrag in mein nicht existentes Tagebuch:
Die Vergänglichkeit des Lebens trifft mich mit einer Wucht, der ich rein gar nichts entgegen zu setzen habe, –"niente". Unbegreiflich! Mir fehlen die Worte, und das kommt äußerst selten vor. Dad’ unterliegt jedoch nun seit fast zwei Jahren den unwiderruflichen physischen und physikalischen Gesetzen dieser grausamen Zeiteinheit. Bereits früh, viel zu früh, wurde ich mit diesem Thema, der Vergänglichkeit, konfrontiert. Als Teenager, mit dreizehn – zeitgleich mit dem Ausbruch der heftigsten Pubertät auf Erden – war ich gezwungen den viel zu frühen Tod meiner abgöttisch geliebten Großmutter, Oma Gerda, zu verkraften. Sobald ich laufen konnte, machte ich in mein Sandkasteneimerchen. Ich lief stolz zu ihr hin und rief: “Gerda: A - A!“ Nur bei ihr machte ich das. Nur ihr vertraute ich bedingungslos und wusste, wenn sie in meiner Nähe war, konnte mir nichts passieren. Sie war in jener Zeit die entscheidende Bezugs- und Vertrauensperson in meinem jungen Leben (und sollte es immer bleiben!), da ich als übersensibles Kind bereits spürte, dass meine Eltern bald „getrennte Wege“ gehen würden. Oma war die erste. Thomas G., mein bester Kindheitsfreund, war der zweite. Er starb bei einem Autounfall mit zwölf Jahren. Nicht angeschnallt. Vergänglichkeit im Doppelpack.Korrektur:
Ich werde alt.
Ich vertue mich in einer wichtigen Chronologie: Zuerst „ging“ oder „verließ“ mich mein Thomas. Hier erhielt mein junges Herz seinen entscheidenden ersten Riss oder „Crack“ (US-amerikanisches Englisch), mein Herz war angeschlagen und „vorbereitet“ für das „was kommen möge“. (Zu viele Anführungszeichen? – Ich „liebe“ Anführungszeichen!) Andere Formulierung: Eine schwere Gehirnerschütterung, erlitt ich als leicht hyperaktives Kind, im Alter von neun Jahren. Dann folgte mit zwölf, meine erste schwere „Herzerschütterung“. Meine Gehirnerschütterung war glücklicherweise gut verheilt. Ein gutes Jahr später „verließ“ mich mein „Schutzengel“, in Gestalt meiner „Ersatzmutter“: Oma Gerda. Mit dreizehn erlitt ich medizinisch korrekt formuliert, meine zweite schwere „Herzerschütterung“. Nichts gegen ‚Gehirnerschütterungen’ in den gängigen Varianten; aber die Krönung medizinischer „Erschütterungen“ sind aus meiner intensiven Erfahrungen, die „Herzerschütterungen“. Eigentlich hätte mir hier schon klar sein müssen, dass mein Leben ein gefühlsmäßiger, brutaler Spießrutenlauf werden würde. Ich will an dieser Stelle bestimmt nicht die Melodramatik neu erfinden, aber „heute“ ist es mir völlig unverständlich, wie ich es durch diese finstere und extrem deprimierende Zeit meines jungen Lebens schaffte. Tröstete ich mich damit, dass es „andere“ noch schwerer hatten? Nahm ich Medikamente? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich diese frühen und völlig unerwarteten Verluste, verkraftet habe.
***